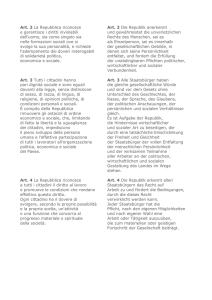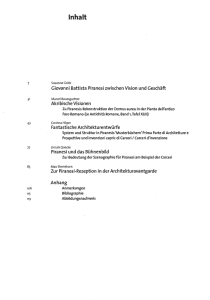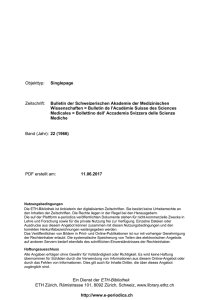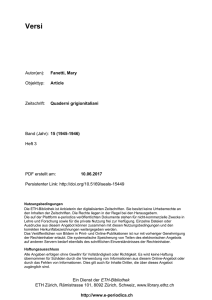caricato da
common.user14786
Congresso Internazionale di Diritto Romano 1935

Informazioni su questo libro Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell’ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo. Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l’anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire. Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall’editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te. Linee guide per l’utilizzo Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l’utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l’imposizione di restrizioni sull’invio di query automatizzate. Inoltre ti chiediamo di: + Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l’uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali. + Non inviare query automatizzate Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l’uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto. + Conserva la filigrana La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla. + Fanne un uso legale Indipendentemente dall’utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe. Informazioni su Google Ricerca Libri La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell’intero testo di questo libro da http://books.google.com Über dieses Buch Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde. Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist. Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat. Nutzungsrichtlinien Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen. Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien: + Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden. + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen. + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht. + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben. Über Google Buchsuche Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com durchsuchen. co The Library IS SIG RSITAS of the MI NN University of Wisconsin CONGRESSO INTERNAZIONALE DI DIRITTO ROMANO NG ?Ili, TRI LOVE TORO L . in KO ! ISTITUTO DI STUDI ROM A NI AT TI DEL CONGRESSO INTERNAZIONALE DI DIRITTO ROMANO (BOLOGNA E ROMA XVII - XXVII APRILE MCMXXXIII) ROMA VOLUME SECONDO PAVIA PREM . TIPOGRAFIA SUCCESSORI F .LLI FUSI VIA L . SPALLANZANI N . 11 1935 a . XIII Tutti i diritti riservati 766122 2 MAY 16 1952 . K35 . 676 RELAZIONI . FRITZ SCHULZ ORD . PROFESSOR DER RECHTE AN DER UNIVERSITÄT BERLIN DIE ANORDNUNG NACH MASSEN ALS KOMPOSITIONSPRINZIP ANTIKER KOMPILATIONEN Roma · II 事。 美學。 了, 第一 至也。 SUMMARIUM Quomodo compilatores Justiniani ex veterum iurisconsultorum scriptis excerpta ordinaverint, Bluhmius primus exposuit. Eam methodum a Justinianis observatam nequaquam singularem sed etiam ab aliarum compilationum auctoribus adhibitam esse , demonstratur in compilationibus his: in libro quem vocamus Mosaicarum et Romanarum legum Collationem , in Fragmentis Vaticanis, in libris Nonii Marcelli de compendiosa doctrina, in libris Verrii Flacci de verborum significatu . Das Problem der Komposition unsrer Digesten ist durch die berühmte Untersuchung Bluhmes ( 1) nicht vollständig erledigt worden . An dieser Stelle genügt der Hinweis auf die Literatur, die sich an die bekannte Arbeit von Hans Peters (2 ) angeschlossen hat, sowie auf die beiden Abhandlungen , die Arangio -Ruiz jüngst unserm Thema gewidmet hat (3 ). Zu den Desideraten auf diesem Gebiet gehört auch eine Arbeit, die die justinianischen Digesten einreiht in die römische Literaturgeschichte und die antike Lite raturgeschichte überhaupt. Bluhme hat die Frage überhaupt nicht aufgeworfen , ob denn die Digesten mit ihrer Anordnung nach Ex zerpten -Massen ein Unicum darstellen, oder ob nicht vielmehr die antike Literaturgeschichte mehr oder weniger nahe Parallelerschei nungen aufzuweisen hat. Aber auch die spätere quellengeschichtliche Forschung hat meines Wissens diese Frage nicht aufgeworfen mit Ausnahme allein von Giovanni Rotondi. Sein beklagenswert früher Tod hat den Abschluss dieser Untersuchungen verhindert. Ueber seine Vorarbeiten håt Arangio -Ruiz im 1. Bande der Scritti Giu ridici Rotondis kurz berichtet (4). Rotondi suchte das Komposi tionsprinzip der Fragmenta Vaticana zu finden ; seine Arbeit sollte einen Appendix erhalten über · Paralleli patristici alla struttura del ( 1) Z . f. gesch. RW . 4 ( 1820) 257. (2 ) Die oström . Digesten kommentare u . d . Entstehung der Digesten , in Be richte d . Sächs. Ges. d. Wiss. Phil. Hist. Kl. 65, 1913. ( 3 ) Conferenze per il XIV centenario delle Pandette (1931) 285 ff. ; Di al cune fonti postclassiche del Digesto , in Memorie Accademia Napoli 1931). (4 ) 487 ff. Fritz Schulz Digesto '. Leider stand die Arbeit noch gar sehr in den Anfängen , als der Tod den Unermüdlichen abrief. Ich versuche im folgenden an Rotondi anzuknüpfen und antike Exzerptensammlungen zu er mitteln , in denen die Exzerpte nach Massen ähnlich wie in unsern Digesten angeordnet sind . · Man frägt sich natürlich zunächst wie Rotondi, ob es denn kein iuristisches Sammelwerk gegeben hat, das nach Exzerpten massen angelegt war. Klassische Werke kommen hier natürlich nicht in Betracht, von nachklassischen Werken nach Lage unsrer Quellen nur die Collatio und die Fragmenta Vaticana . 1 ) Die Collatio . Zweifellos liegt eine Anordnung nach Massen zu Grunde, wie ein Blick auf unsre Tabelle I zeigt. Die Titel beginnen mit einem Zitat aus dem mosaischen Gesetz ; ihm folgen regelmässig Exzerpte aus Juristenschriften, nach Autoren geordnet, den Schluss bilden Kaisererlasse aus dem Gregorianus und Hermogenianus. Freilich erscheint diese Ordnung wiederholt gestört: mitunter folgen auf die Zitate aus dem Gregorianus und Hermogenianus noch einmal Zitate aus Juristenschriften ( Tit. I b , VI, X ), mitunter stehen die Exzerpte aus demselben Autor nicht zusammen (Tit. I, II, IV, VI, VII, X , XII), einmal (Tit. VI) steht am Schluss des Titels noch einmal ein Zitat aus dem mosaischen Gesetz. Zum Teil mögen diese Störungen der Massenordnung auf den Verfasser der Collatio selbst zurückgehen : der inhaltliche Zusammenhang der Exzerpte führte , wie in den Digesten , mitunter zu Verstellungen ; so erklärt sich vielleich die Stellung des Papinianfragments Coll. VI, 6. Zum grösseren Teil aber werden die Störungen auf Nachträge zurück gehen , die am Ende des Titels oder neben eine inhaltlich ver wandte Stelle am Rande hinzunotiert, später in den Text eindrangen und zu Störungen der ursprünglichen Ordnung führten. Mit solchen späteren Zusätzen dürfen und müssen wir rechnen , derartige Kom pilationen laden geradezu zu Nachträgen ein , es genügt hier, auf die Nachträge im Breviar zu verweisen . So ist der Schluss des Die Anordnung nach Massen als Kompositionsprinzip etc. - -- - 13 -- Tit. V der Collatio sicher ein späterer Zusatz (5 ), ebenso aber wohl der Schluss des Tit. XIV (8 6 ) (6 ) und des Tit. VI (Coll. VI, 7). Collatio IV, 4 wird von Paulus ein Responsum Papinians zitiert, ein Leser trug dieses Respousum aus Papinians Werk am Rande ein , später drang es in den Text und unterbricht nun die Paulus-Reihe (7). Vom Verfasser der Collatio wird dieses Zitat nicht stammen, denn er benutzt sonst die libri responsorum Pa pinians nicht, er verwertet responsa Papinians nur aus einem liber singularis de adulteriis (Coll. IV , 7 -11 ; VI, 6 ) (8 ). 2) Die Fragmenta Vaticana. Man nimmt allgemein an, dass die Anordnung der Fragmente in den Fragmenta Vaticana auf barer Willkür des Kompilators beruht (9 ). Das ist freilich wenig wahrscheinlich, wenn auch aus unserm spärlichem Material, bei dem wir auch wieder mit späteren Nachträgen rechnen müssen, das Anordnungsprinzip anscheinend nicht ermittelt werden kann. Wohl finden wir auch hier wieder Massen von Rescripten und von Exzerpten aus Juristenschriften , und bei den letzteren wiederum Massen von Exzerpten aus dem selben Autor, aber mehr lässt sich auch im Augenblick darüber nicht sagen ; nicht einmal über die Reihenfolge der Rescripte innerhalb der Rescriptenmasse lässt sich eine Regel aufstellen ; es sind anscheinend mehrere Konstitutionensammlungen , darunter weströmische, benutzt, von denen wir nichts weiter wissen . (5 ) VOLTERRA, Collatio legum Mos. et Rom . (1930 ) 97 ff., in Mem . Accad . Lincei CCCXVII ser. VI, v. III, fasc. I (Classe di sc. mor. stor. e filolog.). (6 ) Hier wird , wie sonst nirgends, auf neuere Novellen verwiesen , statt dass ein konkreter Beleg gebracht würde. (7) HUSCHKE und LENEL (siehe KÜBLERS Ausgabe) meinen, die Papinian stelle sei ursprünglich ein Teil des vorhergehenden Paulustextes gewesen und erst später ein selbständiges Fragment geworden . Aber die Angabe des Titels in der Inscription der Papinianstelle macht diese Annahme m . E . wenig wahrschein lich. (8 ) Auch in Tit. II scheint das Papinianfragment, das die Ulpianreihe un terbricht späterer Zusatz zu sein ; Papinians Definitionen sind in dem Werk sonst nicht verwertet. (9) P . KRÜGER , Geschichte d. Quellen ? 340 ; MOMMSEN, Apograph. d . Fragm . J'at. 400 f. 14 Fritz Schulz II Viel klarer ist das Bild , das uns die nicht juristischen antiken Kompilationen bieten. In erster Linie ist es das Werk des Nonius Marcellus de compendiosa doctrina, das die Beach tung des Juristen verdient. Das Buch ist eine sprachlich -gram matischen Zweken dienende Sammlung von Exzerpten aus Schrif ten der republikanischen und augusteischen Zeit. Man stellt es meist in den Anfang des 4 . Jahrh., frühestens kann es dem 3 . Jahrh . angehören . Manche dieser Exzerpte enthalten rechtsgeschicht liche Notizen, und so ist denn das Buch den Historikern des rö mischen Rechts natürlich längst bekannt; ein kurzer Auszug steht auch in Bruns' Fontes. Aber die Juristen scheinen bisher lediglich einzelne Fragmente benutzt und es unterlassen zu haben , in das Werk als Ganzes und in die Methode, mit der es komponiert wor den ist, Einblick zu nehmen . Das Werk des Nonius ist in 20 Bücher eingeteilt, was offen bar dem Stil solcher Werke entsprach, denn auch die Epitome des Festus, die Noctes Atticae des Gellius, die Etymologiae Isidors zerfallen in 20 Bücker ( 10 ). Jedes Buch behandelt eine besondere Materie, die die Buchüberschriften bezeichnen ; so Z . B . Buch 1 de proprietate sermonum ', Buch 5 de differentia similium signi ficationum '. Innerhalb dieser Bücher sind die Exzerpte in Lemmata zusammengefasst. Jedes Lemma wird regelmässig mit einer kurzen These , etwa einem dictum Gratiani vergleichbar, eröffnet ; dann folgen die Exzerpte als Belege, sei es ein einziges Exzerpt, seien es mehrere. Das erste Zitat wollen wir das Leitzitat nennen , die folgenden die accessorischen Zitate. Veranschaulichen wir uns die sen Sachverhalt an dem Lemma ' calvitur ': Calvitur dictum est frustratur : tractum a calvis mimicis quod sint omnibus frustratui. Plautus in Casina nam ubi domi sola sum , sopor manus calvitur . Pacuvius Medo: sentio, pater , te vocis calvi similitudine; et : sed quid conspicio ? num me lactans calvitur aetas ? (10 ) LINDSAY, Praef. zu seiner Nonius- Ausgabe p. XVI. Die Anordnung nach Massen als Kompositionsprinzip etc. Accius Eurysace sed memet calvor, vos istum iussi ocius abstrahite. Lucilius Satyrarum lib . XVII: si non it, capito , inquit, eum et si calvitur. ergo fur dominum ? Pacuvius Doloreste : me calvitur suspicio hoc est illud , quod fore occulte Oeax prae dixit. Sallustius Histor. lib . III: Contra ille calvi ratus. Dem dictum Nonii folgen, wie man sieht, Belege, erst das Leitzitat aus Plautus, an das sich die accessorischen Zitate an schliessen . Dann wird ein neues Lemma (Frigere ) vorgenommen . Die Folgeordnung dieser Lemmata in den Büchern , 1,5 -20 ist nun nicht die alfabetische. In den Büchern 2 - 4 sind die Lemmata zwar nach dem Anfangsbuchstaben alfabetisch geodr net, weiter geht die alfabetische Ordnung aber auch hier nicht. Diese Bücher 2 - 4 bilden ein Problem für sich . Man nimmt an , dass auch sie ursprünglich wie die Bücher 1,5 - 20 geordnet waren und die jetzige Ordnung eine spätere Umarbeitung darstellt. Zu nächst soll hier allein von den Büchern 1 ,5 -20 gesprochen werden . Hier ist die Folgeordnung der Lemmata, wie gesagt, nicht die al fabetische, aber auch sachliche oder historische Gesichtspunkte sind nicht massgebend . Die Ordnung ist vielmehr eine Ord - nung nach Massen . Liest man z. B . die Lemmata des 1. Buches der Reihe nach durch , so sieht man, dass die Leitzitate reihenweise demselben Autor entommen sind . So liest man am Anfang das 1. Buches eine lange Reihe auf einander folgender Lemmata , bei denen das Leit zitat fast ausnahmslos aus Plautus genommen ist. Aufdiese · Plau tus -Reihe folgt eine Reihe von Lemmata , bei denen das Leitzitat aus Lucrez genommen ist, dann eine · Accius- Reihe ', eine · Pom ponius- Reihe ' u . s. w . Dieser Plautus- Reihe ’ begegnen wir nun auch in den Büchern 5 - 20 , und zwar folgen die Dramen stets in derselben Reihenfolge. Auf diese · Plautus - Reihe ' folgt gewöhnlich wie im 1 . Buche, eine Reihe aus Lucrez, Accius und Pomponius, doch fehlt mitunter die eine oder andere Reihe. Was aber hier an der Plautusreihe demonstriert worden ist, gilt für die Bücher 1,5 - 20 schlechthin . Durchweg stossen wir anf längere oder kürzere Reihen Fritz Schulz von Lemmata, bei denen die Leitzitate demselben Autor entnom men sind . Diese Reihen folgen einander in den verschiedenen Bü chern in derselben stereotypen Ordnung; und auch innerhalb die ser Reihen folgen die einzelnen Werke (des Plautus, Accius, Ci cero u . s. w .) in einer bestimmten sich gleich bleibenden Ordnung. Aus diesem Sachverhalte ergibt sich ohne Weiteres: Nonius hat seine Quellen nach Massen exzerpiert . Er hatte sich eine Plau tus -Masse, eine Lucrez -Masse u. s. w ., im Ganzen etwa 40 Massen , gebildet, innerhalb deren er die Werke in bestimmter Weise ord nete oder schon in einer Ausgabe) geordnet vorfand. Für jede dieser Massen legte er sich ein Heft an , exzerpierte nun seine Massen systematisch der Reihe nach und trug, was ihm aufnahme würdig erschien , in die einzelnen Hefte ein . Diese etwa 40 Ex zerptenhefte bewahrte er in einer bestimmten Ordnung auf, wohl in derselben , in der er sie geschrieben hatte. Nun ging er an die Komposition der einzelnen Bücher seines Werkes. Er nahm jetzt seine Exzerptenhefte, eins nach dem andern , in derselben Reihen folge in der er sie aufbewahrte , und sah sie z . B . bei der Kompo sition des 5 . Buches (de differentia similium significationum ) auf Sy nonyma durch. Was er z. B. in dem Plautus- Hefte fand, trug er in sein Manuscript ein , und bildete so eine Reihe von Lemmata mit Leitzitaten aus Plautus. Dann nahm er sein Lucrez -Heft vor und trug in sein Manuscript eine Reihe von Lemmata mit einem Leitzitat aus Lucrez ein u. s. w . Bisher war allein von den Leitzitaten der Lemmata die Rede. Die accessorischen Zitate folgen grundsätzlich in derselben Reihenfolge wie die Leitzitate. Wenn Nonius eins seiner Exzerp tenhefte erledigt hatte, etwas das Plautusheft und nun beim Durch arbeiten des folgenden Heftes, des Lucretiusheftes ein Wort fand, für das er bereits in seinem Manuscript ein Lemma gebildet und eine Plautusstelle als Leitzitat geschrieben hatte , so blätterte er in seinem Manuscript zurück und trug das Lucrez - Zitat in diesem Lemma hinter dem Plautus - Zitat ein . Beim Durcharbeiten der Ac cius -Masse ergab sich dann vielleicht für das genannte Lemma ein dritter Beleg u. s. w . Dass Nonius in dieser Weise die Bücher 1,5 - 20 komponiert hat, darf heute als herrschende Ansicht der Philologen bezeichnet werden . Die Geschichte dieser Entdeckung darzustellen , ist hier Die Anordnung nach Massen als Kompositionsprinzip etc. nicht der Ort. Auf Grund deutscher Vorarbeiten (11) hat Lindsay die Kompositionsmethode in der Hauptsache abschliessend behan delt und klargestellt (12). Die Bedenken, die gegen Lindsays Theorie geltend gemacht worden sind, sind keineswegs durchschlagend (13). Es ist in diesem Kreise kaum nötig hervorzuheben , wie nahe die hier geschilderte Kompositionsmethode mit der unsrer Digesten verwandt ist. Freilich möchte ich die etwa 40 Massen des Nonius nicht mit unsern 4 Digestenmassen vergleichen , denn die Digesten massen umfassen Schriften verschiedener Autoren , während die 40 Massen des Nonius stets nur (freilich unter Umständen verschie dene) Schriften ein und desselben Autors umfassen . Wohl aber dürfen die Exzerptenhefte des Nonius mit den Nummern innerhalb der 4 Digestenmassen verglichen werden, also etwa mit den 82 Nummern der Papiniansmasse. Innerhalb der Papiniansmasse stehen bekanntlich am Anfang die Exzerpte aus Papinians Quaestionen , ihnen folgen die aus Papinians Responsa und Definitionen ; es fol gen die Exzerpte aus den Quaestionen des Paulus und Scaevola , aus den Quaestionen des Callistratus aus den Responsa des Paulus Buch 1 -7 , aus den Responsa des Scaevola Buch 1 u . s. w . Diese Folgeordnung ist grundsätzlich stereotyp. Genau so folgen bei No nius die Exzerptenmassen auf einander in einer immer wiederkeh renden Reihenfolge. Und wenn in unsern Digesten die Folgeord nung mitunter gestört ist, weil aus Gründen des inhaltlichen Zu sammenhangs etwa ein Fragment aus den Responsa des Scaevola unmittelbar neben ein Responsum Papinians gestellt worden ist, so entspricht dem das Verfahren des Nonius, etwa ein Exzerpt aus der Accius-Masse herauszunehmen und in die Plautusmasse als zweites oder drittes Zitat einzureihen . Auf die Einzelheiten der Lindsayschen Theorie kann hier nicht eingegangen werden ; ich darf die Romanisten nachdrücklich auf (11) Namentiich PAUL SCHMIDT, De Nonii Marcelli auctoribus grammaticis 1868. (12) Namentlich in seinem Buch · Nonius Marcellus ' Oxford 1901 (St. An drews University Publications N . 1). Siehe ferner die Praefatio zn seiner Nonius Ausgabe (bei Teubner 1901) und seine Abhandlung im Philologus 64 ( 1905 ) 438 . (13) Siehe die Literatur bei SCHANZ, Geschichte d . Röm . Lit. 4 , 1 (1904) S 826 ; TEUFFEL-KROLL 3 (6 . Aufl. 1913 ) 221 - 223 ; WESSNER , Bursians Jahresbe richte über d . Fortschritte der klass. Altertumswiss. 113 ( 1903 ) 155 ; 139 ( 1908) 115 ; 188 (1921) 106 f.; MARX, Luciliusausgabe 1 (1904) 78 ; 2 (1905 ) 5 f. 8 ff. Fritz Schulz die Literatur verweisen , namentlick auf die Schriften Lindsays, die knapp, elegant und grade für uns, die wir von der Digestenfor schung herkommen, schlagend und überzeugend sind. Nur auf fol gendes darf ich noch hinweisen . Was die Bildung der Massen bei Nonius angeht, so er gab sie sich wohl aus der Gestalt der von ihm benutzten Bücher, die eben die und die bestimmten Schriften eines Autors enthielten . So gibt es zwei Plautusmassen , die in der Folgeordnung der Mas sen weit von einander getrennt sind, die erste Masse enthielt die 21 Varronischen Dramen , die zweite Masse die A - Dramen : Am phitruo, Asinaria, Aulularia . Die Schriften Ciceros sind nicht in einer Masse vereinigt, sondern bilden acht Massen . In den ver schiedenen Massen wird Cicero auch verschieden zitiert, bald als M . Tullius', bald als · Cicero '. Von den Satiren des Lucilius bil den Buch 1 - 20 eine Masse, Buch 26 - 30 eine zweite . Die Exzerpte der ersten Masse nennen stets den Titel des Werks ( saturae), die der zweiten nie . Was die Quellen betrifft, aus denen Nonius geschöpft hat, so steht von einer grossen Reihe von Schriften fest, dass er sie im Original benutzt hat, so auch ältere Schriften wie die des Tur pilius, Ennius, Pacuvius, Pomponius. Zweifel, ob so alte Werke wirklich noch im 4 . Jahrh. vorhanden waren , sind , nachdem uns die Kompositionsmethode des Nonius klar geworden ist, nicht mehr berechtigt. Manche seiner Belege aber hat Nonius nachweis lich nicht aus den Originalen, sondern aus zweiter Hand. So hat er bestimmte Belege aus Gellius übernommen ; er hat sich ein Gel lius-Heft angelegt, d . h . eine Sammlung von Zitaten, die er bei der Gellius- Lektüre gefunden hatte; diese Gelliusmasse hat in der Massenordnung ihre bestimmte Stelle unter den Massen , die aus den Originalen exzerpiert worden sind ; zitiert wird Gellius nie mals. Doch ist Gellius nicht die einzige Zwischenquelle gewesen, Zahl und Charakter dieser weiteren Zwischenquellen lässt sich freilich nicht mit Sicherheit feststellen , es mögen Glossare oder grammatische Werke gewesen sein . Schliesslich hat Nonius aber auch seine Autoren in kommentierten Ausgaben gelesen , in denen Parallelstellen aus demselben Schriftsteller oder aus andern notiert waren. Solche Scholien nahm Nonius bisweilen mit dem Text auf, zu dem sie geschrieben waren, was zu einer scheinbaren Störung der Massenordnung führte. Originalschriften, Zwischenquellen in der Die Anordnung nach Massen als Kompositionsprinzip etc: Gestalt von Stellensammlungen und Kommentaren : das waren die Quellen des Nonius. Bei unsern Digesten verhält es sich nicht an ders ; auch hier ist die Benutzung von Zwischenquellen wahrschein lich, und dass die Kompilatoren Randscholien mit Angaben von Parallelstellen verwertet haben müssen , wird wohl heute allgemein zugestanden. Dass bei dieser Kompositionsmethode versehentlich Doppel lemmata entstehen konnten , liegt auf der Hand . Das Wort " oc catio ’ fand Nonius zuerst in einem seiner Cicero - Hefte, in dem de senectute exzerpiert war; wir lesen daher im 1. Buche inner halb dieser Masse ein Lemma ' occatio ' mit einem Beleg aus Ci cero de senectute . Als aber im Fortgang der Arbeit Nonius zu ei nem seiner Varro - Hefte griff, fand er abermals einen Beleg für ' occatio '. Hätte er sich nun erinnert, dass er für das Wort schon ein Lemma gebildet hatte , so hätte er in seinem Manuscripte zu rückgeblättert und das Varro - Zitat als accessorisches Zitat hinter dem Cicero - Zitat gebucht. Er erinnerte sich aber in diesem Falle an das frühere Lemma nicht und bildete daher ein zweites Lemma occatio ' das natürlich im Rahmen der Varro -Masse steht. Das 2 - 4 Buch ist wie schon gesagt anders geordnet, nämlich alfabetisch nach dem Anfangsbuchstaben des Lemmas. Innerhalb der einzelnen Buchstaben des Alfabets aber ist die Ordnung keine alfabetische mehr; hier treffen wir wieder die alten bekannten Reihen an, die die Folge der Lemmata und die Folge der Belege innerhalb der einzelnen Lemmata bestimmen. III Ich wende nich jetzt zu einer zweiten nicht juristischen antiken Kompilation, die eine Ordnung der Exzerpte nach Massen aufweist : es ist das Werk des Verrius Flaccus de verborum signi ficatu, bezw . der Auszug, den Festus daraus angefertigt hat. Auch dieses Buch ist jedem Romanisten bekannt, vielleicht noch bekann ter als das des Nonius: Auch von dem Auszug des Festus geben Bruns' Fontes einen Auszug ; aber dieser Auszug macht jeden Einblick in die Komposition des Werkes unmöglich , da er die überlieferte Reihenfolge der Exzerpte zu Gunsten einer rein alfa betischen Folge verändert. Wenn wir bei diesem Werke die Kom positionsmethode nicht so exakt ermitteln können wie bei der com Fritz Schulz pendiosa doctrina, so liegt das hauptsächlich an dem schlechten Zustand unsrer Ueberlieferung. Von dem Werk des Verrius ist uns überhaupt nichts erhalten, der Auszug des Festus ist nur höchst lückenhaft überliefert, und die Epitome des Paulus Diaconus bietet bei der Untersuchung der Kompositionsmethode keinen Ersatz, da er meist die Belege weglässt, oder, soweit er zitiert, doch nur höchst ungenau zitiert. Trotz dieser Schwierigkeiten hat doch be reits vor fast hundert Jahren Odfried Müller (14 ) erkannt, dass auch bei diesem Werk die Ordnung nach Massen ein Rolle spielt. Seine Untersuchung ist vor allem von Richard Reitzenstein ( 15 ) aufgenommen und fortgeführt worden. Eine übersichtliche, einiger massen abschliessende Darstellung des Sachverhalts fehlt leider, soweit ich sehe. Lindsays Festusausgabe (16 ) geht auf die Kom positionsfrage überhaupt nicht ein (17). In dem Werk des Verrius und ebenso dem des Festus waren sämtliche Lemmata insofern alfabetisch geordnet, als sie alle nach dem ersten Buchstaben geordnet waren . Innerhalb der einzelnen Buchstaben des Alfabets aber sind zwei Teile von Exzerpten zu unterscheiden . Der erste Teil bringt die Lemmata alfabetisch nach dem ersten , zweiten und oft auch noch dem dritten Buchsta ben geordnet, freilich nicht ohne Willkürlichkeiten und Störun gen (18). Im zweiten Teil aber wird auf den zweiten und dritten Buchstaben des Alfabets überhaupt keine Rücksicht ge nommen, die Lemmata folgen in Gruppen oder Massen, die durch den Inhalt der Exzerpte oder durch ihren Verfasser bestimmt sind . Diese Massen kehren in manchen Buchstaben wieder und zwar in derselben Reihenfolge. Aber Reitzenstein schloss seiner Zeit seine Untersuchung mi den Worten (19): staben herrscht durchgehend die Nicht in allen Buch gleiche Ordnung : Schichten , welche sich in den ersten Buchstaben regelmässig finden, fehlen ( 14 ) Sex. Pomp. Festi de verborum significatu (Lips. 1839) S . XVI seq. (15 ) Verrianische Forschungen , Breslau 18887, in Breslauer Philolog. Abhand lungen 1, 4 . ( 16 ) bei Teubner 1913 . 117) Siehe zum Ganzen SCHANZ 2, 1 (1911) S. 506 ; TEUFFEL-KROLL 2 (1920 ) 140 . (18 ) REITZENSTEIN 68 ff. (19 ) REITZENSTEIN 67. Die Anordnung nach Massen als Kompositionsprinzip etc. 21 in späteren ; was in einigen Buchstaben vereinigt ist, steht in andern getrennt, und trotz der Gleichartigkeit der ganzen Anlage macht sich im Einzelnen oft eine gewisse Willkür geltend '. Da rüber hinaus scheint bis heute die philologische Forschung nicht gelangt zu sein . Vielleicht würde eine erneute Prüfung unter Be rücksichtigung der von Lindsay für Nonius ermittelten Tatsachen weiterführen , aber das sind Arbeiten, die von Philologen gemacht werden müssen. Hier muss es genügen , die Massenanordnung an Beispielen an der Hand der Tabelle II zu veranschaulichen (20 ). In den Buchstaben P und R sind , wie man sieht, zwei Ca tomassen erkennbar. In P folgt der zweiten eine Plautusmasse, die auch in C sich hinter der Catomasse findet. Weiter folgt in P eine Masse über Hochzeitsgebräuche ; dieser Masse begegnen wir in C gleichfalls hinter der Plautusmasse, in F MOR (wo die Plautus masse fehlt) hinter der Catomasse. In P folgt weiter eine Masse über Sacralrecht (aus Capito und Veranius) ; auch dieser begegnen wir in den Buchstaben CFMO R . Schliesslich folgt in P eine etymologische Masse, die sich auch in C MRS findet. In P und R stehen zwischen den beiden Catomassen eine sacralrechtliche Masse und eine Masse aus Ennius, Plautus, C . Gracchus. Das muss an dieser Stelle genügen zum Nachweis, dass auch hier die Massenordnung eine Rolle spielt. Wieweit sie durchgeführt, wieweit sie durchbrochen , und warum sie durchbrochen wurde, ist bisher noch nicht ermittelt worden und vielleicht mit unserm Ma terial überhaupt nicht zu ermitteln . IV Aus späterer Zeit ist noch zu erwähnen die Historia tripertita des Cassiodor, auf die bereits Rotondi hingewiesen hat, vor allem aber die Anthologie des Stobaios. In dieser letzteren sind die Ex zerpte der Dichter von denen der Prosaisten gesondert, und auch innerhalb dieser beiden Massen würde sich wohl eine stereotype Reihenfolge der Exzerpte ermitteln lassen, wenn man das Werk einmal mit Lindsays Methode untersuchen wollte. Philologische ( 20 ) Zu folgenden siehe REITZENSTEIN 41 ff. Fritz Schulz Untersuchungen scheinen zu fehlen. Auch auf die Katenen (21) mit ihren Reihen von Exzerpten aus demselben Autor soll hier nur im Vorbeigehen hingewiesen werden (22). Aus dem Vorgetragenen er gibt sich m . E . mit hinlänglicher Gewissheit: die Digesten sind in ihrer Anordnung der Exzerpte nach Massen in der antiken Litera turgeschichte kein Unicum ; es finden sich hier Parallelerschei nungen, und zwar nicht erst in byzantinischer Zeit, sondern , wie das Werk des Verrius zeigt, bereits in der Periode, die wir die klassische nennen . Wer die Macht des Genos in der antiken Lite raturgeschichte kennt, wird den geistigen Zusammenhang zwischen den hier geschilderten Werken und unsern Digesten nicht bestrei ten. Auch in ihrer Technik sind also Justinians Digesten kein spezifisch byzantinisches Werk. TABELLE I. Massen der Collatio . Tit. I. Moyses. Paul. Sent. Ulp. De off. proc. Paul. Sent. Tit. II. Tit. Ib . Moyses Moyses Ulp . De off. proc. Ulp. Reg. Pap. Def. Paul. Sent. ( Ulp . Ed. (Greg . Tit. III. Moyses Paul. Sent. Ulp. De off. proc. Greg. Paul. De iniur. Paul. eod . Greg . Greg. Ulp. De off. proc. ( Paul. Sent. Mod. Diff. Paul. Sent. Tit. IV . Moyses | Paul. De adult. Paul. eod . Paul. eod. Tit. V Moyses Paul. Sent. Tit. VI. Moyses Ulp. Reg . Val. Theod . Arc. Paul. Sent. Pap. Resp. Paul. De adult. Pap . De adult. Pap. eod . Pap. eod . Pap . eod. Pap . eod . | Paul. Sent. Tit. VII. Moyses Paul. Sent. Ulp. Ed. Greg . Ulp . De off. proc. Hermog . Paul. Sent, Pap . De adult. Moyses (21) Dazu PETERS 5 f. (22) Vgl. auch GENZMER, diese Atti 1, 350 f. Die Anordnung nach Massen als Kompositionsprinzip etc. Segue Tabelle I. Tit. VIII. Moyses Paul. De poen . Paul. Sent. Paul. eod. Paul. eod. Tit. IX . Moyses Moyses Ulp . De off. proc. Mod . Diff. Hermog . Paul. Sent. Hermog. Hermog . Hermog . Paul. Sent. Greg. Paul. Resp . . Paul. eod. Ulp . De off. proc. Tit. XII. Moyses Paul. Sent. Paul. eod . Paul. eod . Ulp . De off. proc. Paul. De poen . Ulp. Ed. Tit. XVI. Moyses Gai. Inst. Paul. Sent. Ulp . Reg . Ulp . Inst. Ulp . eod . Ulp . eod. Ulp . eod. Ulp . eod. Tit. XIII. Moyses Paul. Sent. Tit. XI. Tit. X . Tit. XIV . Moyses Paul. Sent. Moyses Paul. Paul. Paul. Paul. Sent. eod. eod. De poen . Paul. eod . Ulp . De off. proc. Tit. XV . Moyses Ulp. De off. proc. Ulp. De off. proc. Ulp. De off. proc. Greg. Fritz Schulz TABELLE II. Massen bei Verrius. MO Cato Sacralrecht crebrisuro -Cyprio L . 51 C . Gracchus frux fructum coepiam ferocit Citeria felices L . 81 Ennius Plautus Cato L . 52 obsidionem -osi sunt L . 218 - 220 L . 81 portisculus retricibus -pilates L . 266 - 268 L . 356 peregrina sacra propudialis L . 268 - 274 rutilae L . 358 philologam redinunt - Petreia L . 278 respublica L . 362 pellicula recto fronte multifacere- ostende tionem mediocriculo obsonitavere pavimenta ratissima L . 140- 142 L . 220 L . 364 L . 280 -282 Plautus curionem Naevius Ennius corpulentis prolato penitam L . 52-54 L . 282 Hochzeits gebräuche conciliatrix Sacralrecht -cupressi feriae statae Mutini minuitur L . 54-56 fluoniam L . 82 L . 142- 144 curiales Alammeo furvnm L . 82-83 maximae maiorem consulem L . 144- 154 Veranius) flamines cubans L . 56 -58 Etymolo contio-ciere mendicum gisches L . 58 L . 154 (Capito ; - rogat -modo opigenam L . 221 oletum L . 221 privatae feriae praetextatum L . 282- 283 Regillis Rapi L . 364 palatualis Ritus flamen remisso purime L . 284 -300 | L . 364-368 patronus praesagito L . 300 -302 Repertum rictus L . 368-370 · Die Anordnung nach Massen als Kompositionsprinzip etc. Drei Lemmata aus Nonius Marcellus Buch 1 . Calvitur dictum est frustratur : tractum a calvis mimicis, quod sint omnibus frustratui. Plautus in Casina : nam ubi domisola sum , sopor manus calvitur. Pacuvius Medo: sentio, pater , te vocis calvi similitudine ; et: set quid conspicuo ? num me lactans calvitur aetas ? Accius Eurysace: sed memet calvor. vos istum iussi ocius ab strahite. Lucilius Satyrarum lib . XVII : " si non it, capito ', iuquit, ' eum , et si calvitur '. ergo fur dominum ? Pacuvius Duloreste : me calvitur suspicio, hoc est illud, quod fore occulte Oeax praeditxit. Sallustius Histor. lib . III : contra ille calvi ratus. Frigere est Friguttire et Fritinnire, sussilire cum sono vel erigi et excitari, quod quaecumque friguntur vel frigent nimio calore vel frigore, cum sono sussiliunt. Plautus Casina: nam quid friguttis ? quid istuc tam cupide cupis ? Varro Virgula Divina: et pullos peperit fritinientis. Idem "Ovos ivgas : saepe totius theatri tibiis crebro, flectendo, com mutare mentes, frigi animos eorum . Defloccare est adterere: tractum a vestibus sine flocco. Plautus Casina : perii ! flocco habebit iam illic homo lumbos meos. Roma · II Y ERNST LEVY ORD . PROFESSOR DER RECHTE AN DER UNIVERSITÄT HEIDELBERG ZUM WESEN DES WESTRÖMISCHEN VULGARRECHTES ! SUMMARIUM Viri prudentes qui ex iussu Alarici regis Breviarium composuerunt, cum non magna vi ingenii essent, rationem et disciplinam iurisconsultorum primariorum non iam intellexerunt. Sic factum est ut vel inscii vel vix scientes normas iuris multis locis commutarent. Itaque dissertatione ea quae proposita est exempli causa demonstratur primum eos significationem vocis condicionis ' commutasse , deinde eos negotium emendi vendendi cum actu dominii transferendi confudisse. Breviarium sententiis scatet inter se discrepantibus. Sed quae sententiae re vera quinto p . Chr. saeculo in iure et usu populi fuerint, interdum ex fontibus dispicere possumus quorum quaeque sententia fuit. Qua in quaestione magnopere adiuvamur excerptis quae ex Interpretationibus Codicis Theodosiani Sententia rumque Pauli facta sunt. Sed maioris momenti quam Breviarium ipsum fragmenta Codicis Euriciani videntur esse. Auf dem Territorium des einstigen römischen Reiches zeichnet sich der Ausgang der Antike durch eine Reihe von Kodifikationen ab. Unter ihnen sind zwei, die an Umfang wie an epochemachen der Nachwirkung alle anderen weit hinter sich lassen : das Römische Westgotengesetz von 506 und die Rechtsbücher Justinians mit ihrem Hauptstück, den Digesten, deren vierzehnhundertsten Ge burtstag festlich zu begehen die Roma aeterna uns zu imposanter Kundgebung in ihren Mauern aufgerufen hat. Beide Werke sind gemäss dem Willen der sie patronisierenden Herrscher abgeschlos sene Gesetzgebungen mit dem ausgespochenen Zweck, die einge rissene Rechtsanarchie zu beheben und eine einheitliche, endgültige Ordnung zu schaffen , neben der bei Vermeidung schwerer Strafen keine andere Norm mehr angewandt werden darf. Beide sind nicht autochthon aus der Zeit geborene Schöpfungen , sondern blosse Kom pilationen : sie nehmen ihren Stoff aus dem römischen Recht in seinen vielfältigen Stufen von der klassischen Epoche bis zu ihrer eigenen Gegenwart, für das Privatrecht vornehmlich aus den Ju ristenschriften , für das öffentliche Recht ganz überwiegend aus den Erlassen der Kaiser. Beidemale liegt die Ausführung des legisla torischen Planes in der Hand amtlicher Kommissionen , deren Auf gabe vor allem der Sammlung und Auswahl des als brauchbar be fundenen Materials gilt. Ernst Levy 30 Weithin also Gleichförmigkeit der Zielsetzung und Ahnlichkeit der eingeschlagenen Wege. Und doch : welch gewaltiger Abstand zwischen dem beiderseits Erreichten ! Entlehnt sind Gliederung und Reihenfolge der behandelten Gebiete grossenteils auch in den drei justinianischen Werken , aber vielerlei ist verändert, und alle Exzerpte sind unter Befolgung eines festen Planes, wenn schon nicht stets mit vollem Gelingen , nach sachlichen Prinzipien selb ständig geordnet. Im Westen dagegen wurde ein Neubau nicht einmal versucht. Vom Kauf oder vom Testament handelten die Paulussentenzen , die Gaiusepitome und der Theodosianus, jedes Werk seiner Struktur gemäss an ganz bestimmtem Ort. Man wird diese Stellen wohl auch miteinander verglichen haben , denn in gewissem Masse scheint eine Scheu vor Wiederholungen sichtbar (1 ). Aber, einmal auserlesen , blieben sie, wo sie waren . Roh und un behauen ragen die in ihrem Charakter so verschiedenartigen Ruinen der Leges und Jura verbindungslos hintereinander empor. Vielleicht, so könnte man meinen (2), lohnte es die Mühe nicht, für die unterworfenen Bevölkerungsgruppen den Rechtsstoff har monisch zu gliedern. Allein das, was man aus diesem Stoffe wählte, gibt nicht weniger zu denken . Tribonian , der Vielgeschmähte , und die Seinen liessen es sich nicht verdriessen, nach dem Höchsten zu greifen und aus dem Segen der klassischen Ernte köstlichste Frucht zu bergen , nicht immer imstande mehr, sie ganz zu nutzen, aber noch fähig des heiligen Schauers, den die Berührung mit wahr haft Grossem erweckt. Die Prudentes des Alarich bezeugen durch das armselige Zitat einer in ihrer Isolierung belanglosen Aeusserung nur das eine, dass sie Papinians Responsen hätten verwerten kön nen , wenn sie gewollt hätten. Zwar fehlt es nicht an Werken , in deren Ausbeute sie sich mit den Byzantinern berühren : die sog. Paulussentenzen, der Codex Theodosianus und einige spätere No vellen gehören dazu. Aber gerade sie zählen im Corpus iuris zu den in Formgebung und Denkgehalt schwächsten Bestandteilen . Und was die westliche Sammlung darüber hinaus aufweist, ist in der Hauptsache bescheidene Erläuterungsarbeit anonymer Hand ( 1) In dieser Richtung zu weitgehend CONRAT, Gaius 124 ff.; dagegen KRÜ GER , Gesch. 356 Anm . 43. ( 2) S . jedoch immerhin Alarichs Einführungsverordnungen (MOMMSEN XXXII sgg .). Zum Wesen des weströmischen Vulgarrechtes werker. Wird doch nicht einmal mehr der wirkliche Gaius zugrunde gelegt. Dem Armutszeugnis der Auswahl entspricht das Schweigen des Auswählenden . Tribonian hat eine deutliche Vorstellung von dem , was er will, und darum oft auch im einzelnen bestimmte Standpunkte, die er interpolierend -versteckt oder dezidierend -em phatisch zur Geltung bringt. Alarich ist stumm . In den Interpre tationen spricht er gewiss nicht unmittelbar, und Aenderungen im übernommenen Text werden auf ihn kaum je zurückgehen . Er kommt nicht zu Wort, weil er zu wenig zu sagen hat, und der Klassiker nicht, weil er zu viel zu sagen hätte . Auch wo die Be griffe und Termini noch aus der hohen Aera der Jurisprudenz nach klingen , sind sie verweht und in ihrem einstmaligen Sinn kaum mehr recht fassbar. Hinter ihrer Fassade breiten sich Missverständ nisse aus, die im weiteren Verlauf ungewollt zu Aenderungen, ja zu Umwälzungen führen . Das möchte ich wenigstens an zwei Fällen etwas näher beleuch ten . Der eine betrifft das Recht der condicio. In der klassischen Sprache hat das Wort bekanntlich eine sehr vielseitige Verwen dung. Es ist die rechtliche Lage oder Kennzeichnung : der Status eines Menschen oder einer Sache, die nähere Charakterisierung (z . B . Neben - oder Folgebestimmung) einer Rechtsnorm oder eines Rechtsgeschäftes. Als rechtsgeschäftliche Nebenbestimmung insbe sondere kann die condicio von verschiedenster Funktion sein : eine societas wird eingegangen ea condicione, dass ein Dritter die Anteile zu bestimmen habe (Proc. D . 17, 2, 76 ), der Gläubiger veräussert das Pfand ea condicione, dass er für Eviktion nicht einzustehen brauche (Pap. D . 21, 2 , 68 pr .), das Testament erklärt gewisse Sklaven für frei sub hac condicione, dass sie am Grabmal des Erb lassers abwechselnd die Lampe anzünden und Totenfeiern veran stalten (Mod. D . 40, 4 , 44). Auch für eine Auflage, wie sie der letzte Tatbestand bietet, ist die klassische Bezeichnung noch eher condicio als modus (3). Aber technisch geworden ist das Wort nur für eine Verbindung : für die Nebenbestimmung, die die Geschäfts wirkung von einer ungewissen Tatsache abhängig macht und also (3 ) PERNICE, Labeo , II 12 ff, 26 ff; MITTEIS, Röm . Priv . R . I 194 f, vgl. zuletzt WHISS, RE XV 2334 tf. Uebrigens gehören nicht alle VIR I 875 , 1 ff genannten Stellen hierher. Ernst Levy bis zu deren Eintritt hinausschiebt. Eine Verwirrung war davon so wenig zu besorgen wie etwa in den heutigen Kulturrechten , die in condition (engl. und franz.), condicione, Bedingung ganz ähnlich mehrfache Sinngehalte vereinigt sehen (4 ). Das nötige Unter scheidungsmerkmal bot jeweils die Formulierung der condicio oder mindestens der Zusammenhang . Bewusst unterschied man eum cui ita datum sit ' si monumentum fecerit ' et eum , cui datum est ' ut monumentum faciat ' (Scaev . D . 35, 1, 80 i. f.) (5 ): Bedingung und Auflage. Wo es aber in theoretischen Erörterungen abstrakt condicio hiess, war immer die (suspensive) “ Bedingung , gemeint. Dieser elementare Sachverhalt, von dem noch die justiniani schen Texte eine fast ungetrübte Kunde bewahren , ist schon im Codex Theodosianus und weiterhin im westlichen Vulgarrecht über.. haupt so gut wie spurlos verschwunden. Condicio für sich allein bedeutet – im Bereich des Rechtsgeschäfts – kaum etwas anderes mehr als pactum . In solchem Sinne schreibt die Consultatio (4 , 8 ) da, wo Paulus an technische condiciones denkt (Sent. 3 , 4 b , 2), einfach pacta vel condiciones (6 ). Bei der Betrachtung der Stipula tions - und Verbürgungsformel bemerkt die Gaiusepitome, hac condi cione würden sowohl debitor wie fideiussor obligiert (2 , 9 , 2). Fehlt bei der Verpfändung das Verkaufspaktum , so ist das pignus sine con dicione bestellt (IP 2, 5 , 1) (6a), und condicio heisst nicht minder der Pfandvertrag überhaupt (IP 5, 7, 14) wie dotis condicio der Dotal vertrag (IG 4') wie donationum condicio der Abschluss von Schen kungen (CT 3 , 30 , 2 == 8 , 12, 1 pr. i. f. (7). Zum Prokurator d. h . zum Mandatar (8), der für uns erwirbt, bilden den Gegensatz die (4) Vgl. SCHWARZ, Rechtsvergleichendes Handwörterbuch II (1929), 392 f. 395 ; s. auch VON TUHR, Allgemeiner Teil des deutschen bürgerlichen Rechts III (1918 ) 271. (5) losoweit echt. (6 ) S. auch die condiciones in Cs. I , I und 4, 1. (6 a ) Die Bezeichnung der Rechtsquelle ist hier überall in derselben Weise abgekürzt wie in meinem Ergänzungsindex zu lus und Leges. (7 ) Ebenso einige Hss, von IT 3, 30, 2 , die im übrigen statt dessen dona tionis sollemnitas sagt. CT ist aus FV 249, 4 verkürzt, wo in obeundis donatio num officiis steht. Doch hat kurz vorher auch dort, im Munde Konstantins, condicionibus denselben Sinn . ( 8 ) SZ . 49, 242 n . 1. Zum Wesen des weströmischen Vulgarrechtes 33 Personen , quae nobis nulla condicione, also durch keine Abmachung , obligatae sunt (IP 5 , 2 , 2) usw . (9 ). Viel sprechender aber ist das Verhalten der Quellen da, wo ihre Vorlage eine wahre Bedingung erörtert. Bisweilen gleiten sie schweigend darüber hinweg (10). Häufiger begegnet eine Umdeu tung. Konstantin erwähnt noch die donatio condicionibus faciendi non faciendive suspensa (FV 249, 3, ähnlich CT 8, 12, 1 pr.), also doch wohl eine wirkliche aufschiebende Potestativbedingung (11). Die Interpretatio aber malt sich den Tatbestand so aus, dass der donator obligat illum cui donat, ut aliquid faciat aut non faciat; sie nimmt das obligat alsbald mit iubeat und ordinet wieder auf, setzt also kurzerhand an die Stelle der Bedingung die Auflage (12). Erfüllt der Beschenkte sie nicht, so ist folgerecht die Schenkung nicht etwa von Anfang an ohne Wirkung, sondern erst jetzt wird sie unwirksam (13). Entsprechend fällt, wenn das geforderte Tun inpossibile oder inhonestum ist, nicht, wie nach Bedingungsrecht (14), die ganze Schenkung dahin ; ganz im Gegenteil: sie ist remotis condicionibus firma, offenbar weil nur die Auflageverpflichtung von der Unmöglichkeit oder Sittenwidrigkeit betroffen scheint. Das gleiche wiederholt sich – im Ton noch frappanter – bei der Erbeinsetzung. Eine condicio impossibilis ( so PS 3, 4 b , 1) ist gegeben, wenn impossibile aliquid heredi fuerit iniunctum (IP 3, 6 , 7); das ist – hier wie in IP 3, 8, 4 – dasselbe Auferlegen (iniungere), aus dem die Westquellen auch sonst eine Verpflichtung des Erben entspringen lassen (15 ). Eine solche condicio ist wie.. (9) %. B. IP 1, 4, 7; IT 10, 3, 2 ; INT 9 i. f.; CE 285; RB 38 , 1. (10 ) So in IP 2 , 3 , 1. Den statu liber scheint das Vulgarrecht durchweg beiseitezulassen . (11) Suspensa ! Die Nichtberücksichtigung der Kasualbedingung (s. unten ) fällt dabei schon hier auf. In welchem Sinne gleich hernach condiciones pactio . nesque steht, ist nicht sicher zu sagen ; zu 249, 4 init. s . ob. N . 7. (12) Nicht bemerkt von CONRAT, Paulus 79 f und VASSALLI, Misc . crit. 3, 45 ff (Bericht darüber: RABEL, ZSSt 46 , 470 f). (13) tunc infirmatur donatio , quando condiciones honestae et possibiles inpletae non fuerint. (14 ) Die besondere klassische Ausgestaltung bei unsittlicher Bedingung tut hier nichts zur Sache, vgl. etwa SIBER, Röm . Priv . R . 418 . (15 ) Vgl. IP 3 , 6 , 10 ; 3 , 8 , 5 ; 4, 1, 6 . – In ganz anderem Sinne spricht Gai. D . 35 . 1, 69 i. f. von einer condicio personae iniuncta , aber vermutlich nicht Gaius selbst: BESELER, ZSSt 47, 375 . Ernst Levy derum statim submovenda, quia nullum scripto heredi impedimentum facit. Der condicio possibilis wird in derselben IP allerdings ein ge wisser Suspensiveffekt zugestanden , aber nur in Verfolg der Un terstellung, dass der Erblasser in testamento suo condicionem heredi constituat, quam prius impleat, quam hereditatem praesumat : ledig lich wegen dieser ausdrücklichen Weisung soll die hereditas nicht angetreten werden (praesumi), quamdiu condicio impleatur. Zugleich wandelt sich des Klassikers Bedingung, quae per rerum naturam admitti potest, unversehens in eine solche, die vom Erben erfüllt werden kann . Eine condicio, die keine potestative wäre, scheint von den Weströmern überhaupt nicht mehr begriffen zu werden . In der condicio quae existere non potest (Gai. III 98 ) erblickt der Epitomator eine condicio, die impleri pro rei difficultate non possit (GE 2 , 9, 6 ). Sagt Gaius II 144 inpersönlich , dass der Erbe con dicione defectus sit, so stellt sich der Auszug (2 , 3, 4 ) vor, dass die condicio possibilis... inpleta non fuerit. Immer wird der unter der condicio Stehende als handelnd (oder unterlassend ) gedacht. Ganz begreiflich . Denn nur zum Handeln (oder Unterlassen ) kann der Auflageschuldner verpflichtet sein ; die kasuelle Bedingung ist zur Umdeutung in eine Auflage nicht tauglich. Sollte man indessen allen Kasualbedingungen haben auswei chen können ? Sollte man z . B . ein Testament verworfen haben, in dem es etwa hiess: Titius heres esto . si Titius heres non erit, Seius heres esto ? Keineswegs. Aber die Rechtsfolgen , die man da ran knüpfte, sind völlig unklassisch und in hohem Masse erstaun lich . Substitutus ist jetzt nicht melır der Ersatzerbe, der bloss unter der Bedingung berufen wäre, dass der institutus nicht Erbe wird . Sondern es ist ein Nacherbe, an den die Erbschaft wie an einen Fideikommissar herauszugeben dem Vorerben auferlegt ist : ea tamen ratione (sagt IP 3 , 6 , 10 i. f.), ut sicut committitur fidei heredis, sic quibuscunque verbis testator iniunxerit, hereditas defuncti ab insti tuto ad substitutum valeat pervenire ( 16 ). Einstens freilich hatte das Dogma Semel heres semper heres dergleichen schlechterdings ver wehrt, und nur der prekäre Ausweg über das Universalfideikommiss hatte sich allmählich geöffnet (Gai. II 184. 277). Jetzt wird zwar noch die Auflageverpflichtung zur Weiterleitung der Erbschaft unter den Gesichtspunkt des Fideikommisses gebracht (17), der Zweit ( 16 ). Derselbe Ausdruck noch mehrfach in IP 3 , 6 , 11. (17) Offenbar ohne Abzug der Quart , vgl. u . n . 28. Zum Wesen des weströmischen Vulgarrechtes 35 berufene aber als wahrer Erbe betrachtet (18 ). Die Aufeinanderfolge mehrerer Erben wird möglich . Nur nicht in unendlicher Reihe. Während die Einsetzung von Ersatzerben ihrem Wesen nach nicht ausarten kann , bedarf ein Nacherbsystem irgend welcher Begren zung. Auch sie erreicht man vermöge einer seltsamen Missdeutung. Paulus schrieb einfach (Sent. 3 , 4 b , 4 ) : Instituuntur primo gradu , substituuntur secundo vel tertio scripti, er hätte ohne weiteres vel sequentibus hinzufügen können , wie es z. B. in UE 22, 33 zu lesen ist (19). Die Interpretatio aber versteht die drei Grade taxativ und macht daraus Folgendes: ... qui primo gradu heredes scripti sunt, instituti appellantur : qui secundo, substituti : qui tertio , scripti vocantur: quia usque ad tertium gradum heredes substituere pro testatoris vo luntate permissum est. Drei Erben hintereinander also kann sich jeder bestellen : zeugt es schon von Verständnislosigkeit, dass der zweite Erbe substitutus heisst, so ist es grotesk, den dritten scriptus zu nennen . An der Bedingung vorbeizukommen mochte sachlich dadurch gelingen , dass man sich — bestenfalls in übel angewandter Erinne rung an die klassische Aufzeigung des zugleich temporalen Gehalts von si -Formeln ( 20 ) — das si Titius heres non erit im Sinne eines cum T. h. n . e. zurechtlegte , also es auch dann noch als gegeben ansah , wenn Titius nicht mehr Erbe war. Terminologisch sah man in solchem si -Satz auch weiterhin eine condicio , aber wiederum in der neuen Bedeutung. Condicio testamenti heisst mitunter (GE 2 , 7 , 8 , init.) (21) die Auferlegung eines Fideikommisses, ein andermal (IP 1, 11, 2) (22) speziell die Anordnung einer Nacherbfolge, und ( 18 ) Das übersieht Conrat, Paulus 80, 191 ff, der im übrigen vieles richtig beobachtet hat. (19) Vgl. auch Gai. II 174 . (20 ) und des zugleich kondizionalen Gehalts von cum -Formeln . Vgl. Pomp. D . 36 , 2, 22 pr., Ulp . D . 45 , 1 , 45, 3 und die vielen Fälle in VIR I 1110 f. S . auch KÜBLER , ZSSt 28 , 193. (21) Vgl. u . N . 29. (22) Was PS 1, 11 , 1 für die hereditatis petitio ausspricht (LENEL, Ed.3 138), überträgt die IP auf zwei ganz andere Prozesse: a) die querela inofficiosi testamenti ; darauf gehen die Worte ex defuncti voluntate (CONRAT, Paulus 201 ff), vgl. dazu ZSSl 49, 242 11. 7 ; b) die Klage des Nacherbprätendenten gegen den unter Auferlegung einer Nacherbfolge die Erbschalt als Vorerbe Besitzenden (quicumque... testamenti condicione possideat) auf Herausgabe. CONRAT 202 hält es defuncti voluntate aut lestamenti condicione für ein Ev dià dvoīv . 36 Ernst Levy dieses Besondere besagt condicio unter Umständen sogar ohne jeden Zusatz. So erklärt sich eine vielversuchte , bisher als hoffnungslos geltende Paulussentenz (4, 13 , 1) oder vielmehr die Interpretation , die jene Sentenz verdrängt hat (23). Am deutlichsten aber wird das an der Stelle , die das substituere pure vel sub condicione erläu tern will. Paulus (Sent. 3, 4 b , 5 ) bemerkte hier lediglich, dass man unbedingt oder bedingt substituieren könne, bedingt also etwa so , dass B nur Erbe werden soll, wenn A es nicht geworden und B zur Zeit der Delation schon pubes ist. Für die Interpretatio (3 , 6 , 11) dagegen ist der Substitut sine condicione ein erster Nacherbe ohne einen zweiten (hoc est ut, cum ad substitutum hereditas perve nerit, ad tertium heredem non debeat pervenire), der Substitut sub condicione ein Nacherbe, dem später ein weiterer Nacherbe folgt. Als Zeitpunkt der Folge gilt im Zweifel der Tod des Vorerben (3, 6, 11 ; INMc 5 ). Die neuartige Deutung dieser Dinge zieht noch andere Kon sequenzen . Die merkwürdige Begründung, die IP 3 , 8 , 4 für die Unzulässigkeit der Beschwerung eines Erbeserben gibt (24), lässt darauf schliessen, dass der Nacherbe als solcher beschwert werden konnte. – Aus der cautio pro praede litis et vindiciarum , die der (23 ) Pro condicione enim hoc loco emancipatio videtur adscripla : « hier dürfte die Einanzipation anstatt der (normalen ) Anordnung einer Substitution ( = Nach erbfolge ) gevannt sein » . Anstelle des erstrebten Zweckes (Ausfolgung des Nachlasses an die Kinder ) ist das zu seiner Erreichung notwendige Mittel (de ren Emanzipation ) dem (Vor)erben auferlegt. In Wahrheit ist beides gewollt und also beides zu erzwingen . Wie Paulus selbst, ausgehend von einer Erbein setzung unter der condicio : si liberos suos emancipaverit den weiteren Fall einer unbedingten Erbeinsetzung mit der Weisung ut... emanciparet beurteilt haben wird , lässt sich aus dem von Ulp . D . 35, 1, 92 i. f. mitgeteilten Reskript des Severus vielleicht erschliessen . Die Interpretatio aber, der die condicio von vornherein nichts anderes als ein rogare war, konnte sich kürzer fassen : die « adskribierte » condicio emancipationis wird in die nicht « adskribierte » con dicio nat' gozýv, die Nacherbeinsetzung , umgedeutet. Die Verwendung von con dicio in solch doppeltem Sinne und das Wort omnimodis (statt omnimodo ) sind bestätigende äussere Anzeichen dafür, dass die Interpr. sich hier an die Stelle der Sentenz gesetzt hat. Dass Paulus so nicht geschrieben haben kann , ist heute einstimmige Meinung , so weit auch die Ansichten über den spätklassischen Stand der Frage auseinandergehen : s. etwa MITTEIS , Röm . Priv . R . I 167 11. 1 ; 195 n . 3, SOLAZZI, Arch. giur. 86, 178 ff., 188 ff. (vgl. STEINWENTER , ZSSt 49, 659), BONFANTE, Corso I 66, LAURIA , Annal. Macer. 6 (1930 ) 75 ff. (24) quia ille qui heres relinquitur quem sit heredem habiturus incertum est. Zum Wesen des weströmischen Vulgarrechtes bedingt Eingesetzte für den Fall des Bedingungsausfalles bei Er bittung der bonorum possessio dem Substituten zu leisten hat (PS 5 , 9, 1) (25 ), wird eine Sicherheitsleistung des Vorerben an den Nacherben, wie sie unter gewissen Voraussetzungen auch das deut sche BGB (S 2128) kennt: der Nacherbe kann den , qui sub condi cione heres institutus est, adita hereditate zur Kaution zwingen ( IP 5 , 10 , 1) (26 ), nach Antritt der Erbschaft, d. h . nach Eintritt eines Ereignisses, das den klassischen substitutus für alle Zeit aus geschlossen hätte. Der Institutus, obwohl sub condicione, tritt trotz dem die Erbschaft an : er wird Erbe, unbedingter Vorerbe. Auch die Interpretatio zu einer Novelle des oströmischen Kaisers Marcian (INMc 5 i. f.) meint deutlich eine Nacherbfolge, wenn sie gewissen gottgeweihten Frauen freie Hand gibt, si voluerint heredibus suis quoscumque post eorum obitum substituere. Die Novelle selbst, ein Gesetz von 455 = CJ 1 , 2 , 13) weiss davon nichts: sie be schränkt sich darauf, die letztwillige Bestimmung für wirksam zu erklären , sive hoc institutione sive substitutione seu legato aut fidei- commisso per universitatem seu specialibus... fuerit derelictum , und versteht so die Substitution durchaus in ihrem ursprünglichen Sinne. Auch das Corpus iuris bewegt sich hier wie bei der Fixie rung des condicio -Begriffes im wesentlichen noch auf klassischen Bahnen (27). Vom Osten ist mithin die geschilderte Umformung nicht aus gegangen . Ebenso wenig kann sie von germanischen Anschauungen beeinflusst sein . Woher also kommt sie ? Sollten die weströmischen Juristen von sich aus schöpferisch eine Fortentwicklung verwirk (25 ) LENEL , Ed.3 520 f., 525 ff und ZS $t 49, 17 f. (26) Ggs.: Kaution im Prozess zwischen Vor- und Nacherben (aufgrund der Behauptung des Eintritts des Nacherbfalles). Von dieser Kaution handelt IP 1, Il, 2 (ob . n . 22 ). (27 ) Allerdings heisst es in C . 6 , 45 , 1 (211) : In legatis quidem el fideicommis sis etiam modus adscriptus pro condicione observatur . Die Behandlung der Auflage als Bedingung würde sich vom klassischen Recht ebensoweit entfernen wie die weströmische Behandlung der Bedingung als Auflage. ·Gewiss sind die Worte nicht echt (PERNICE, Labeo III 18 1 . 1, 298 n . 4 ; HAYMANN, Schenkung unter einer Auflage 87 n. 1, MITTEIS , Röm . Priv . R. I 194 n. 1, P. KRÜGER , 3dSt), aber auch ihr späterer Autor wird sie nicht so gemeint haben, dass sie zu der folgenden Nutzanwendung (retineas) gar nicht stimmen (vgl. SAVIGNY, System III 231 n. g ). Sollte er das pro condicione nicht bloss ungeschickt gestellt haben ? Zieht man es zu adscriptus, so bekommt das Glossem einen Sinn . 38 Ernst Levy licht haben, wie sie im Gebiet des Gemeinen Rechtes erst mit dem Beginn dieses Jahrhunderts erreicht worden ist ? Das ist schwerlich anzunehmen . Sie verkünden ihre Lehre nirgends als offizielle Re form , sondern als blosse Auslegung des Bestehenden ; sie machen keinen Versuch , die neue Regelung mit dem harmlos übernomme nen Universalfideikommiss ( 28 ) in irgend eine Beziehung zu brin gen ; sie bemerken nicht einmal, dass die Epitome des Gaius, in soweit der Vorlage getreu , eine Nacherbfolge apodiktisch für un zulässig erklärt (2, 4, 3 ; 2, 7, 8 i. f., vgl. Gai. II 1S4. 277) (29 ), und kompromittieren sich offen durch den Missbrauch des Terminus scripti für die in dritter Reihe Berufenen. Das alles spricht nicht für bewusste Neuerung. Die Aenderungen im Erbrecht sind ja auch nur im engsten Zusammenhang damit zu verstehen , dass der Be dingungsbegriff verloren ging. Sie sind blosse Konsequenzen dieser Einbusse. Der Ausgangspunkt steht auf dem Verlustkonto . Wer dem Breviar entnimmt, was quantitativ und qualitativ aus dem Obligationenrecht, dem Juwel im römischen System , geworden ist, wie flüchtig und unzureichend die wenigen Regeln über den Kauf sind, die man der Aufnahme für würdig fand, der kann sich von dem Niedergang des Handels und Verkehrs, mehr noch des juri stischen Niveaus eine Vorstellung machen . Solchem Niveau eignet instinktiv eine Abneigung gegen feinere Fragen und kompliziertere Verhältnisse. Also auch eine Abneigung gegen Schwebezustände, wie sie mit einem bedingten Geschäft verknüpft sind. Sie tunlichst zu meiden , scheinen jene Juristen bewusst oder halbbewusst be strebt gewesen zu sein. Dieses Streben stand in erster Reihe. Se kundär sind alle die Momente, die seine Durchführung erleichterten oder Anknüpfungen boten . So bei der Ueberführung der Bedin gung in die Auflage : die Vielwendigkeit der klassischen condicio oder der Wegfall des Augenmasses für den Unterschied zwischen ( 28 ) IP 4 , 2 . 3. (29) Entsprechend erscheint die substitutio vulgaris dort (2, 4, 1) noch in rechlich, aber anderlicio in 2,9, 90windort (2, 4,1) klassischer Auffassung . Auch die condicio in 2, 9, 9 wäre mit dem überkom menen Begriff verträglich. Aber anderwärts fühlt man hier doch schon ein Ab gleiten ins Vulgarrechtliche : 2 , 3 , 4 und 2 , 9, 6 denken nur mehr an die po testative condicio (s . ob. S . 34), 2 , 9, 2 pimit den Terminus untechnisch (s. ob . S . 32), und 2 , 7, 8 init. bezeichnet die Anordnung eines Fideikommisses gera denwegs als condicio testamenti (vgl. ob . N . 21). Die Frage wirft also ein be zeichnendes Licht auf die Zwitterstellung der Epitome. Zum Wesen des weströmischen Vulgarrechtes dem Nichteintritt einer Rechtswirkung und ihrem nachträglichen Wegfall. Bei der Wandlung der Substitution in die Nacherbfolge des weiteren : die Vacillationen zwischen ' si ' und ' cum ' in den juristischen Schriften , das Phänomen der Pupillarsubstitution und vor allem die Tatsache, dass das Dogma Semel heres semper heres kei nen Eindruck mehrmachte . Die problematischen Gründe, die dieses Dogma einst schufen, oder begriffsinässige Erwägungen etwa der Art, wie sie bis ins 19. und 20 . Jhd. hinein immer wieder auftau chen (30 ), verursachten unseren schlichten Rechtshandwerkern wenig Beschwer. Wo das Dogma fehlt, stellt sich schnell die Nacherbein setzung ein. Das bestätigen die Anwendungsfälle in den Papyri (31), die sich im Reichsrecht nicht durchzusetzen vermochten . - Aehnlicher Auflösung verfiel eines der eindrucksvollsten Wahr zeichen des klassischen Denkgebäudes : die Trennung des verpflich tenden Rechtsgeschäftes von dem Uebereignungsakt. Nicht als ob es nun unmöglich geworden wäre, durch schriftliche Stipulation oder Verbürgung oder Dosversprechen eine Verbindlichkeit einzu gehen mit der Wirkung, dass aus ihr auf die schuldige Leistung geklagt werden konnte. Schon die Zeitspanne, die in diesen Fällen normalerweise bis zur Erfüllung verstreicht, zwang hier zur Beach tung des Abstandes. Kauf und Schenkung hingegen sinken wieder in den einstigen Status eines Bargeschäftes zurück : sie sind nicht mehr bloss die causa für künftige Rechtsübertragung, sondern be wirken diese selbst. Gaius berichtet (II 87), dass uns erworben wird , was unsere Gewaltunterworfenen mancipio accipiunt vel ex traditione nanciscuntur sive quid stipulentur vel ex aliqualibet causa adquirunt (32 ), die Epitome (2, 1 , 7 ) macht daraus: quidquid his... donatum vel venditum fuerit. Das Eigentum wird donationibus vel emptionibus vel quibuslibet aliis contractibus auf den anderen über tragen (33 ). In diesem Sinne werden vendere und donare als alie (30 ) Motive zu dem Entwurf eines BGB V (1888) 80 , KIPP, Erbrecht8 (1930 ) $ 92, II. (31) KÜBLER, ZSSI 28 , 175 ; 29, 186 ff, RABEL, Grdz. 539 N . 1, KRELLER , Erbrechil . Untersuchungen 358 f, vgl. aucb 381 f, TAUBENSCHLAG , Studi Bon fante 1, 393 N . 152. (32) Entsprechend – natürlich abgesehen von der Manzipation – noch D . 41, 1 10, 1. (33) CT 4 , 5 , 1 (331) ; vgl. auch IT ; quidquid lali et tam sollemni donatione ad ius dominiumque sponsae transierit ; IT 3, 5 , 2 ; emptionis, hereditatis, dona. Ernst Levy nare zusammengefasst (34 ) oder mit manumittere auf gleiche Stufe gestellt (35 ), entsprechend das venire und donari von res litigiosae für unwirksam erklärt ( 36 ). Vom Schuldner, der durch lex commis soria den Verfall des Pfandes bedingt einräumt, heisst es einmal: vendere promittit (37 ). Wie hier und anderwärts vendere das ding liche Geschäft in sich einbezieht (38 ), so tritt umgekehrt das emere weithin vor comparare zurück. Gewiss steht comparare , wo es auf die Anschaffung nur im allgemeinen ankommt, auch in klas sischem Gebrauch bisweilen abwechselnd mit emere (39), aber ganz vorwiegend und technisch erscheint es, wie adquirere, im Hinblick etwa auf die dingliche Rechtslage, die actio Publiciana oder auf Surrogationsfragen (40); hier und da werden comparare oder purare dem schuldrechtlichen emere geradezu gegenübergestellt (41). Davon weiss schon Konstantin nichts mehr und erst recht nicht die In terpretatio : ihr ist comparare zwar nicht das ausschliessliche, aber doch das normale Gegenstück zum vendere (42 ), und so dringt es neben und anstelle des emere auch in spezifisch kaufrechtliche Pro bleme z . B . die Sachmängelhaftung (43) oder die laesio enormis (44 ) tionis... et ceterarum rerum similium , quae per legitimas scripturas atque con tractus ad uniuscuiusque dominium transire noscuntur : IP 5 , 2 , 4 ; quolibet pacto acquisierit: IP 1 , 7, 5 . (34) IT 8, 18, 1, vgl. auch INV 35 (Zeile 196 ff). (35) ET 120. (36 ) RB 35 , 4 . (37 ) IT 3 , 2, 1. ( 38 ) Venditionem vero ex hoc maxime ius firmitatis accipere, si traditione celebrata possessio fuerit subsecula ; RB 34, 2 . Vgl. auch IP 2 , 12, 6 i, f. : vendat statt tradat. (39) So etwa Gai. IV 27 i. f., Papir , Just. D . 18, 1, 71 (Reskript), Ulp . D . 40, 1, 4 passim , Ulp . D . 27, 9, 3 pr. (echt? vgl. BESELER , Beitr. IV 141). (40) VIR I 836 f. (41) Vgl. vor allem D . 32 , 47, 1 (auch wenn nicht ganz in Ordnung), Paul. I). eod . 78, 6 , s. auch 47 pr. ; [Paul. ] sent. in Coll. 14, 2, 1 ; ferner [Paul. ] sent. in D . 49, 14 , 45, 10 (ad comparandam pecuniani) . (42) z . B . IT 3, 1, 2 (auch schon CT); IT eod. 3 ; 3, 2, 1 ; 8 , 18 , 1 ; INV 32 ; vgl. auch ET 101, Lex Bajuv . 16 , 2. (43) In (Paul. ] sent. 2, 17, 11 spricht der Sentenzenverfasser. Vorbild war offenbar (so auch LAURIA , Ann. Macer . 6 , 38 ) das in Paul, D. 21, 1, 58 pr.mit geteilte Responsum . (44 ) IT 3, 1, 1 (gegenüber CT ). Zum Wesen des weströmischen Vulgarrechtes 41 vor. Ein zäheres Leben hat der emptor, doch taucht zugleich erst mals der comparator auf (45 ). Wie hätte man sorgsam gehütete Termini so heillos durch einander mengen können, wenn die Begriffe selbst intakt geblieben wären ? Bereits Konstantin kennt, wohlhellenistischer Einstellung (46) folgend , nur noch ein einheitliches, die Kaufbestimmungen fixie rendes und gleichzeitig den Eigentumswechsel vollziehendes Ge schäft. Der bekannte Erlass FV 35 (47), der zwecks eindeutiger Feststellung des Grundsteuerschuldners eine Neuordnung des pri vatrechtlichen Liegenschaftsverkehrs in der Richtung vornimmt, dass er, um die Veräusserung durch Nichtberechtigte zu vereiteln , Einsicht in die Steuerliste und öffentlichen Abschluss vor den als Eigentumszeugen zuzuziehenden Nachbarn vorschreibt, spricht we der bloss vom Kauf (48 ) noch bloss von der Uebereignung (49). Anschauung und Ausdruck gehen fortwährend durcheinander. Der unter die neue Form gestellte Akt ist mit klassischem Rüstzeug nicht zu begreifen . Er verschafft mit einem Schlage dem Käufer das Eigentum (50 ), dem Verkäufer das Geld, und jedem Teil geht das Empfangene an den Fiskus verloren, wenn die Form nicht beachtet ist (51). Diesen Erlass (52) und seinen ganzen unrömi schen Standpunkt hat später Justinian zu verwerfen die Kraft ge habt (53), aber nicht das Westrecht. In der Interpretatio des in den C . Theod. übergegangenen Auszugs (3 , 1, 2) wird er sogar – infolge eines sprachlichen Missverständnisses (54 ) - auch de mediocribus (45 ) Vgl. die Indices, s. auch SECKEL -KÜBLER zu PS 2 , 17, 14. ( 46 ) Zu ihr ARANGIO Ruiz, Istit.? 187 ff und Lineamenti del sistema contrat tuale 25 f ; zu FV 35 insbes. : Partsch , Freiburger Festschrift für Lenel 90 f ; SCHÖNBAUER, Liegenschaftsrecht 133; Rabel, ZSSC 45, 521. – Vgl. auch TAUBEN SCHLAG , Studi Bonfante I 439 n . 547. (47) Ausfertigung (von 342 ?) des verkürzt in CT 3, 1 , 2 wiedergegebenen Gesetzes von 337. Das ist wohl die wahrscheinlichste Datierung : MOMMSEN zu FV 35 , SEECK, Regesten 184 . 191, BONFANTE, Scr. II 311 N . 1. (48) Ihn allein erwähnt Mitteis, Reichsrecht 550 f. (49) Sie allein erwähnt BONFANTE , Scritti II 310 ff. (50) Possessio in diesem der Spätzeit eigentümlichen Sinn . (51) S 3 MOMMSEN , S 4 SECKEL-KÜBLER . (52) Veber seine Weiterwirkung s. auch EHRHARDT, ZSSt 51, 170 ff. (53) Nur ein winziger Rest fand in CJ 4 , 47, 2 i. f. Zuflucht. (54) Scamnum ist im § 4 (5 ) der « Landstreifen » nicht die « Bank » . Ein früher Glossator (vielleicht der Sammler der Fragm . Vatic .?), der nur noch die Roma · II Ernst Levy rebus für anwendbar erklärt und damit auf bewegliche Sachen er streckt. Aber auch wenn man mit der Formalisierung des alltägli chen Bagatellkaufes nicht Ernst machen konnte und für seine Wirksamkeit die Zahlung genügen liess ( IP 2 , 18, 10; CE 286 ), so bezieht sich doch dieses nicht minder neuartige Erfordernis ebenfalls ohne Zweifel auf den Simultanakt, der Kauf und Ueber eignung in sich verschmilzt oder besser) nicht scheidet. Nur im Hinblick auf ihn sind diese Tatbestandsstücke (Zeugen - und Schrift form (55) wie Barzahlung) überhaupt erst zu verstehen (56 ). Das Eigentum erwirbt dabei nicht notwendig der als handelnd Auf tretende, sondern wer entweder durch die Kaufurkunde oder durch die Hingabe des Geldes als Erwerber legitimiert ist. Wenn solche Legitimation aber zu widerspruchsvollen Ergebnissen führt, etwa weil für A gekauft, doch von B gezahlt ist, dann und nur dann soll die Tradition den Ausschlag geben und also von rechtlicher Bedeutung sein (57). Unterblieb sie ausnahmsweise im Normalfalle, so war der Verkäufer zu ihr hinterher omnibus modis compellendus (IP 1, 13, 4 ), ohne dass man nach dem dinglichen oder obligato zweite Bedeutung kannte, glaubte zu erläutero , wenn er schrieb : subsellia vel , ut vulgo aiunt, scamna (MoMMSEN ad h . 1., Bonfante II 312 n . 1, 320). IT endlich lässt die scamna ganz fallen und verallgemeinert subsellia zu mediocres res. (55) Von ihr sprechen die beiden westgotischen Aeusserungen, aber noch nicht Konstantin , Anders PARTSCH 90 ; auch RiccoBONO, ZSS! 34, 168 ? (56 ) Z $ SI 49, 25 n . 6 a . E . ist also zu modifizieren . (57) Dies ergeben übereinstimmend die Interpretationen zu C Greg. 7 (Krü GER, Collectio III 229) und IP 2, 18 , 11. Duae res, cum quo fuerint, eius domi num faciuntmeliorem . D. h . entweder Parteibenennung in der Urkunde (le gitur !) + Tradition oder Zahlung + Tradition oder Parteibenennung + Zah lung. Iin ersten Fall erwirbt der Zahlende nicht bloss kein Eigentum , sondern ebensowenig Ansprüche aus dem Kauf, er ist auf die Rückforderung des Geldes angewiesen . Ueberall ist comparare das Kennwort ; zwischen Kauf und Uebereig nung wird nicht mehr geschieden . Ohne Belang sind nun die beiden Fragen : wer hat den Kaufvertrag geschlossen und so die insta causa in sich verwirk licht ? Wem ist tradiert worden ? Die neue Auschauung ist bereits in die inter pretierte Sentenz (2, 17 , 14 ) durch den si tamen - Satz eingedrungen (so schon SECKEL -KÜBLER ), der nach dem vorangegangenen comparatus est bei res nec man cipi überflüssig, bei res mancipi falsch ist. Im übrigen hat die Sentenz noch klassischen Inhalt. Nicht minder die Erlasse von 259 und 286 (C. Greg. 7, 1. 2). Die Interpretatio divergiert hier bezeichnend jedesmal so stark , dass man ge glaubt hat, sie beziehe « sich in beiden Fällen auf Texte, die in das westgoti sche Gesetz nicht aufgenommen sind ». - Vgl. zuin Vorstehenden Conrat, Pau lus 135 ff, PringSHEIM , Kauf mit fremdem Geld 98 f. 102 f. Zum Wesen des weströmischen Vulgarrechtes rischen Charakter der Klage noch fragte. Wesentlich für den Si multanakt sind formeller Abschluss oder Zahlung. Ihre alterna tive Rolle tritt sowohl im Breviar (IP 2, 18, 10 ) wie bei Eurich (286 ) scharf hervor. Warum die Zahlung , die von Konstantin einst mehr vorausgesetzt (FV 35 , 3 [4 ]) als vorgeschrieben worden war, jetzt plötzlich als eigenes und besonders beweisbedürftiges (58) Erfordernis auftaucht, ist vielleicht ganz rational zu erklären (59). Beim schriftlosen Geschäft war sie allein es, die Kauf und Schen kung zuverlässig auseinanderzuhalten ermöglichte (60). Also war auf ihren Beweis angewiesen , wer seinen Erwerb dartun wollte , ohne die viel umständlichere Schenkungsform beobachtet zu haben , die gleichfalls Konstantiv. (FV 249; vgl. CT 8, 12, 1) eingeführt hatte (61). Diese Form macht noch ein besonderes Wort nötig. Zur Wirk samkeit verlangt jede Schenkung Beurkundung (62) und Eintra gung in die Akten, ausserdem aber auch noch den Vollzug der corporalis traditio . Das sieht fast so aus, als sei hier in der Tat das Verfügungsgeschäft als solches betont und abgesondert. Aber der Schein trügt. Die Form gilt nicht minder für die donatio (58 ) Auch darin stimmen IP 2 , 18 , 10 und CE 286 überein. Die testes, die CE als Beweismittel für die Zahlung neben der Beurkundung des Sinultanaktes nennt, gehen wohl ebenso wie die der IT 3 , 1, 2 auf FV 35 , 4 [5 ] = CT 3, I, 2 zurück und wirken ihrerseits in dem aut per cartam aut per testes der Lex Bajuv. 16 , 2 und 15 weiter (Das letztere steht fest : ZEUMER, Neues Archiv 23, 436 , BRUNNER , Dt. Rechtsgesch . I 456 N . 11, v . SchWERIN , Notas [ZSSt 49, 231 N . 1] 19 ). Beeinflussung durch Konstantins Hellenismus dürfte hier näher liegen als selbständige Parallelerscheinung ; anders PARTSCH, Festschrift für Lenel 93 . (59) Anders noch ZsSt 49, 245 N . 6 ; dagegen auch Ehrhardt, ZSSt 51, 180 N . 1. (60) Besonders deutlich IP 2, 18 , 10 : si quocunque modo res vendita, dato et accepto pretio, qualibet probatione possit agnosci. (61) Für Liegenschaften wie für Fahrnis : FV 249, 7 = CT 8, 12, 1, 2. Nach BONFANTE, Scr . II 313 f und Corso II 2, 189 wäre der Erlass trotzdem aufGrund stücke beschränkt gewesen . Aber CT und IT 2, 29, 2 beweisen das nicht. Der dort behandelte Suffragien vertrag hebt sich durch diese seine causa gerade von der reinen Schenkung ab : schon das blosse Versprechen erzeugt Wirkungen (s , unten N . 67), und bei der Hingabe von Fahrnis traditio sola sufficiat. Nur für Grundstücke soll es bei der Schenkungsforin verbleiben . (62) Dagegen , m . E . nicht durchschlagend , neuerdings FERRARI, Studi Ric cobono I, 477 für Konstantin selbst (i. Ggs. zu IT 8 , 12, 1). Zu CJ 8 , 53, 29 vgl. Riccoboro, Mél. Girard II 459 n . 1, ZSSI 34 , 194 f. Ernst Levy - -- - ex aliquo notato tempore promissa (§ 3 ) (63). Anders ausgedrückt : das Schenkungsversprechen bleibt unverbindlich , solange es nicht vollzogen ist. Versprechen ohne Verfügung ist nicht unerfüllte Verpflichtung, sondern ein halber, unvollendeter Tatbestand. Das gerade ist es, wogegen Justinian – in Wiederherstellung des klassischen Zustandes (64) – sich wendet, ut non ex hoc inutilis sit donatio , quod res non traditae sunt, nec confirmetur ex traditione donatio (65 ); nach ihm hat der Donator sein Versprechen, wenn es als solches wirksam ist, obligationsgemäss durch Tradition zu er füllen (66 ). Der Westen aber bleibt wiederum bei dem Simultanakt des Konstantin stehen (67). Wird z. B . – so heisst es in der IP 5 , 12, 4 (68 ) – per legitimas scripturas dieselbe Sache zuerst dem A und dann dem B geschenkt, so ist die zeitliche Reihenfolge ohne Belang ; es kommt nur auf die Tradition an . Wer also — wird man folgern dürfen – nicht tradiert erhält, hat nicht bloss kein Eigentum , sondern ebenso wenig ein Forderungsrecht: der schrift liche Teiltatbestand zeitigt keine Wirkung . Die Frage nach dem Ursprung des beim Kauf wie bei der Schen kung alle Gegensätzlichkeiten von Verpflichtung und Verfügung überdeckenden einheitlichen Geschäftes ist nicht so einfach zu lö sen, wie der erste Blick glauben machen möchte. Die beiden grossen Erlasse vom Beginn des Dominats (FV 35 und 249) bilden ganz zweifelsfrei den Wendepunkt, und dass sie in der Missachtung der (63) In qua - erläutert dies die IT 8, 12 , 1 - sibi donator certum tempus possessionis ( = proprietatis ) reservat. Abweichend FERRARI 467. (64) Der freilich , ungehemmt durch die lex Cincia , nur zwischen personae exceptae praktisch wurde: vgl. etwa Mitteis, ZSSt 33, 198, JÖRS, Röm . Priv . R . 170 . Anders, aber nicht ohne Missverständnis, FERRARI, 473 tf. (65) CJ 8 , 53, 35 , 5 ff, vgl. auch Inst. 2 , 7 , 2. (66 ) Richtig Ferrari 472 f. (67) Daswird weniger abgeschwächt als bekräftigt,wenn beim Aemterhandel (suffragium ) schon das blosse Versprechen des Bewerbers (im Ggs. zu soforti ger Hingabe von beweglichem oder unbeweglichem Gut) verbindliche Wirkung hat (CT 2 , 29 pr. i. Ggs. zu SS 1 . 2 ). Diese Verbindlichkeit tritt nämlich nur ein, wenn der Bewerber seinerseits das erstrebte Ziel erreicht hat (cum ea quae optaverint consequantur), also nach Art eines Realvertrages. Wo es wie bei der reinen Schenkung an einer solchen Gegenleistung fehlt, da gibt es auch keine Haftung aus dem Versprechen . (68 ) Während PS (5 , 11, 4 ) nur an die Perfektion gemäss der Lex Cincia denkt. Zum Wesen des weströmischen Vulgarrechtes 45 römischen Kategorien mit dem hellenistischen Volksrecht überein stimmen, ist sicher; dass sie von ihm auch beeinflusst sind , nicht unwahrscheinlich. Und doch wäre es vorschnell, aus diesem Sach verhalt auf eine Rezeption griechischen Rechtsgutes im Westen zu schliessen . Es ist nicht bloss Rezeptionsbereitschaft, was da zum Ausdruck kommt, und mindestens ist diese Bereitschaft nicht der letzte Grund. Auch von sich aus lagen jene Kategorien dem pri mitiven und volkstümlichen Denken (69) fern, nichtminder fern als das Verständnis für die condicio . Halbverstehend und darum miss trauisch geworden , schliesslich vielleicht geradezu in bewusster Widersetzlichkeit las man über die Abstufungen der mit leuchten der Klarheit geschriebenen klassischen Vorlagen einfach hinweg. Man forderte von ihnen den Geist, den man selbst begriff. – Aber die Einschätzung des historischen Ablaufes ist auch hier von der rechtspolitischen Wertung der Ergebnisse durchaus getrennt zu halten . Ein Vergleich der wichtigsten heutigen Systeme lässt leicht erkennen , dass die Ausbildung eines zum obligatorischen Geschäft hinzu tretenden Uebereignungsaktes keineswegs überall durchgeführt ist oder angestrebt wird. Diese wenigen Proben für die Denaturierung des römischen Rechtes müssen hier hinreichen. Wir haben sie grösstenteils aus dem Breviar entnommen . Und dabei vorerst die für die Methode grundlegende Frage beiseitegelassen , ob denn aus dem Breviar das westgotische Recht, wie es um 500 wirklich galt, ohne weiteres abgelesen werden darf. Die Frage stellen heisst sie verneinen. Wie die Digesten auf weiten Strecken nicht die Anschauungen reprä sentieren , die ein frei schaffender Jurist am Hofe Justinians nie dergeschrieben hätte , so steht im Breviar Altes und Neues, Totes und Lebendes auf engem Raume nebeneinander. Wie sollte das auch anders sein ? Rein äusserlich schon sind die aufgenommenen Sentenzen und Konstitutionen von den sie begleitenden Interpre tationen und erst recht von den Tagen des Westgotenkönigs um gewaltige Zeiträume, zuweilen um 2 bis 3 Jahrhunderte getrennt, he jetzt-17 MEYER, ZSS .GERKE, De (69) Auch dem ältesten germanischen : vgl. etwa GIERKE, Dt. Privatr . III 435 , HÜBNER, Dt. Privatr . § 34, HERBERT MEYER, ZSSt (Germ . Abt.) 47, 202, PAPPENHEIM , ebenda 53, 73. (Siehe jetzt namentlich Rabel , ZSSt (Rom . Abt.) 54, 195 ff. ). 46 Ernst Levy und die Spannung wächst weiter, wenn man sich erinnert, dass in den Sentenzen selbst oder im Gaiusabschnitt vielfach noch früheres klassisches Erbe steckt. Sieht man von den Interpretationen ab , so enthält das Gesetzbuch kaum einen Satz , der nicht schon seiner seits aus einer sekundären Quelle - Sammlung oder Ueberarbei tung – geschöpft worden wäre : eine Kompilation aus Kompila tionen, ein tertiäres Gebilde, das als solches nicht römisch noch hellenistisch noch westgotisch ist und so weder nach Entstehungs ort oder Zeit noch nach seinem Charakter die Einheitlichkeit auf weist, die einer Kodifikation zu wünschen , aber auch für einen zuverlässigen Einblick in das damals praktische Vulgarrecht die Voraussetzung wäre. Der innere Ausdruck dessen ist das Gewimmel der Anti nomien . Antinomien sind Fluch und Stigma des Epigonentums. Schon die Sentenzen oder der Codex Theodosianus für sich allein geben davon Zeugnis. Um wieviel mehr das Corpus, das mittel mässige Kräfte aus disparatesten Werken zusammenfügten. Nach den Sentenzen (5, 24 , 1) werden die parricidae, die antea insuti culleo in mare praecipitabantur, hodie vivi verbrannt, und dieser Satz interpretatione non eget, obwohl nach dem C . Theod . und seiner Interpretatio (9 , 15 , 1 ) umgekehrt die Feuerstrafe abgeschafft ist und der Vatermörder insutus culleo... in vicinum mure... proiciutur. Auf der Münzfälschung steht bald Deportation (PS 5 , 25 , 1), bald die Todesstrafe (CT und IT 9 , 21, 5 ; 9 , 22, 1). Die mortis causa donatio wird das eine mal als unbedingte Schenkung mit bedingter Rückleistungsabrede definiert (PS 3, 7, 1. 2), das andere mal als bis zum Tode des Schenkers aufgeschobene Schenkung (IT 8 , 12 , 1 Satz 3, vgl. CE 308 ) (70). Die inofficiosa donatio ist bald nichtig (IT 8 , 12 , 1 Satz 9 ) (71), bald führt sie nur zur Pflichtteilsergän zung ( IG 8 , 2 , vgl. auch IP 4, 5 , 7) (72). Oder, um an vorhin (73) Gesagtes anzuknüpfen : Der Gaiusauszug verharrt beim Semel heres semper heres, die Interpretatio kennt die Nacherbfolge. Die Sen tenzen gehen von der klassischen condicio aus (74 ), die Interpretatio ( 70 ) Zum Reurecht des Schenkers (in beiden Versionen) ZSS! 49, 256 n. 5 . (71) Quae tamen omnes donationes ... Zu dem Sinn dieses Satzesauch CONRAT, Brev. Alar. 411 und Paulus 142 n . 399. (72) Harmonisierend Vassalli; Misc. crit. III 53 n. 2. (73) n . 29. (74 ) 2, 3, 1 i. f. ; 3, 4b, 1. 2 . 5 ; 5 , 9, 1 . Zum Wesen des weströmischen Vulgarrechtes 47 legt sie sich als Auflage zurecht, und der Gaiusauszug schwankt zwischen beidem . Der Auszug bleibt seiner Vorlage treu , wenn er den Kauf als konsensualen Schuldbegründungsvertrag schildert , dessen Verbindlichkeit von der Zahlung nicht abhängt (75 ) ; in den Konstitutionen und Interpretationen dagegen sind Kauf und Ue bereignung verschmolzen , und der Zahlung ist eine entscheidende Funktion eingeräumt. Die Beispiele liessen sich beliebig vermehren , ja verhundertfachen , wenn man zu den krassen Widersprüchen die blossen Unstimmigkeiten in Haltung und Ausdruck fügt. Gibt es doch in weiten Gebieten kaum eine Interpretatio, die den Geist des zu Interpretierenden wirklich spiegelte. Unter solchen Umständen gewinnt im Breviar die sog. höhere Quellenkritik eine ausschlaggebende Bedeutung. Keine seiner Nor men ist für das Vulgarrecht verwertbar, wenn nicht gewürdigt wird , zu welchem Teilkomplex sie gehört. Je älter der Stamm des einzelnen Teilkomplexes ist, um so weniger fällt er ins Gewicht. Wie alt er ist, lässt sich einigermassen genau bei den Leges be ziffern , die ja regelmässig mit ihrem Datum aufgenommen sind und von den Severen des Jahres 205 (CG 4 , 11) bis zum Severus von 463 reichen (Nov. Sev. 1 ). Die Entstehungszeit des Jus da gegen ist nur ganz ungefähr festzulegen. Drei Gruppen sind je denfalls zu unterscheiden. Der Sentenzenblock gehört etwa an das Ende des 3 . Jhds. (76 ), der Gaiusblock vielleicht an das Ende des 4 . Jhds. (77), der Interpretationenblock in das 5. Jhd. Ein so all gemeiner Zeitansatz ist freilich nur für den jeweiligen Grundstock haltbar und schliesst verwickeltere Schichtungen nicht aus. Bald birgt eine Sentenz jüngere Bestandteile (78), bald überrascht die Interpretatio durch klassizistische Methode und Diktion (79). Denn jeder der drei Blöcke hat eine Entwicklung durchgemacht, die , von dem Zeitpunkt seiner Entstehung aus gemessen , nach rückwärts und nach vorwärts weist : Gaius und Alarich sind die äussersten (75 ) GE 2, 9, insbes. SS 13. 14 . (76 ) ZsSt 50, 293. (77) Vgl. einstweilen Hirzig , ZSSC 14, 214 ff, auch wenn seiner Methode nicht überall zu folgen ist (s. auch P. Krüger, Gesch . 356 n. 40, Kübler, RE VII 504 ). Näheres anderswo. - 3 (78 ) So z . B . I, 13 b , 4 (dazu ZSSC 49, 242 n . 7) ; 2 , 8 , 3 ; 2, 11 , 4 i. f. ; 2, 17, 14 i. f. (ob. n. 57); 2, 26 , 7 (dazu ZSS! 49, 249 0 . 1), 5, 37, 1 i. f. (79) Vorläufiges bei Fitting , ZRG 11, 230 ff., Hitzig 220 , P. KRÜGER 354. Ernst Levy Pole . Gerade der älteste Block ist Nachträgen und Abänderungen naturgemäss am leichtesten ausgesetzt gewesen, ja bisweilen hat eine Interpretatio auf ihre Sentenz übergegriffen , sie verdrängend oder erweiternd (80). Das vorgeschlagene zeitliche Schema verträgt und erwartet also Korrekturen von der Einzelexegese . Es ist darum aber nicht nutzlos. Die Zugehörigkeit eines Ausspruchs z. B . zur Interpretatio des Theodosianus oder des Paulus besagt von vorn herein viel mehr als in ihrer Art die Zugehörigkeit einer Dige stenstelle etwa zum Ediktskommentar Ulpians, in dessen Bereich verschiedene Weltalter ihren Kampf ausgetragen haben. Sie be gründet sofort eine gewisse Vermutung dafür, dass der Ausspruch dem Rechtsbewusstsein des 5. Jhds. entspricht oder nahesteht; sein Erkenntniswert wird im Zweifel den eines abweichenden Stückes aus dem Gaius- oder gar aus dem Sentenzenblock beträchtlich über ragen . Nur darf man den allgemeinen Vorbehalt nicht vergessen, zu dem das tiefe Niveau der ganzen Gesetzgebung zwingt. Ein mit so geringer Befähigung arbeitendes Geschlecht verdient als Stimme des eigenen Volkes und der eigenen Epoche nur begrenztes Ver trauen , in Schweigen wie im Reden . Schweigt das Breviar, so bleibt es prima facie ganz offen , ob dem ein bewusster Willensakt zugrunde liegt oder Mangelan Geistesgegenwart. Im letzteren Sinne wird man es würdigen , wenn sich keine Vorschrift darüber findet, dass der bei Nacht oder bewaffnet bei Tage auf handhafter Tat ergriffene Dieb im Wege der Selbsthilfe getötet werden darf, wiewohl dieser römische und anderweit auch für die Sentenzen (5 , 23 , 9 ex Coll.) nachzuweisende Satz, wie zwei Antiquae der Lex Visigotorum (7 , 2 , 15 . 16 ) bezeugen , im Codex Euricianus enthalten war (81). Dagegen führt beim SC Claudianum über die Verskla vung der in unerlaubte Geschlechtsgemeinschaft getretenen Freien die gleiche Quellenlage (Cod . Eur. ex L . Visig . 3 , 2 , 3 . 4) zu dem umgekehrten Schlusse : sowohl von den Sentenzen (2 , 21 a ) wie vom Theodosianus nebst Interpretatio (4 , 12) war der Senatsbeschluss in eigenen Titeln auffällig und ausführlich behandelt : wenn ihn trotz (80) Beispiele : PS 4 , 13, 1 (ob. n. 23 ) ; 5, 4, 15 zweite Hälfte (Cujaz und , ihm folgend, die Ausgaben). – Für das Westrecht ausserhalb des Breviars vgl. P . KRÜGER 353 f. ; 359 n . 62; 360 n. 70 . . (81) ZEUMER, Neues Archiv 23 , 457 f. Zum Wesen des weströmischen Vulgarrechtes dem alle drei Leges Barbarorum übergehen , so werden sie ihn haben beseitigen wollen , wohl aus ähnlichen Erwägungen , mit de nen bald nachher Justinian (C . 7, 24 ) die Aufhebung rechtfertigt (82). Aber auch wo ein Satz ausdrücklich in der Interpretatio ent halten ist, erwachsen aus deren Charakter heraus Bedenken. Sie hatte zunächst nur die Aufgabe, eine ältere Bestimmung zu erläu tern . Wer bürgt dafür, dass sie inzwischen etwa eingetretenen Wandlungen nachträglich angepasst worden ist? Nicht häufig wer den wir das zu beantworten vermögen. Mitunter aber kommt von aussen her Hilfe , aus Urkunden (83) oder dem Euricianus. Die In terpretatio ( IP 2 , 24 , 2 . 5 ; IT 3 , 13 , 3 ) folgt den Sentenzen darin , dass sie die Schenkung unter Ehegatten als nichtig erachtet (84). Eurich dagegen (CE 307. 319) erklärt sie ausdrücklich für gültig. Die Ueberschreitung des Zinsmaximums begründet nach einem Ge setz von 386 (CT 2, 33, 2) und seiner IT die Pflicht zur vierfachen Erstattung des zu viel empfangenen Zinses, nach Eurich hingegen (CE 285 ) die Nichtigkeit des ganzen Darlehens. Was ist davon rechtens im Jahre 506 ? Nicht das Gesetzbuch von 506 sagt es uns, sondern das um ein Menschenalter frühere. Vom Codex Euricianus ist unmittelbar ja leider nur ein kleiner und stark verstümmelter Teil erhalten. Ein grösserer, wenn auch überarbeiteter Teil ist durch geduldige Einzelanalyse aus der Lex Visigothorum hypothetisch zu gewinnen, doch seit den richtung gebenden Anfängen von Karl Zeumer (85 ) ruht diese Aufgabe. Ihre Fortführung wäre dringend zu wünschen : zur Klarstellung des ältesten Wahrzeichens germanischer Gesetzgebung wie zur genau eren Erkundung der ersten Rezeption des römischen Rechts im Westen. Gewiss ist der Codex keine originale Schöpfung hohen Ranges : er sucht Kompromisse zwischen römischem und germa nischem Denken und lehnt sich mehr aus Not als aus Wahl in Geist und Sprache an die juristische Ueberlieferung an. Aber er gestaltet doch nicht selten nach freier Entschliessung, und durch (82) ZEUMER 455 ff. (83) Auch die Urkundenpraxis schleppt freilich oft genug überlebte Wen dungen mit. Ein weiteres Beispiel dafür bietet jetzt LEICHT, Riv . di storia del dir. ital. 5 (1932) 19 ff. - (84) So auch jene einzige Papinianstelle des Breviars (SECKEL-KÜBLER 1 429). (85 ) ZEUMER, Neues Archiv , Band 23. 24. 26 . Ernst Levy gängig spricht er nicht durch den verblichenen Mund von Toten , sondern aus sich selber, in eigener Gliederung und eigener For mulierung. Schon darum allein gibt es keinen untrüglicheren Zeu gen für das lebendige Westrecht des ausgehenden 5 . Jhds. Wenig will es besagen , dass er für die Goten erlassen war und nicht für die Römer. Denn von der römischen Herkunft und Ausbildung seiner Verfasser legt jede seiner Vorschriften Beweis ab (86 ). Und dies nicht nur durch das Was und Wie des bewäl tigten Stoffes, sondern ebenso sehr durch seinen Aufbau. Es kann gar kein Zweifel sein , dass das Gesetzbuch des Eurich im Prinzip weithin dem römischen Ediktssystem gefolgt ist, und zwar, wie begreiflich, in der Formung, die dem System im 5 . Jhd . eigen geworden war. Sowohl die Sentenzen (87) wie der Codex Theodo sianus (88) beruhen in den entsprechenden Abschnitten auf dem Ediktssystem , aber der Codex zeigt eine von der klassischen schon entferntere Anordnung ; gerade ihr steht Eurich nahe (89). Der Pariser Palimpsest beginnt mit den Fragmenten 274 - 277 inmitten des Abschnittes finium regundorum , also bei CT 2, 26 (vgl. PS 1 , 16). Die folgenden fr. 278 - 285 de commendatis vel commodatis ent sprechen den Ediktsrubriken de rebus creditis (XVII) und über die adjektizische Haftung (XVIII) in spätzeitlicher Ausgestaltung (90), ähnlich wie CT 2 , 27 - 33 (vgl. PS 2 , 1 -14 ) ; adjektizische Haftung und Zinsmaximum beschliessen hier (CE 283 - 285) wie dort (CT und IT 2 , 31- 2, 33) diesen Teil. Unmittelbar daran knüpft sich bei Eurich wie bei Theodosius das Kaufrecht (286 -304 [? = CT 3 , 1- 4 ), mit teil weise auch sachlich verwandten Normen . Dann freilich zweigt Eurich ab , indem er (305 - 319 [? ]) de donationibus handelt, während Theodosius im nächsten Titel (CT 3, 5 ) nur de sponsalibus et ante nubtias donationibus spricht. Aber der Zusammenhang offenbart sich auch hier, zumal gerade die erste lex des Titels und noch mehr ihre Interpretatio die Form des Schenkungsaktes ganz allge (86) Ausser den ZSSt 49, 236 n . 4 Genannten s. jetzt namentlich FRANZ BEYERLE , ZSSt (Germ . Abt.) 49, 392 ff. (87) Dazu SCHULZ, ZSSt 47, 39 ff, SCHERILLO , Studi Riccobono I, 41 ff. (88 ) Dazu P . KRÜGER, Gesch. 327 und 2SSt 34 , l. (89) Uber die Beziehung des CE zu PS und CT einiges bei von SCHWERIN (s . ob . n . 58 ) 15 f. ( 90 ) Das commendatum (= depositum ) ist attrahiert wie in der späten Ru brik zu PS 2 , 4 . Zum Wesen des weströmischen Vulgarrechtes mein berührt (91). Der Grund für die Abweichung liegt wohl we niger in dem germanischen Gedanken des Launegild (92) als in dem Wandel, der in nachklassischer Zeit auch im Hinblick auf die systematische Eingliederung mit der Schenkung vor sich ging, nachdem sie, von den Fesseln des cincischen Gesetzes befreit, zu einem anerkannten Veräusserungsgeschäft aufgerückt war. Der Ge setzgeber zog aus der in Norm und Schrifttum immer häufiger werdenden Uebung nur die Folgerung, wenn er nun gleichfalls die Schenkung dicht an den Kauf anschloss: Die Schenkung ihrerseits attrahiert dann in dem letzten Abschnitt der Pariser Fragmente (320 - 336 ) das Intestaterbrecht, wobei der Fall einer Verwirkung der Schenkung durch den überlebenden Gatten (319) die Brücke gebildet haben könnte. Solcher Art sind die Quellen, die das älteste römisch -germa nische Volksrecht aufzuhellen vermögen . Sie in diesem Sinne zum Sprechen zu bringen, kann nur glücken , wenn man es vermeidet, klassische Denkart und Geistesrichtung in ihnen wiederfinden zu wollen . Je stärker die Anklänge, um so entschiedener muss der Beobachter auf der Hut sein . Si duo scribunt idem , non est idem . Höchstentwickelte technische Formen sind primitivem Wollen dienst bar gemacht. Selbst so noch ist ihr Einfluss auf die mittelalter liche Fortentwicklung ein ungeheurer. Und doch wäre aus diesen Quellen die einzigartige juristische Sendung Roms auch nicht ent fernt zu erahnen. Doppelt grandios erhebt sich hinter ihnen die weltgeschichtliche Leistung des später geborenen Justinian . (91) Vgl. auch Jul. 17 dig . D , 39, 5 , 1 gelegentlich der donatio inter virum et uxorem (LENEL, Nr. 291). (92) Von dem die erhaltenen Stücke des CE keine Spur zeigen : so jetzt auch PAPPENHEIM , ZSSt (Germ . Abt.) 53, 52 n . 6 . OTTO GRADENWITZ RETTUNGEN JUSTINIANS ? SUMMARIUM Quae in Codicis constitutionibus Iustinianeis laedunt existimationem nostram et contra grammaticae normam elegantiamve iuris scripta sunt, ea non tam legum latoribus quam compilatoribus imputanda credas. C . 1, 2 , 23 (a . 530 ) ad legata sola respexisse, id quod hodie temptatur, ante hos L annos Victorius Scialoja divinavit. In diesem Jubeljahre von Justinians Digestenwerk darf eine Betrachtung nur schüchtern sich hervorwagen , die den Legislator auf Kosten des Codificators rechtfertigt: Die im Jahre 1889 von mir im ' Istituto di diritto romano ' vorgetragene Vermuthung : u Giustiniano interpolante se stesso ? , ist inzwischen durch einige schlagende Beispiele von Fritz Schulz ( Studi Bonfante ' und · Z . Sav.' 50, 212 ff. namentlich auch 231) erwiesen worden , und auch ich habe an verschiedenen Orten ( Zschr. für Kirchengeschichte' 1932; Bullettino ' 1933 ; Z . Sav.' 1933) davon gehandelt. Fritz Schulzens Forschungen ergeben, dass die Compilatoren sugar an den Anfang eines Gesetzes den Schluss eines anderen gestellt und so die Rechts folgen verwirrt haben : ihr Verfahren ähnelt der Aneinanderrei hung von Bruchtheilen verschiedener Gesetze für die Zwecke eines neuen Gesetzes, wie ich dies ( Heidelberger Akademie ’ 1920 ) für die auf der Tabula Heracleensis inschriftlich erhaltenen Gemeinde Ordonnanzen behauptet habe. Meine Versuche dagegen wollen zei gen, dass die grössten Verstösse der justinianischen Gesetze gegen Schlüssigkeit und Eleganzen Urgesetzen erst eingeimpft wurden, als diese Gesetze in den Codex ' einpassieren sollten : die ans Inter polieren durch die Digesten gewöhnten Compilatoren übten ihre Kunst auch an den Codexgesetzen ihres eignen Kaisers: sie gene ralisierten ; extendierten ; verwirrten das schon Klare durch überflüs sige Erläuterungen u . s. w . In der That: was im Grossen die Reini gung von Edict und Klassiker vollbringt und von deren Vielseitigkeit 56 Otto Gradenwitz der Mitteis -Peters Index interpolationum ' (1) ein so nutzenspen dendes Zeugniss ablegt, das vermag im kleinen eine Revision der justinianischen Codexgesetze. Leicht ist es, den Fortschritt einer neuen Methode den Studien von vor 50 Jahren vorzuhalten ; um so erfreulicher, wenn ein si cherer Blick ein wesentliches Resultat der neuen Methode schon vorausahnte . Im Bullettino ' erscheint jetzt ein Artikel, in dem ich die Hypothese aufstelle : das Gesetz, des im Codex als C . 1 , 2, 3 auftritt, fasste im Jahre 533, als es erstmals erlassen ward , nicht 100 jährige Verjährung, sondern Unverjährbarkeit ins Auge, und bezog sich nur auf Kirchen und piae causae, nicht auch auf civi tates. Zu beweisen versuche ich dabei, dass es damals nur auf Legate und nicht auch auf Schenkungen und Kauf ging . Nachträglich ersehe ich, dass Scialoja , in den achtziger Jahren , in Vorlesungen über Eigenthum , welche Pietro Bonfante 1931 herausgegeben hat, sich über dies Gesetz also geäwssert hat : “ Giustiniano scriveva le sue costituzioni in quel modo come il nostro parlamento fa le sue leggi : siamo in epoca di decadenza, adesso come allora, almeno nella tecnica giuridica, e ciò si ripete in moltissimi altri luoghi, quando parlano imperatori di quest'epoca : quasi sempre l'espressione va al di là del pensiero. È questo un carattere della letteratura giuridica, come di ogni altra letteratura della decadenza. Stando alle parole , la sola in terpretazione possibile sarebbe veramente quella per cui il diritto reale si sarebbe acquistato anche nel caso di donazione e vendita , ma non è da escludere che queste parole siano eccessive, e che il loro significato , secondo il pensiero del legislatore, abbia una por tata più ristretta , e si riferisca qui alle regole generali già stabi lite altrove , (2). (1) Was mich betrifft, so muss ich gestehen , dass ich, als Partsch den ‘ Index ' der durch den Krieg und Peters ' Tod ins Stocken gerathen war, wieder erweckte , Bedenken hatte , ob er bei dem riesigen Anwachsen der interpolationistischen Literatur noch den Werth haben werde, den er damals versprach als Mitteis mit Bekker ihn ins Leben rief. Die Thatsachen belehren mich eines Anderen : Part schens Verdienst war ein grosses ; auch der sichere Blick , mit dem die ausge zeichnete Leiterin des Buro, Frl. Stutz, jetzt Frau Jahn -Stutz, für das Werk ge wonnen ward , verdient alle Anerkennung. (2) Auch Bachofen und Mühlenbruch hegen bei den Gesetzen des Tit. C. 8, 36 Bedenken, die zu Resultaten führen , welche denen der heutigen Kritik nicht Rettungen Justinians ? Was Scialoja 's Einschätzung unserer Parlamente – oder viel mehr der Parlamente aus den achtziger Jahren – betrifft : Um die Wende der Republik und zur Flavierzeit erlassene und durch die Laune des Zufalls uns erhaltene römische Gesetze zeigen eine alles Maass übersteigende Liederlichkeit : das glaube ich in den - S . B . der Heidelb . Akad. ' für die sogenannte lex Rubria , für die sogennante lex Iulia municipalis, für die Ursonensis und für die Salpensana sammt Malacitana gezeigt zu haben . Wenn aber Scialoja dem Codexgesetze 1, 2, 23 durch restrictive Interpreta tion die Schenkung und den Kauf wegzwingen will, so liegt dem die gleiche Empfindung zu Grunde, wie meiner Kritik , die dem ursprünglichen Gesetze von 531 nur Legate zuweist ; unsere Dia gnose ist verschieden , die Therapie verwandt. Die heute geübte Methode führt uns ja dahin , in Betreff des sehr begründeten Vorwurfes Scialoja 's gegenüber den Codexge setzen, die grössere Hälfte der Schuld den unglückseligen Com pilatoren zuzuweisen , welche nicht wenige Einzelgesetze Justinians bei der Aufnahme in den neuen Codex verwässerten. Sie moch ten dabei principielle Vorstösse gemacht haben wie Erstreckung von Kaufregeln auf andere Contrakte ; auch wohl die Angliede rung des Pfandes an das Eigenthum ; sie mögen auch damit ge spielt haben , Wendungen wie legitimo modo zur Sicherheit ein zufügen : gar oft dürfte eine herzhafte Streichung des Schwulstes uns von Zuthaten zu den reineren Gesetzen der Jahre 528-533 be freien . Als Kronzeuge bietet sich das Institutionenwerk . Dieses, ein Jahr vor Vollendung des Codex repetitae praelectionis' durch zwei Re ferenten unter einem Chef hergestellt , gibt, wie ich an C . 1, 2 , 23 in Verbindung mit Inst. 2 , 20, 2 , 3 und an C . 4 , 21, 17 mit Inst, 3 , 23 pr. gezeigt habe, trotz seiner späten Entstehung doch Be richte über justinianische Gesetze in deren ursprünglicher Gestalt, und verbessert so die jenen bei der Codification gegebene, uns allein vorliegende Fassung. Deliciös ist ferner die Confession des Zeno (7 , 37 , 2), dass über die Frage, ob blos Kauf oder auch anderes, in Folge der Fassung der Gesetze oft (also berechtigte !) Zweifel unähnlich sind (vgl. Z . Sav.-St. 1933) und die « lichtvollen Ausführungen » vom Demelius zur Rubria (LENEL, Edictum3410 Anm . 6) legen das Material so vorzü glich blos dass nur noch der Schluss auf Contamination zu ziehen übrig blieb. Roma · II 58 Otto Gradenwitz - Rettungen Justinians? da waren . Ein noch nicht ganz gelöstes Räthsel aber haben uns die Basiliken aufgegeben , da sie in ihren Scholien (Riccobono , Mélanges Fitting ' ; Krüger, Z . Sav.' 36 , 82 ) besseres bieten als Ju stinian . Für C . 3, 33, 11 glaube ich , dies auch für den Text der Basiliken gezeigt zu haben . Die Durchführung des jüngst aufge stellen Planes einer zeitgemässen Ausgabe der Basiliken wäre auch für diese Zwecke förderlich , wie es ja das " Vocabularium ' von Robert (von) Mayr in hohem Masse schon jetzt ist. Die begonnene Palingenesie der Constitutionen, die durchzusteuern ihrem Urheber Pietro Bonfante nicht vergönnt war, wird auch für diese Rettun gen des Justinian ein Bestes thun. Wie weit eine solche und eine verwandte Codexkritik sich vor wagen darf, ist jetzt schwer zu übersehen : Wenn Zeno (10 , 34 , 2 ) den Käufern vom Fiskus allemal das Eigenthum gewährt und die früheren Herren auf eine vierjährige Entschädigungsklage zurückdrängt, so bietet das eos quin etiam , mit dem er den Fis kalkäufern die Geschenknehmer von kaiserlicher Gnade wegen , anreiht, kaum ein Bedenken . Aber Justinian geht im nächsten Ge setze für Zeno, nicht blos auf Käufer, sondern auch auf: per donationem accipientes vel per alios titulos alienationis quicquam detinentes ; er weiss aber im übrigen nur zu sagen , dass zwar Fis kus schon privilegiert ist, aber den Kaiser und die Kaiserin er selber erstmalig zu privilegieren hat; er verräth also nichts von Zeno' s Erstreckung auf die vom Kaiser beschenkten , und nichts von Zeno' s Beschränkung auf Fiskalkäufer. So besteht eine In congruenz, bei der die Institutionen (8 , 6 , 14 ) auf Justinians Seite stehen. C . 6 , 27, 5 von Justinian trägt der zweite Fall Merkmale der Einschaltung, besonders in der Phrase: cui adquiritur legatum vel institutio, denn für das abwegige adquiritur institutio findet sich nach Mayr kein Beispiel, so gehäuft auch institutio gerade bei Justinian ist. Dies sei hier constatiert: wie zu helfen , bleibe dahingestellt ! SALVATORE RICCOBONO ACCADEMICO D ' ITALIA PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO ROMANO NELLA R . UNIVERSITÀ DI ROMA L ' INFLUSSO DEL CRISTIANESIMO SUL DIRITTO ROMANO 。 SUMMARIUM Inde a saeculo XIX magna fuit quaestio de effectu Christianae religionis etiam in iure ; num haec quiddam ad renovationem iuris romani contulerit. Causae hoc proposito explicantur, quae obstabant ad agnoscendam veritatem . Iis causis remotis dubitatio hodie facile resolvitur, perscrutatis critice textibus, quos fontes iuris, inde a Constantino imperatore et praesertim Corpus legum a Iustiniano confectum , praebent. Exinde evidenter apparet, doctrinam Christianam non tantum fautricem constantissimam , sed etiam effectricem novi iuris fuisse. Hoc probatur multis variisque institutis iuris privati. Denique de stoica philosophia disseritur, quae iampridem ad novas consue tudines regulas decisionesque iuris instituendas multum contulit ; easque Chri stiana religio novo spiritu saepius confirmavit ac potentius extendit et diffudit. Lo sviluppo del Cristianesimo anche come fatto storico e come dottrina, e la penetrazione dell'etica cristiana, fin dall'epoca dei Romani, sulle successive trasformazioni del diritto, è uno dei feno meni più grandiosi della storia . Si dovrebbe perciò supporre che il secolo XIX , che fu il secolo dello storicismo, avesse scrutato a fondo questo problema cosi ca pitale e messo in chiaro quanta parte si debba attribuire propria mente alla Religione, in quel processo d ' intensa formazione e tra sformazione del diritto, che ebbe luogo nei due ultimi secoli del mondo antico , cioè nei secoli IV e V d . Cr. Tutto al contrario ; la scuola inaugurata dal Savigny nei primi anni del sec. XIX e che porta il nome di scuola storica tedesca, non solo non rivolse alcuna attenzione a siffatte indagini, ma, appena si presentò l' occasione, respinse nella maniera più categorica l' idea, che il diritto romano codificato da Giustiniano avesse subito un qualsiasi influsso cristiano. Nei secoli anteriori, invece, non si era mai dubitato di ciò . Il Medio Evo è tutto dominato dall' idea e dalle dottrine cristiane ; e Dante rappresentó Giustiniano come legislatore cristiano, che seguendo i precetti della Chiesa aveva con l'aiuto divino compiuto l'opera per l'attuazione della giustizia terrena e per il consegui mento della grazia celeste . Il primo, che, nel sec . XIX , tentò di segnare le grandi linee dell' influsso del Cristianesimo sul diritto , fu il Troplong , civilista francese, che scrisse nel 1841 una monografia sull' argomento. L ' opera suscitò critiche aspre, e fu subito sopraffatta . Il Troplong Salvatore Riccobono per altro aveva affrontato il tema dal lato più facile, mettendo in luce l'azione esercitata dalla Chiesa sul diritto delle persone, e specie sui costumi, sul matrimonio, sulle seconde nozze, sugli schiavi, sull'usura e così via. La dimostrazione, in verità , offriva il fianco alla critica ; perchè in quel tempo non si conosceva ancora l'analisi storica e filologica dei testi di legge. Onde il Troplong fu tratto a raccogliere le te stimonianze dapertutto, alla rinfusa , a aveva attribuito un grande influsso cristiano già su i giureconsulti del 2° e 3° secolo dell' Im pero. La scuola storica dichiarò assurda quest'asserzione; osservando che non potevano essere dominati dallo spirito cristiano quei giu reconsulti, vissuti nel II e III sec., che erano stati consiglieri degli Imperatori, che avevano ordinate le feroci persecuzioni contro i Cristiani. La opinione del Troplong fu perciò derisa ; e tutto il problema fu messo a tacere. In questo stesso periodo parlò lo storico che fu ritenuto l'ora colo del secolo rispetto alla storia delle origini del Cristianesimo : dico Ernesto Renan ; e questi ripetutamente, specie nella vita di Marco Aurelio , sostenne che l'azione del Cristianesimo sul diritto era stata nulla , e credette di provare ciò nella maniera più decisiva , dicendo che il Cristianesimo nulla fece per la redenzione degli schiavi; non ne infranse le catene ; ma disse soltanto ai derelitti parole di rassegnazione, affinchè sopportassero con fede tutte le tribolazioni terreno, confortandoli con la promessa che a loro pre cipuamente era riservato il regno dei Cieli. A queste osservazioni del Renan risponderò più oltre. Per ora constatiamo il fatto che giuristi e storici furono nel sec. XIX concordi nel negare un influsso dell'etica e delle dottrine cristiane sul diritto. L 'opinione del Renan, naturalmente, non poteva per sè stessa avere gran peso, perchè egli non conosceva le fonti giuridiche, dalle quali la soluzione del problema doveva venire . Ma quella dei giuristi e dei grandi storici del diritto del sec. XIX è grave, in quanto questi avevano una profonda conoscenza dei libri di diritto e li avevano scrutati a fondo, sotto i più vari aspetti. In verità , i più illuminati tra essinon ardirono pronunziare un ' esclusione totale di quell' influsso dell'etica cristiana ; così il Ihering aveva ammesso che la Chiesa avesse debellato l' atteggiamento ostile del diritto verso le donazioni — che era una caratteristica del diritto romano L ' influsso del Cristianesimo sul diritto romano - e avesse cosi favorito il sorgere del patrimonio delle Chiese e dei monasteri e il meraviglioso sviluppo delle opere pie (piae causae). Naturalmente questa parziale e limitata ammissione non poteva avere gran peso. Il problema ha, come ho detto, una ben più vasta importanza ed è imponente . Infatti, la storia del diritto è la parte più saliente della storia civile d ' un popolo , nel senso più largo, e deve abbracciare perciò tutta la vita della nazione, le varie ma nifestazioni dello spirito e della vita sociale – religione, costumi, morale, condizioni economiche – le quali tutte si rispecchiano nel diritto , che è il fenomeno più possente e complesso tra i fe nomeni sociali. E la religione esercitò sempre, nei popoli antichi, un 'azione di prim ' ordine. I romani stessi si dicono “ religiosissimi mortalium , Polibio ed altri antori greci videro in ciò la grandezza di Roma, nella romana Eugépela . Tutta la vita privata e pubblica era compe netrata della religione. Il pater familias entrando in casa saluta i Lari e poi visita il campo. I sacra e l' hereditas sono regolati dal diritto pontificale, e le sanzioni sono non di diritto civile, ma del diritto sacrale. Perciò nell'epoca più antica il collegio dei Pontefici ha un 'importanza preponderante in tutta la vita privata e pubblica , specie nel campo del diritto e dell'amministrazione della giustizia . La religione cristiana doveva assumere un' importanza e una funzione ancor più intensa e più larga, dal III secolo in poi, in un'epoca cioè, in cui sulle rovine del mondo antico risplendette unica la luce dell' etica e del pensiero cristiano. Ci debbono essere pertanto delle cause generali, estranee al valore e al contenuto delle fonti, per spiegare questa strana dot trina dei giuristi e degli storici. Su queste cause dobbiamo rivol gere, anzitutto, la nostra attenzione per renderci conto d ' una vi sione storica cosi ferma e così falsa . Queste cause possiamo indicarle ora con tutta determinatezza. Esse sono tre ed hanno tutte un carattere generale . 1 ) La prima è riposta nel materialismo storico del sec. XIX . Secondo questa dottrina l' economia sarebbe l'unico fattore della storia della civiltà , da cui pertanto dipenderebbero : le modificazioni nella costituzione giuridica e sociale, l'organizzazione politica (lo Stato), la morale dei popoli, le stesse manifestazioni più spirituali, come la religione, l'arte, il pensiero. Tutto sarebbe dominato dal fenomeno economico . Ma questa dottrina é fallace nel modo più Salvatore Riccobono patente . Storicamente tutte le comunità che acquistarono grande floridezza e raggiunsero un alto grado di benessere e di civiltà , furono sostenute da grandi ideali e dal sentimento religioso. Il mo derno semplicismo economico, come spiegazione della storia è ormai superato . È accertato che i fatti sociali sono il risultato di coeffi cienti diversi, percettibili o invisibili, e tra essi tiene un posto eminente quello religioso. Onde il materialismo prende le mosse da un postulato, non solo non dimostrato, ma in aperto contrasto con la fenomenologia storica più accertata. Nella psiche umana si rive lano tendenze altrettanto vivaci e primigenie, le quali ricercano la loro soddisfazione indipendentemente dai bisogni economici. Si comprende, ora, come il secolo dello storicismo, dominato nella sua seconda metà dalle dottrine marxiste, doveva deridere la posizione del problema intorno all' influsso del Cristianesimo sul diritto. In nome della scienza storica si era proclamata la oziosità e la assurdità di simili ricerche, con l' asserzione dommatica della più assoluta mancanza d 'ogni influsso del Cristianesimo sul diritto romano. E , se la dottrina marxista è oggi superata , tuttavia gli ef fetti permangono nelle opere degli autori più gravi del secolo pas sato. La voce è spenta , ma l' eco risuona ancora . A sradicare errori così vasti non basta il lavoro di una generazione, perchè occorre distruggere e ricostruire. Ma il lavoro di ricostruzione, storici e giuristi non sono stati in grado d 'intraprenderlo, e non lo sono ancora , per un secondo motivo, che è pure generale , ed ha, più particolarmente, un conte nuto tecnico. 2 ) Questo motivo riguarda lo stato degli studi e la tradizione umanistica del diritto romano . , Di esso mi sono occupato più largamente in varii miei scritti, dove questo è uno dei punti essenziali posti in chiaro . Qui vi accennerò per sommi capi. La scienza del diritto romano ha avuto nella storia varie vi cende. Due volte è caduta in uno stato di grave crisi; nel sec. XVI e XVII e poi nel sec. XIX e in questo principio del XX sec. La prima volta nel periodo dell' Umanesimo, cioè con la scuola dei giuristi che rivolsero tutta la forza del loro intelletto e le più sottili indagini verso il diritto più antico, che ammirarono come prodotto caratteristico dello spirito e dell'opera dei classici. Questa scuola idolatrò la forma al di sopra del contenuto e, nel valutare le leggi, gli ordinamenti e l' opera della giurisprudenza classica , L ' influsso del Cristianesimo sul diritto romano esaltò il pregio formale , la rispondenza matematica tra i principi e le conseguenze, la inflessibilità e l'armonia del sistema in tutte le sue parti. Perciò essa si orientò verso il diritto quiritario, il di ritto più antico di Roma, che, appunto , come un diritto primitivo, era formalistico , inflessibile, rigoroso in ogni sua parte, specchio della grande disciplina privata e pubblica del popolo romano. Questa scuola, pertanto, spregiò tutto quello che nei libri di Giustiniano si distaccava da quella linea classica. Il Fabro, che di essa fu uno dei principali rappresentanti, chiamò facinora Triboniani tutte le deviazioni e alterazioni della logica pura del ius civile . Tutti i seguaci di questa scuola cercarono di espellere dai testi gli elementi nuovi, ispirati al sentimento di equità , alla moderazione, alla pietà , al perdono, alla generosità e alla liberalità , ritenuti come degenerazione della salda e rigida struttura del diritto romano. Essi, perciò , dissero barbari i Glos satori, cioè i Maestri della scuola di Bologna , che dal sec. XII al XIII avevano con mirabile acume rivelato e ricostruito tutto il contenuto dell' opera di Giustiniano, salvando il diritto romano dal l'oblio. I Glossatori, invece, come noi vedremo, furono i veri in terpreti del Corpus iuris, mai superati. Essi ne eliminarono, co munque, gli elementi antiquati e fondarono il “ ius commune , , aprendo cosi con la lingua e le leggi dell'antico impero le fonti della civiltà nuova . La scuola degli Umanisti non ebbe per fortuna nessuna azione sulla pratica e sulla formazione del diritto comune. Essa andò a concludere l'opera sua in Olanda, con la scuola dei “ Culti , , i quali diedero alle loro indagini un indirizzo lessicale, letterario e critico. Ma è ovvio che con un siffatto indirizzo e con tale spirito gli Umanisti non ebbero nè attitudini nè capacità di scovrire le trasformazioni del diritto nei vari periodi storici, tanto meno di vedere e apprezzare gli elementi dell' etica cristiana che vi si erano innestati, e che avevano elevato grandemente il valore del diritto romano . Quel che è più strano, è che nella seconda metà del sec. XIX , dopo il Troplong, che aveva formulato la tesi del grande influsso del Cristianesimo sul diritto romano, e dopo il Marx che aveva enunciato la legge del materialismo storico, la scienza romanistica non fece un passo in avanti. Ciò si spiega, perchè essa in seguito alla scoperta del prezioso ms. delle Istituzioni di Gaio , nel 1816 , Salvatore Riccobono si era orientata ancor più decisamente verso il diritto classico, ed a poco a poco s ' impelagò tutta in quello stesso indirizzo umanistico del sec. XVI. Le conseguenze questa volta furono ancora più funeste. Perchè, non solo si ritornò, sostanzialmente, all'ammirazione della logica for male del diritto antico, non solo , come già il Fabro nel secolo XVI, si cominciò a inveire contro Giustiniano, che aveva, come si disse, deturpata la mirabile opera della giurisprudenza classica ; ma, di più – in un secondo momento , che è quello attuale – si volle vedere nell' opera di Giustiniano una forte corrente greco- orientale , e si disse, e si sostiene, che il carattere precipuo della codifica zione del sec. VI sia l'orientalizzazione del diritto, l' impronta elle nistica-bizantina che vi sarebbe stata impressa dalle scuole di re torica del IV e V secolo d . Cr., specialmente in Berito . In queste condizioni è ovvio che non si è potuto nė percepire nè indagare l'influsso dell' etica cristiana. La negazione è stata re cisa come lo fu da parte dei contemporanei di Carlo Marx e di Renan . L ’ infatuazione del bizantinismo e dell'orientalizzazione, ali mentata dal grande flusso dei papiri greco-egizii, è arrivata oggi al punto , che le fonti latine, più dirette, sono ormai passate in second 'ordine ; e i testi del Corpus iuris si vogliono illustrare e intendere con i documenti orientali greco -egizii. La patristica, in vece, e tutta la letteratura cristiana del periodo imperiale , non furono mai attratte nell' orbita delle indagini storiche. Riassumendo, dunque, tutto quanto concerne i suddetti mo tivi, diremo che essi investono tutta la visione dello sviluppo del diritto romano stesso e la valutazione del contenuto dell'opera di Giustiniano, l'una e l' altra viziate da un errore essenziale, per scarzezza d 'indagini e per preconcetti infondati. 3 ) Il terzo motivo é d ' indole esclusivamente tecnica. Sino a quarant' anni addietro la critica dei testi era quasi del tutto scono sciuta. I passi si attribuivano agli autori indicati nell'opera diGiu stiniano ; senza alcun sospetto delle gravi alterazioni che essi ave vano subito , ai fini legislativi, per opera dei commissari di Giu stiniano. In queste condizioni l' indagine sulle fonti era difficile , anzi impossibile. Infatti il Troplong nella sua monografia , sopra ricordata, aveva dovuto attribuire sentimenti e tendenze cristiani ai giuristi del II secolo ; e questo metodo, di cui per altro egli non aveva L ' influsso del Cristianesimo sul diritto romano colpa, svalutò il risultato delle sue indagini. Contro di lui, come ho detto, la critica fu aspra e inesorabile e usci trionfante, sino al punto che si credette definitivamente chiuso l' adito a qualsiasi cre denza dell' influsso dell'etica cristiana sul diritto romano. Si disse , pertanto , che qualsiasi affermazione contraria non aveva valore scientifico . b us Questo stato di cose si doveva mutare nell'ultimo quarantennio . La critica filologica e storica ha avuto ora un grande sviluppo : anzi caratterizza la scienza romanistica contemporanea. Oggi sap piamo che tutti i testi del Corpus iuris, decorati dei nomi dei giu risti e degli imperatori, furono alterati per ragioni legislative. Il problema pertanto si ripresenta in altre condizioni, e può essere risoluto nel senso affermativo per via di una nuova analisi dei testi di legge. Contardo Ferrini, alla cui santa memoria tutti c ' inchiniamo riverenti, intui ben presto che nuove indagini, condotte con mezzi più perfezionati e con nuove vedute , avrebbero dato ben altri ri sultati e dimostrato l'imponente azione che il Cristianesimo esercito sulla trasformazione del diritto e in particolare sull' opera di Giu stiniano (1 ) Il tema fu da me affrontato nel 1908, al Congresso storico di Berlino, e la mia dimostrazione sintetica, se non ebbe unanime consenso, valse nondimeno a rompere l'incantesimo, rimettendo il problema nel campo delle indagini e delle discussioni. Nei decenni trascorsi s ' è fatto un buon cammino. Non si sono avuti, in verità , lavori poderosi, condotti come si deve, con larghe ricerche sulle fonti giuridiche e religiose ; ma, nondimeno, la nuova generazione non ha più dubbî su questo argomento ed ammette l' influsso del Cristianesimo sul diritto già nel periodo che va da Costantino a Giustiniano. Il dubbio verte, ormai, sull' estensione di quell' influsso. Tutti son proclivi a riconoscerlo, e lo riconoscono, senza esitanza, per quanto riguarda i costumi ed in generale il diritto delle persone. Ma le mie affermazioni più larghe, che ammettono un influsso intenso e profondo sulla coscienza e sul sentimento di quelle nuove (1) ZSSt. 15 (1894) 343 sgg. Salvatore Riccobono comunità e quindi su tutta la formazione del diritto in quel pe riodo, sono ancora discusse e contrastate . Il problema è dunque degno della nostra più grande attenzione. Per chi ritiene, come io ritengo, che la storia è moto e collega mento immediato , spesso invisibile, di fatti e di idee, il dubbio non può sussistere. L ' influsso dell'etica cristiana dovette investire tutte le manifestazioni della vita del tempo, come aveva profondamente mutato il costume, le abitudini, la coscienza di quelle nuove gene razioni, travagliate dalle più grandi miserie. L ' idea cristiana divenne, allora , il fattore dominante, ed emerse naturalmente in tutta la vita del popolo , pubblica e privata, nel movimento economico , etico , ideologico. Nessun ramo del diritto poteva perciò sottrarsi a quell'azione. Il diritto pubblico doveva subire trasformazioni profonde, le quali debbono essere osservate particolarmente ; così il diritto costituzio nale, il diritto amministrativo ed il penale. Più immediata ancora doveva essere l'azione dell' etica cristiana sul diritto privato , nei suoi vari rami, sul diritto patrimoniale e delle persone, e in particolare sul diritto commerciale. Il divieto di atti di emulazione. Il concetto assoluto della proprietà , che poggiava saldamente sul principio dell' individualismo, doveva essere attenuato , col rico noscimento di doveri che incombono al proprietario , imposti da interessi sociali. In particolare, doveva cadere il principio del di ritto quiritario : qui suo iure utitur neminem laedit, il quale doveva cedere il posto ad un principio socialmente ed eticamente superiore, che nega al proprietario l' esercizio del suo diritto per nuocere ad altri. Nella compilazione di Giustiniano questo è affermato con vigore, dacchè si fa divieto di usare del proprio diritto “ animo nocendi ,. Le scuole degli Umanisti, nel sec. XVI, e del sec . XX , vollero negare con tutte le forze questa massima. Ma noi ora sappiamo che la negazione è fondata su una falsa visione sto rica del diritto romano, di cui ho fatto cenno sopra. Ciò è tanto vero , che nella compilazione di Giustiniano il principio è stato svolto sino alle estreme conseguenze. Dacchè, in essa è anche af. fermato il lato positivo di esso, in quanto si ammette che il pro prietario non si deve opporre a che il vicino entri nel suo fondo L ' influsso del Cristianesimo sul diritto romano per riparare l'argine distrutto dalla piena del fiume. Questa deci sione è cosi motivata : fr. 2 $ 5 D . 39, 3 .....qui factus mihi quidem prodesse potest, ipsi vero nihil nociturus est; haec aequitas suggerit, etsi iure defi ciamur ( 1 ). La massima ebbe nel Medio Evo grande risonanza. Evidente mente essa ha una spiccata impronta evangelica. Come tale, è in perfetta contraddizione col principio dell'assolutezza del dominio del diritto quiritario ; onde fu svalutata e non intelletta dalla scuola degli Umanisti. Ma il divieto dell'abuso del diritto , in qualsiasi forma, è en trato oggi in tutti i codici, così in quello tedesco, svizzero, giappo nese, e fu accolto pure nel progetto d' un codice unico delle ob bligazioni tra la Francia e l' Italia , malgrado le energiche proteste di quella scuola che noi conosciamo, e che è ancora tutta infatuata della logica inesorabile del diritto quiritario . In Inghilterra e nella dottrina americana la discussione è ancora viva. Perciò potrà essere utile questa rappresentazione della genesi storica della massima. Ora sappiamo che questi problemi non scaturiscono da elucubrazioni dottrinarie dei giuristi, ma da forze vive che hanno operato sullo sviluppo della civiltà . Influsso sul diritto commerciale. Nel commercio l' influsso cristiano si manifestó su di un punto centrale. I Cristiani, dice Tertulliano (2), bandiscono dal loro cuore la cupidigia . Eusebio soggiunge che i Cristiani non rifuggono dal com mercio , ma sono giusti e modesti evitando la passione delle ric chezze. S . Ambrogio (3 ) inibisce quell' attività che possa riuscire di detrimento al patrimonio degli altri. Questi precetti ci vengono già rappresentati e confermati nelle figurazioni cemeteriali cristiane. ( 1) Cfr. 1 $ 12 D . 39. 3. (2) Apol. 42, 3. (3 ) Off, 3 , 9 . 57 Salvatore Riccobono In una pittura della 2a metà del sec. IX della Basilica primi tiva di S . Clemente in Roma ( 1), Cristo siede da giudice in mezzo agli Apostoli. Nella parte destra si vede una bilancia e un moggio , con il detto modium iustum . Il che vuol dire che la misura deve essere giusta . Il precetto proviene certamente dal periodo cristiano più antico. In una costituzione di Valentiniano noi leggiamo il monito : C . Th . 13, 1 ,5 (C . iust. 3, 1, 4 , 1 ) .... Christiani, quibus verus cultus est adiuvare pauperes et positos in necessitatibus.... Or in tutta la compilazione di Giustiniano si riscontra le cento volte congiunto ai sostantivi aestimatio - pretium l' aggettivo iusta iustum . L 'etica cristiana ha dunque imposto il giusto prezzo e la giusta misura . Ciò in opposizione al principio del diritto pagano, tante volte ricordato dai giureconsulti, che suona : in emptionibus et ven ditionibus licet contrahentibus naturaliter se circumvenire. Ciò vuol dire che nel commercio si riteneva lecito vendere a più o a meno, quando ciò fosse fatto senza dolo, ma con quell' arte che si suole usare nel comprare o vendere, svalutando o esaltando il valore della merce, col risultato che nella gara vince il più abile o scaltro. L ' etica cristiana riprova ciò. Ed il nuovo precetto fu accolto nel l' ultimo svolgimento della legislazione, dopo Costantino. Ora si esige il “ iustum pretium , (2 ). Un'ulteriore importante conseguenza del precetto nell' ordine giuridico si ebbe nel rimedio accordato al venditore di far re scindere la vendita per lesione enorme. La lesione enorme si ha quando la cosa viene venduta a meno della metà del suo giusto valore. La lesione nella codificazione di Giustiniano · repressa in tutti gli istituti: non solo nella vendita, ma nella costituzione di dote, nella transazione, nella divisione. Tutto questo ora è fatto palese, mediante la critica dei testi. La quale ha accertato che sia il iustum pretium , come la laesio enormis furono inseriti nei testi ( 1 ) WILPERT, Le pitture della Basilica di S. Clemente, in Mél. d ' archeol. Chr. 1906 , 252. (2) Cfr. ALBERTARIO , lavoro cit. nella nota che segue ; ma vedi pure sul proposito LEVY, ZSSt 43 (1922) 534. L 'influsso del Cristianesimo sul diritto romano dei giuristi e nelle decisioni imperiali mediante interpolazioni del l'epoca post -costantiniana (1 ). La dimostrazione, pertanto, che l'etica cristiana esercitò un ' in fluenza decisiva anche sugli istituti di diritto patrimoniale, è esau riente. Essa è messa fuori contestazione dalla critica dei testi, che risolve così lo contraddizioni i le fonti presentano in tutto questo hi lche c . ?Umanisti ev piegarsi di fronte all' evi qua si ddeve campo . La scuolaodegli denza di questi risultati, i quali spiegano l'evoluzione del diritto e rimettono ordine e chiarezza là dove c' era il caos. Ognun vede, inoltre, che le posizioni si sono ora invertite rispetto a tutti questi problemi. I testi che erano svalutati dagli Umanisti, antichi e mo derni, acquistano maggior risalto, come fonte preminente del diritto nuovo ; e quelli genuini, del diritto quiritario , vanno composti nel sepolcro, come punti morti, che nella compilazione hanno soltanto un valore storico . Sino a qual punto arrivi l'azione dell' etica cristiana nel campo dei diritti patrimoniali è problema che ora potrà essere risoluto con indagini ben ponderate e pacate . Qui è sufficiente d'aver indicato la mèta e il metodo delle indagini. Diritto delle persone . Nel territorio dei diritti delle persone la dimostrazione si pre senta più agevole. Qui l' influsso fu certamente più immediato e più largo, nè occorre in proposito addurre esempi. Solo un punto vorrei riprendere, accennato sopra , in confronto all' opinione del Renan, il quale negò perfino che il Cristianesimo avesse migliorata la con dizione degli schiavi. Il Renan avrebbe voluto vedere infranta la schiavitù tutto d 'un tratto, per imperio di legge. Questo è un assurdo. Nell'antichità lo schiavo è strumento di lavoro . La schiavitù è una caratteristica spiccata dell'economia antica. Essa adempie nel mondo antico la stessa funzione del lavoro libero . La grande industria antica era un ' organizzazione fondata sull' elemento schiavo, non altrimenti che la grande industria moderna ha a base la macchina. -- -- - -- - - - (1 ) SOLAZZI, Laesio enormis, BIDR 1920, 57 sgg.; ALBERTARIO , Iustum pre tium e iusta aestimatio , BIDR 1920, 19 ss. Salvatore Riccobono Se cosi è, si deve dire che, se la schiavitù si è attenuata nel mondo antico, ed è poi scomparsa , ciò si deve essenzialmente a cause etiche e non già a cause economiche. Ed il merito principale spetta al Cristianesimo. Questo si è voluto negare con argomenta zioni ingenue, col dire che il Cristianesimo non aboli la schiavitù immediatamente nel momento del suo trionfo, e che perciò non si curò della sorte di essa. È ovvio , invece, che la forza delle condi zioni economiche non poteva essere superata ad un tratto. Occor reva uno sviluppo lento e secolare. Ma la nuova fede era venuta in difesa dei servi, degli oppressi, dei miseri, con tutti i mezzi. L 'ugua glianza di tutti gli uomini, già riconosciuta dallo stoicismo, era ri masta soltanto teorica, nel mondo pagano. S . Paolo aveva, invece, proclamato : “ non c' è più nè schiavo, nè libero : tutti siete figli di Dio , . E la Chiesa non solo diede conforto spirituale a tutti i mi seri, ma cercò di alleviare con tutti i mezzi le miserie della vita terrena. Essa riconobbe subito nei concilî il matrimonio di schiavi cristiani, consigliò anzi che i genitori dessero le fanciulle in ma trimonio a schiavi cristiani piuttosto che a liberi pagani; ammise lo schiavo alla dignità vescovile, favori in tutti i modi le mano missioni (favor libertatis) ; che, se era già proclamato nel diritto nel l' epoca degli Antonini, ora, nel periodo cristiano, è usato con tutta larghezza . In un bassorilievo di un sarcofago rinvenuto a Solona in Dalmazia sono rappresentati due sposi ai lati del Buon Pastore, entrambi circondati da una folla di uomini e di donne. Questi rappresentano schiavi che gli sposi avevano manomessi morendo, ed essi ora assistono le anime dei loro benefattori nel momento in cui compariscono innanzi a Dio (1). Qui si vede la forza che la fede spiegò a favore degli schiavi. La legislazione pagana, preoccupata delle condizioni sociali e del l'ordine pubblico, aveva imposto limitazioni d'ogni specie alle ma nomissioni di schiavi, a cominciare dall'epoca di Augusto. Tutte queste limitazioni caddero nell' Impero cristiano, perchè la fede ha posto al primo piano i valori spirituali, ravvivando il sentimento e la coscienza degli uomini. Le manifestazioni di queste tendenze etiche sono svariate e numerose nelle fonti giuridiche. Così per citare ancora un esempio : si vieta che il padrone possa alienare (o comunque allontanare) lo ( 1) LE BLANT, in Mémoir , de l' Acad. des inscript. et belles Lettres, 1873. L' influsso del Cristianesimo sul diritto romano schiavo separandolo dalla moglie e dai figli, dacchè ciò sarebbe inumano. Già è meraviglioso che vi hanno testi che indicano la schiava come uxor (1 ). Vuol dire che la famiglia naturale degli schiavi era riconosciuta in tutti i suoi effetti e protetta dalla pietà cristiana. Dobbiamo pertanto riconoscere che i grandi scrittori del sec. XIX nella valutazione storica del Cristianesimo e della formazione del nuovo diritto nel periodo dell' Impero cristiano, hanno preso un tremendo abbaglio , perchè hanno dato grande rilievo al diritto quiritario , senza considerare le forze più vive che avevano deter minato l' evoluzione del diritto. E questa evoluzione appare ora tutta chiara , pronta a smentire tutte le teorie e le ricostruzioni finora escogitate, malgrado siano esse uscite da alti intelletti e state pro clamate da uomini sapienti. Noi abbiamo visto invece che la storia per altre vie percorreva facilmente il suo corso. Quel che resta a determinare è il processo e l' intensità di quest' azione dell' etica cristiana sul diritto. Qui, naturalmente , sorgono altri problemi che sono preliminari, affinchè l' indagine proceda con quella gravità che l' argomento ri chiede. Stoicismo e Cristianesimo. Ed il primo problema da chiarire è quello che riguarda l' azione dello stoicismo sullo sviluppo delle dottrine del diritto romano. Anche questo è un tema ancora non perfettamente esplorato . Che le dottrine stoiche esercitarono sulla giurisprudenza romana un grande influsso, è innegabile. L ' influsso risale già agli insegnamenti di Panezio in Roma sulla fine della Repubblica. L 'uguaglianza di tutti gli uomini per nascita, e che il nato della schiava non può essere considerato come “ i frutti , delle cose, sono verità già riconosciute nel periodo repubblicano . Nell'epoca degli Antonini, e già nel primo secolo , l' azione dello stoicismo sulla vita e sul diritto si manifesta intensa. Seneca dice : « lo schiavo è il nostro umile amico , . Plinio il giovane parla dei servi come familiari, permette ad essi di far testamenti e li dice quasi cives della domus. Con Marco Aurelio lo stoicismo ascende il trono. Il principio di equità è attuato larga ( 1) Cfr. 12 SS 33, 34 D . 33, 7 ; fr. 35 D . 21 , 1. Roma · 11 Salvatore Riccobono mente. I giuristi spesso motivano le decisioni invocando la “ huma nitas, la pietas , evidentemente sotto l'influsso delle dottrine stoiche, che appare potente in Cicerone. Ed il progresso è pure in questa direzione visibile . Così mentre nel mondo romano il lavoro manuale è ritenuto men degno degli uomini liberi (1), noi ritroviamo che nell' epoca degli Antonini esso è tenuto in onore, come provano le iscrizioni sepolcrali (2). Non occorrono altri esempî al nostro scopo, che è quello di chiarire il problema che vengo a indicare. Infatti, da questi esempi e da altri della specie medesima, si vuol trarre argomento per dire che una distinzione netta tra l' in flusso esercitato dallo stoicismo e quello esercitato dall'etica cri stiana è difficile farla. In questo modo taluni sostengono che molto che si vuol attribuire al Cristianesimo, è pura applicazione e svi luppo delle dottrine stoiche nel campo del diritto. Questa osserva zione potè essere considerata grave solo nel passato . In realtà , è ovvio che anche dove dottrine e precetti cristiani coincidano con quelli stoici, è innegabile che l'etica cristiana animò le impassibili e aristocratiche dottrine della filosofia col soffio potente di un ideale e le diffuse nel popolo e le rese attive nella vita con la forza del sentimento. Ma, in secondo luogo poi, e principalmente, io dico che quella obiezione poteva avere un qualche valore nel passato , quando la critica dei testi non era ancor nata, onde tutte quelle decisioni si attribuivano ai giureconsulti, che figurano come autori. Ma oggi quest 'equivoco è smaltito. Se le decisioni sono nuove, inserite dal legislatore del VI secolo o da pratici dopo Costantino, l' origine stoica è esclusa in modo assoluto . Ciò vuol dire , dunque, che nel l' indagine bisogna prima stabilire la provenienza del testo, della dottrina o decisione che sia . E vuol dire, inoltre, che non tutto quel che appare opposto o diverso dal diritto quiritario si deve ri tenere d 'origine cristiana. Onde non si deve riportare all' etica cri stiana sic et simpliciter tutto quel che è ispirato a principi e sen timenti di equitâ , di umanità , di pietà , di fratellanza. Questo non si pretende. Lo sviluppo del diritto fu intenso giä nei primi tre secoli dell' Impero, precisamente nel senso che esso si veniva affran cando, con moto largo e accelerato, dal rigore delle forme e dei principî del diritto arcaico. Il riconoscimento dell' equità , come es (1) Cic. de off. I. 42, 100. ( 2) Cfr. RostovTZEV, History of social and econ. of the r . Empire . L ' influsso del Cristianesimo sul diritto romano senza del diritto , proviene già dalla dottrina aristotelica, diffusa da Cicerone e formulata da Celso nel celebre detto (1) : ius est ars boni et aequi. Vuol dire, dunque, che l' indagine da fare è complessa e deve procedere cauta . Ma, affermato ciò , noi riusciamo a isolare gli elementi cristiani con grande certezza , sia mediante i criterî for mali, già accennati, sia per la sostanza delle dottrine. E da principio bisogna procedere con metodo rigoroso , senza eccedere nel senso contrario . Il controllo scientifico è oggimaggiore ed esclude le declamazioni per ogni verso. Ed io dico, che anche in un primo esame, condotto con tutto rigore, l' influsso cristiano si manifesta potente. Il criterio che io seguo nell'indagine è il se guente : ammettere l'azione dell' etica cristiana in quegli istituti e rispetto a quelle decisioni o motivazioni che sono in aspra contrad dizione con i principî più fermi del diritto civile ed insieme degli sviluppi di esso attuati dal pretore e dagli Imperatori nell'epoca classica . Questo sistema, se seguito con rigore, non può generare equivoci. Gli esempi, che ho riportati sopra , hanno questi caratteri. E se prendiamo ad esaminare altri istituti, noi vi possiamo cogliere quelle caratteristiche in modo ancor più spiccato . Primo). Cosi rispetto all'impulso ed al favore che la legisla zione diede alle donazioni, che nel mondo romano erano mal viste. Polibio dice : i Romani non donano per niente. I divieti delle do nazioni sono caratteristici del diritto romano e furono in vigore per tutta l'epoca classica. Invece dopo Costantino la donazione è incoraggiata , e poi resa efficace anche per semplice “ pactum , Secondo). Il Cristianesimo nella sua missione di pace e di amore inculcò le massime della carità , del perdono, della modera zione ; quindi inibì la violenza, la vendetta e limitò anche il diritto alla legittima difesa. Perciò nei libri di diritto si leggono precetti e massime, che oggi ancora sono nel campo del diritto penale molto discusse. Così quella inassima : che la reazione contro colui che aggredisce dev' esser fatta cum moderamine inculpatae tutelae. La frase barbara vuol dire : che la reazione dev'esser moderata, fatta per la tutela della persona e senza eccedere in modo colposo. E si prescrive – quel che è più impressionante, a chi non si col lochi dal punto di vista dell'Evangelo – che l'aggredito può ue ( 1) 1 § 1 D . I, 1. 6 Salvatore Riccobono cidere solo “ si aliter periculum effugere non potest ,. Qui s'impone dunque, che l'uomo deve fuggire, di fronte ad un ' agressione e, se può cosi liberarsi, non ha diritto di reagire . La massima fu svolta da S . Tommaso . Se ne dedusse, e se ne deduce, che l'uomo non può reagire, con offesa alla persona dell'aggressore, per difendere i beni. Questi problemi erano fino a pochi anniaddietro discussi nelle dottrine penali. In essi si specchiano, come ora sappiamo, due cor renti etiche opposte : quella romana e quella cristiana. . Un altro caso affine è illustrato da S . Ambrogio. Il quale dice (1) : vidi a feneratoribus teneri defunctos pro pignore et negari tumulum , dum fenus exposcitur. Danque, i creditori impedivano la seppellizione del cadavere del debitore e lo tenevano in pegno. S. Ambrogio attesta ancora l'uso, in Italia , vivo a suo tempo. Esso si riscontra in varî diritti primitivi, per la natura stessa del vincolo dell'obbligazione, che si considerava un vincolo della persona del debitore (cioè del corpo). L 'uso è riprovato e vietato da Teodorico ($ 75 ) e ripetutamente da Giustiniano. Ma già in tutto quel che si riferisce al diritto dei sepolcri le innovazioni sono profonde nella codificazione di Giustiniano rispetto al diritto pagano, fino al punto che la seppellizione dei cadaveri, che era ritenuta nel mondo classico un dovere semplicemente fa miliare, ora è ordinata come un dovere totius humanitatis (2). Si eb bero cosi la istituzione dei cimiteri e il culto dei morti sulla base dei dommi della novella religione. Sul proposito , anzi, noi riscon triamo nei Digesti una massima, che fu inserita in un testo di Papiniano e rivela il rapporto che il legislatore cristiano stabilisce tra diritto e religione – ius et religio - . Il testo dice : fr . 43 D . XI, 7 : nam summam esse rationem , quae pro reli gione facit. Dunque, la religione va avanti al diritto . Mentre, nel sistema del diritto classico , rispetto al caso esaminato , è il ius civile che vince; dacche se il proprietario del suolo non aveva consentito la tumulazione, il luogo non diveniva sacro, e il cadavere poteva es sere buttato via , senza alcuna considerazione. ( 1 ) de Tobia X , 36 , 37. ( 2) fr. 14 § 7 D . XI, 7 . L ' influsso del Cristianesimo sul diritto romano - - - Ma il problema del rapporto tra stoicismo e cristianesimo, a riguardo della nostra indagine, presenta aspetti molto complessi e delicati, precisamente nei casi, molto frequenti, in cui l' uno e l'altro fattore cooperarono al nuovo orientamento del diritto . Per spicuo in .proposito è il divieto di atti emulativi, di cui fu fatto cenno sopra. Qui, senza dubbio, la morale stoica aveva offerti spunti notevoli di formulazioni teoriche e d' esempi. Così Antonino Pio a favore degli schiavi, con la celebre motivazione : male enim nostro iure uti non debemus (Gai 1, 53); e Celso contro la distruzione di cose e valori, in un caso bensì tutto speciale , ma con un motto di grande potenza, che esercitò in ogni tempo grande influsso : neque malitiis indulgendum est.. . . . nihil laturus nisi ut officias (38 D . VI, 1). Che siffatte celebri massime siano state dichiarate spurie e svalorate dalla critica contemporanea, non ha importanza ; dacchè ciò prova semplicemente che essa è ancora tutta dominata da quei falsi canoni dottrinari tramandati dagli Umanisti, di cui ho detto più sopra. E vero , all'opposto , che le applicazioni sporadiche, e per casi particolarissimi, d ' una nobile dottrina espressa dallo stoicismo, si composero più tardi, sotto l' influsso dell' etica cristiana, in una dottrina generale ed elementare, che limita l' arbitrio del proprie tario a vantaggio d ' interessi sociali e umani. Nel diritto giusti nianeo, infatti, il divieto ha una portata generale e formulazioni teoriche saldissime. Questi esempi servono a indicare le grandi prospettive del nuovo diritto , in quanto esse rispecchiano l'azione dell'etica cristiana . L ' indagine ha pertanto molto da scrutare e da porre in luce, per risolvere i grandi problemi dell' evoluzione del diritto romano, che finora non poterono essere affrontati. Certo , oggi non siamo ancora in grado di riassumere in un 'opera lo sviluppo delle istituzioni giuridiche da questo punto di vista . Risultati generali, che presuppongono compiuto l'esame sui testi ed elaborato tutto il materiale, non sono possibili ancosa in questo campo. Non lo sono, come io credo, in nessun ramo del diritto romano; il quale ha bisogno di una rielaborazione dottrinaria fatta ora in base alla critica dei testi. Perciò non giova riferirsi alle formule che sono nei manuali. Noi dobbiamo invece trarre espe rienze e insegnamenti direttamente dai testi, mediante il lavoro 78 S . Riccobono - L ' influsso del Cristianesimo sul diritto romano comune sulle fonti. Le discussioni, che si fanno e che si son fatte in proposito abbiam visto che non prospettano la verità, e ne rendono più complicata e difficile la comprensione. Perciò ritor niamo alle nostre fonti; abbandonando tutte quelle discussioni che richieggono un inutile sforzo di memoria e facilmente c' inducono in errore. S ' intende che per una trattazione larga della materia è ancora necessaria una adeguata preparazione e ripetute indagini sulle fonti. Ed in primo luogo occorre indagare tutto quel che possono offrire in proposito le opere letterarie, religiose dal III sec . in poi. Tutto questo territorio di studi è appena sfiorato . Certo l’ in flusso del Cristianesimo sul diritto s ' è dovuto manifestare in modo precipuo nella giurisdizione dei vescovi (Episcopalis audientia ) (1 ). La quale certamente ebbe larga applicazione da Costantino in poi. Ne importa che la cost. di Costantino ad Ablavio del 331, che si trova nella raccolta delle 18 costituzioni fatta di Sirmondus nel 1631, sia falsificata o alterata sostanzialmente. Dacchè, è certo che i Cristiani, secondo il precetto di S. Paolo, avevano l'obbligo di portare le loro liti dinanzi al Vescovo. In un 'epoca cotanto triste i Vescovi dovevano offrire più garanzie che i tribunali, sui quali i potentiores avevano facile presa . Il largo uso della giurisdizione vescovile si può desumere pure dal libro di diritto Siro-romano (L ) $ 21, dove si dice : melius vero liberat vir servum suum vel ancillam suam coram επισκόποις et presbyteris. Per il nostro comune lavoro abbiamo ormai le direttive e la certezza che l' etica cristiana ha impressa nell'opera di Giustiniano un'orma profonda . (1) Osservazioni e rilievi in proposito offre lo STEINWENTER , in una disser tazione molto lucida e importante, inserita in Heisenberg Festschrift. HAMILCAR S . ALIVISATOS DOTTORE IN TEOLOGIA PROFESSORE DI DIRITTO CANONICO NELL' UNIVERSITÀ DI ATENE LES RAPPORTS DE LA LÉGISLATION ECCLÉSIASTIQUE DE JUSTINIEN AVEC LES CANONS DE L' ÉGLISE -- - - - - - - - -- -- - ---- - - - - - - - - - -- - SUMMARIUM Hac communicatione Professor Hamilcar S. Alivisatos demonstrare voluit imperatorem Iustinianum religionis solum sensibus ad editionem legum ecclesia stiearum , quae cum sanctis canonibus absolute consentiunt, impulsum esse. Hae tamen ecclesiasticae leges satis clare ostendunt voluntatem Imperatoris, qui auctoritatem civitatis consultis Ecclesiae dare voluit; utque consulta qualis cumque corporationis , quae in imperio erat, auctoritatem suam ex civitate haurire solebat, sic etiam Ecclesiae consulta. Praeter hunc Caesaropapismum legum datio ecclesiastica Imperatoris Iusti niani plane demonstrat possibile esse Ecclesiam absolute et congruenter eum ci vitate collaborare. La législation ecclésiastique chez les Byzantins avait deux mo biles principaux . Le premier s' explique par la situation qu' occupèrent les em pereurs byzantins, dès Constantin le Grand, dans l' Église chrétienne, situation qui, en essence, ne diffère en rien de celle des empereurs romains dans la religion païenne. Constantin le Grand, investi comme empereur romain de la qualité et du titre de “ Pontifex Nascimus , dans la religion païenne, ne pouvait concevoir sa situation dans la religion nouvelle de l' État autrement que sous la forme d ''Eniouonos TÔV ÈXTOS (1). L ' intérêt organique de l'empereur pour la religion de l'État demeura le même lorsque l' empereur devint chrétien de facto, lors - que, par lui principalement, l' État devint aussi chrétien et l'Église chrétienne fut élevée au rang d ' Église d 'État. Cela fait, qu’ ent légiférant pour l' Église , Constantin le Grand et les empereurs by zantins qui lui succedèrent ont manifesté l' intérêt naturel qu ' ont tonjours eu les empereurs, comme chefs et représentants de l'État, pour la religion de celui-ci, qu ' elle fut païenne d' abord, ou chré tienne ensuite. Tant sous sa première que sous sa seconde forme, la religion faisait partie intégrante de la vie et de la fonction de l' État; elle se rattachait à la vie publique et faisait par conséquent l' objet de la sollicitude immédiate et du vif intérêt de l' État et de son principal représentant l'Empereur. (1) EUSEBIUS, De vita Constantini, IV 24 . Hamilcar S . Alivisatos Le premier mobile de la législation ecclésiastique était donc purement politique et avait, plus généralement, pour objet la ré glementation législative des affaires de l' Eglise, qui constituaient une manifestation importante de la vie publique. Le second mobile, politique aussi, avait, pour ainsi dire, un caractère plus spécial, et il s' explique par la conception dominante de la suprématie de l' autorité étatique. Pareille à celle des temps modernes, la conception romaine et byzantine de l' État est que celui- ci, par le moyen de son pouvoir législatif et exécutif, con centre en lui, comme autorité suprême, tout pouvoir et toute force. C ' était et c' est un axiome que toute autorité et toute force émane et découle de l'autorité même de l' État. Tout autre organisme, quel qu' il soît, vivant dans l' État tire sa force et son autorité de l' État. Et seule l'autorité partielle protégée par l' État peut avoir existence légale dans l' État. D ' après cette conception , l' Eglise , organisme vivant et se développant dans l'État, constituant même, en raison de sa force et de son ascendant moral, une fraction très importante de la vie publique, a elle aussi besoin , à côté de son pouvoir spirituel et divin , intérieur pour ainsi dire , de l'autorité extérieure de l' État pour pouvoir subsister et exercer sans encombre son influence. L ' Eglise elle-même n ' a pas ni ne doit avoir les moyens extérieurs de pratiquer la contrainte matérielle à la fin d ' imposer librement et progressivement son entité . Les forces dont elle peut avoir besoin à cet effet lui sont volontiers fournies, no tamment à l' époque byzantine, par l' État, en tant qu' il admet et reconnaît que l'Église, constituant une fraction essentielle de la vie publique, peut contribuer, par un fonctionnement adéquate , au pro grès de l' Etat et, plus généralement, à gagner par son intermé diaire à l'État et au profit de ce dernier, la bénédiction et, pour ainsi dire, l'assistance divine. D 'autre part l'État, qui ne confie à aucun autre organisme, même surveillé par ses propres agents, l' exercice en totalité ou en partie de son autorité étatique et de son pouvoir législatif, ne le fait pas même pour l' Eglise. Car celle-ci, légiférantmême sur mandat de l' État, pourrait, non par mauvaise intention mais par fausse appréciation souvent totale, de sa situation réelle vis-à -vis du facteur étatique, agir de façon préjudiciable aux intérêts de l' État et parfois même, inconsciemment peut- être, dans un sens subversif de l'ordre établi. Aussi l' État ne se contente-t-il pas d ' entourer sim Les rapports de la législation ecclésiastique etc . 83 plement de son autorité les diverses décisions de l' Église. Il pro cède à la législation ecclésiastique des détails, mais sans souscrire, par la répétition – superflue au preinier abord — des dispositions canoniques en vigueur, à l'éventualité d 'un exercice abusif de cette liberté par l'Eglise au préjudice de l' État et de l'ordre public . D ' ailleurs, en vertu du principe que tout pouvoir dans l' État dé coule de l' État, lorsqu' il institue des lois ecclésiastiques pour l'Eglise , qui est un organisme existant et vivant en lui, l' Etat leur donne, en les entourant de son autorité, la possibilité d ' une pleine application sous sa propre responsabilité. Il en ressort que le second mobile de la législation ecclésiastique, s' il est également politique, est de caractère plus positivement ecclésiastique, à cause de la nature de détail des lois concernant l' Eglise qui sont rendues par l' État. Certes cette action de l'État va, de la pleine adoption par le pouvoir législatif des conceptions de l'Eglise sur les sujets à régler par voie juridique, jusqu ' à l' institution par celui-ci de lois ecclésia stiques en contradiction avec des dispositions canoniques, qui ne sont pas toujours simples mais souvent fondamentales, et parfois même en contradiction avec des principes généraux du Droit Canon . Dans le premier cas, l' État doit faire preuve de grande fermeté afin de conjurer toute méprise de la part du facteur ecclésiastique sur le sens de la tolérance manifestée par l'autorité temporelle, et par conséquent toute velléité de l'Église à abuser de cette tolérance. Dans le second cas, le règlement, à l' encontre des dispositious canoniques, de divers détails de la vie , et surtout lorsqu ' il n ' y a pas mépris des disposition canoniques fondamentales et des prin cipes fondamentaux du Droit de l'Eglise , ne constitue pas toujours une manifestation d 'hostilité de la part de l'État, à l' endroit du facteur ecclésiastique. Au contraire, dans certains cas bien entendu, cela constitue précisément une intention et action amicale de la part de l' État. Car l' Église Orthodoxe du moins ne possède pas la faculté et l'élasticité nécessaires pour faire un usage immédiat de l' institution des conciles en vue de redresser les défectuosités et de modifier ou d ' abroger les dispositions canoniques tombées en désuétude ou devenues aujourd 'hui inapplicables. La dérogation de la législation ecclésiastique de l' État à ces dispositions canoniques ne se fait pas au préjudice de l' ordre canonique, du moment que l'Église aurait agi de même si elle avait eu une plus grande liberté de mouvements . Hamilcar S . Alivisatos La législation ecclésiastique de l' Empereur Justinien était en tous points conforme à la conception et à l'ordre de l'Eglise, et provenait incontestablement d ' un sentiment profondément religieux et ecclésiastique. La sollicitude et le soin apportés par Justinien dans l'établissement des lois ecclésiastiques et son effort pour que non seulement elles ne se heurtent en rien à l' ordre canonique établi mais soient en absolue conformité avec lui, dénotent le pro fond sentiment religieux et la vive conscience ecclésiastique qui guidaient l'empereur dans la rédaction de ces lois. Et leur nombre est plus que suffisant pour constituer un code ecclésiastique com plet (1). Chez Justinien surtout, mais aussi chez d'autres empereurs byzantins, les lois ecclésiastiques ont comme base et comme source, d 'une part ce qu' on appelle le césaropapisme, c'est-à -dire l' ex pression de la volonté et de l'autorité suprême de l'État même dans les questions ecclésiastiques; et, d' autre part, le désir d 'oc troyer à l' Eglise d 'Etat, par piété ou même pour la renforcer ex térieurement, une foule de privilèges qui la rendent extérieu ment toute -puissante, mais en même temps très faible entre les mains d 'un chef d 'État politique non animé de dispositions religieuses et ecclésiastiques. Le césaropapisme, qui s ' est principa Jement développé dans l' État byzantin , constitue une manifestation évidente de l'autorité de l' État s ' imposant à l' organisme ecclé siastique. A plus d ' une reprise l' Eglise a senti lourdement peser sur elle cette autorité de l' État, et elle a souvent payé très cher les privilèges qui lui avaient été prodigués et qui, plus ils étaient grands et importants, plus ils la liaient et l'asservissaient à l' État. Dans le cas de Justinien , par exception , à cause du sentiment religieux qui animait l'Empereur et de la conviction profonde qu' il nourissait en la nature sainte et sacrée de l'Église , l' intervention dans les affaires ecclésiastiques non seulement n 'avait pas le ca ractère de l' arbitraire absolu , mais constituait au contraire un im portant renfort pour l'Eglise dans toutes les manifestations de la vie ecclésiastique. La conscience religieuse de Justinien n ' est pas simplement attestée par les auteurs et les chroniqueurs de son temps. Elle ressort nettement de la façon dont il a traité les que (1 ) Voir, Hamilcar S . ALIVISATOS, Die Kirchliche Gesetzgebung des Kaisers Justinian I, Berlin 1913. Les rapports de la législation ecclésiastique etc 85 stions ecclésiastiques et qui dénote un profond respect à l' endroit de l'Église. Justinien est l'empereur du Ve Concile Oecuménique. Justinien est l'empereur- theologien qui, selon son chroniqueur, au lieu de tout autre délassement ou divertissement, passait ses nuits à étudier les ouvrages des Péres et à rédiger, avec l'aide d 'autres théologiens, ses propres ouvrages ; et ceux-ci par leur actualité et leur orthodoxie, sont comparables à ceux des maitres contemporains de l'Eglise (1). Justinien est enfin l'auteur de plusieurs hymnes liturgiques, dont la plus importante « Ο Μονογενής υιός και Λόγος του Θεού και est en usage encore aujourd' hui dans l' Eglise Orthodoxe comme hymne dogmatique (2 . Les expressions invoquant l' assi stance divine sur lui et sur son règne, que l' on rencontre dans ses lois et ses décrets, témoignent nettement du profond sentiment re ligieux qui animait le grand empereur ( 3). Et il dit lui-même: “ öti πρώτος και μέγιστον αγαθόν.... την ορθήν των Χριστιανών πίστιν ομολογείν τε και κηρύττειν..., όπερ δείκνυται εκ των παρ' ημών διαφόρων γραφέντων λόγων τε και ιδίκτων και (4). La phrase suivante , empruntée à une de ses dissertations théo logiques, met suffisamment en évidence ses profonds sentiments religieux et sa ferme conviction dans les vérités dogmatiques de l'Eglise chrétienne: « Ταύτα... εκ των θείων γραφών... διδαχθέντες... είκότως εγράψαμεν..... Ταύτην την ομολογίαν φυλάττομεν, εις ήν και εβαπτίσθημεν..... Τούτων γινώσκειν βουλόμεθα πάντας τους Χριστιανούς και (5). De même, les expressions que Justinien emploie (6 ), s'adres sant aux principaux représentants de l' Eglise, témoignent de son sincère attachement envers l' Eglise et ses autorités. Il affirme for mellement lui-même sa grande sollicitude pour l' Eglise et ses in (1) « " Ος ( Ιουστινιανός) δή κάθηται αφύλακτος ες αεί επί λέσχης τινός άωρί νυκτωρ, ομού τοίς των ιερέων έσχατογέρουσιν ανακυκλεϊν τα Χριστιανών λόγια σπουδήν έχων » (PRοcoPIUs, de Bello Gotthico III, 32 ed. Bonn, p. 409-410). (2) ALIVISATOS, Ibidem p . 13. ( 3) « ' Εν ονόματι του δεσπότου ημών Ιησού Χριστού του θεού ημών » Νον. 134 , Ed. ZACH. A LINGENTHAL p. 134 ; En Cod. Ι, 1, 6. « τον σωτήρα και δεσπότην των όλων 'Ιησούν Χριστόν τον αληθινόν ημών » Cod. Ι, 1, 6 Ed. KRUGER p. 10. « ' Εν ονόματι θεού και πατρός και του μονογενούς αιτου υιού 'Ιησού Χριστού του κυρίου ημών και του Αγίου Πνεύματος ». MIGNE p. 8. 86, Ι, col. 993-1035. ( 4) Νον. 132 Ed. LINGENTHAL. Vol. II p. 244. ( 5 ) MIGNE, P . G . 86I col. 1011 D -1013 Α . ( 6) MIGNE, P. G . 86 Ι. Col. 945-989 et col. 1045 Α . Hamilcar S . Alivisatos 86 stitutions, il exprime nettement sa conviction que du bon et cano nique fonctionnement de l' organisme ecclésiastique, il attend la bénédiction céleste pour le bien de l' État. Entre autres, cette phrase de la Novelle en est un bel aveu : « Ημείς τoίνουν μεγίστην έχομεν φροντίδα περί τε τα αληθη του Θεού δόγματα περί τε τηντων ιερέων σεμνότητα, ής εκείνων αντεχομένων πεπιστεύκαμεν ως δι' αυτής μεγάλα ημϊν άγα θα δοθήσεται παρά Θεού, και τα τε όντα βεβαίως έξομεν τα τε ούπω και νυν άφιγμένα προσκτησόμεθα και (1 ). On en retrouve faci lement le fond , sous cette forme ou sous une autre analogue, dans mainte loi de Justinien . Cette disposition religieuse de Justinien, comme fondement et mobile de sa législation ecclésiastique, explique suffisamment le fait que, comme empereur, Justinien non seulement admet sans discussion l'autorité des règles canoniques et attend de leur respect son salut et celui de son État (2) mais, comparant ces règles aux lois civiles, il leur donne une autorité égale et même plus grande, préférant les premières aux secondes et ne tolérant aucune divergence entre la légistation ecclésiastique de l' État et la législation purement canonique (3). Ainsi la préférence et la priorité données par Justinien à la législation canonique en cas de divergence ou de friction avec la législation étatique tranchent radicalement la question de son iden tité de vues complète et imperturbable avec la conception ecclé siastique. En d 'autres termes l' État doit coopérer étroitement et (1 ) Voir LIGENTHAL, I 45. ( 2) Ως τούς ολιτικούς νόμους.... βεβαίως διά πάντων φυλάττειν πρός ασφά λέιαντωνυπηκόων σπουδάγομεν, πόσω μάλλον πλείονα σπουδήν οφείλομεν θέσθαι περί τών των θείων κανόνων και θείων νόμων παραφυλακήν, των υπέρ των ημετέρων ψυχών σωτηρίας ορισθέντων; Οι γάρ τούς ιερούς κανόνας φυλάττοτες της του Δεσπότου θεού βοηθείας άξιούνται... και οι τούτους παραβαίνοντες αυτοί εαυτούς κατακρίσει υποβάλλουσι. Μείζονι δε υπόκεινται κατακρίσει οι δσιώτατοι επίσκοποι, οις πεπίστευται γητείν τούς κανόνας και φυλάττειν, είπερ τι τούτων παραβαινόμενον, ανεκδίκητον καταληφθείη ( Cod. Just. I, 4, 34, Ι, 3 , 45). Voir aussi Nov. 77, Ζ . a. L . Ι, 185. ( 3) « Τούς δε θείους κανόνας ουκ έλαττον των νόμων ισχύειν και οι ημέτεροι βούλονται νόμοι, θεσπίζομεν κρατείν μέν επ' αυτούς ,τα τοις ιεροίς δοκούντα κα νόσιν, ώς άν εί και τους πολιτικοίς ενεγέγραπτο νόμοις ». (Cod. Just. I, 3, 45). « Τών γας προειρημένων αγίων Συνόδων και τα δόγματα, καθάπερ τάς θείας γραφάς δεχόμενα και τους κανόνας ως νόμους φυλάττομεν... πλέον τοίνυν των νόμων τους κανόνας ισχύειν ανάγκη » ( Νον. 131) Ζ. a. L . ΙΙ , 267 a. Les rapports de la législation ecclésiastique etc. sans heurts avec le facteur ecclésiastique dans le même but supé rieur, qui est le salut spirituel des fidèles et l'assistance divine à l' Etat. Les rapports de l' Église et de l'Etat, fondés sur ces concep tions de Justinien, présentent manifestement la forme de la collabo ration absolue, réciproquement sincère et étroite, des deux grands organismes. Et il n ' y a point de doute que lorsque, par l' action stricte, sincère et exempte d ' arrière -pensée des représentants de ces deux organismes, se tenant, comme au temps de Justinien , à la hauteur de leur mission , cette forme de collaboration reçoit la di rection convenable, le problème compliqué et ardu des rapports de l' Eglise et de l' Etat trouve en même temps sa solution vraiment idéale. ALEXANDER BECK PRIVATDOZENT AN DER UNIVERSITÄT KÖNIGSBERG PR . CHRISTENTUM UND NACHKLASSISCHE RECHTSENTWICKLUNG BEMERKUNGEN ZUM PROBLEM IHRER GEGENSEITIGEN BEEINFLUSSUNG Roma · II SUMMARIUM Quod quaeritur quantum Christiana lex valuerit in iure colendo ante aetatem Iustiniani, id non nisi ex tota exeuntis antiquitatis historia ac ratione perspi citur. Christiani non modo ipsi cum mores et rationes tum iuris formas quae hisce temporibus vigebant acceperant sed etiam proprium in re publica locum ordinemque se obtinuisse censebant, quamquam hac in re aliter se habet in Oc cidente aliter in Oriente . Praeter locos certos et distinctos Christianam legem ipsam in iure privato aevi posterioris aliquid momenti habuisse non video. Den Einfluss des Christentums (1) auf die justinianische Ge setzgebung oder noch allgemeiner auf die nachklassische Rechtsent wicklung zur Debatte zu stellen , erweckt zunächst Bedenken me thodischer Art, solche vor allem , die sich aus der gegenwärtigen Lage der romanistischen Forschung ergeben. Ganz offensichtlich steht unsere Frage nahe am Brennpunkt des heutigen Bemühens um die Abgrenzung abendländischer Entwicklungsfaktoren in der nachklassischen römischen Rechtsentwicklung von den byzantinisch orientalischen . Sie nimmt des weiteren in dieser schwierigen und tiefgreifenden Auseinandersetzung insofern eine gewisse Schlüssel stellung ein , als die nachklassische Rechtsentwicklung niemals fruchtbar gesehen werden kann ohne Bezug auf die Ordnung der sittlichen Werte, die das Wesen und die Ausrichtung des gros sen spätantiken Gesetzgebungswerkes bestimmt. Stellt sich doch auch andererseits heute scharf und schärfer die Forderung, das klassische Recht selber aus dem ganzheitlich -politischen Lebenszu sammenhang der Antike heraus zu begreifen und darzustellen ( 2). - - - - - - - -- - ---- - ( 1) Die Zitieruug patristischer Quellen geht im folgenden von der Wiener Ausgabe des Corpus scriptorum eccles. aus. Hierbei wird nur die Bandnummer des betreffenden Schriftstellers (also etwa Ambros . 2 . Bd . = Ambr . 2 ) und hie rauf Seiten und Zeilenzahl angegeben . Wo das Wiener Corpus nicht ausreicht, wird auf Migne (M ) zurückgegangen . ( 2) Der Ansatz Fustel de Coulanges' - vgl. dazu auch Mitteis, Antike Rechtsgeschichte und romanistisches Rechtsstudium 1917 S . 4 - ist wohl bisher am stärksten von Bonfante fortgeführt worden . Neue Wege zeigen sich von der deutschen Platon - und Aristotelesforschung her, die zu einer neuen , in ihrer 92 Alexander Beck Von hier aus gesehen könnte gerade unserer Sonderfrage im Kampfe gegen den pandektistisch -positivistischen Wissenschafts begriff des ausgehenden 19. Jahrhunderts eine grundsätzliche Be deutung doppelter Art zukommen : einmal in Bezug auf eine klä rende Abgrenzung der klassischen Rechtsordnung, sodann für die Erfassung eines etwaigen spezifisch christlichen Grundcharakters des byzantinischen Rechts. Wir stehen in der Rechtsgeschichte zweifellos im Beginn einer geistigen Bewegung , die auch zu einem vertieften Aufrollen der Rezeptionsfrage führen wird. Grundthemen der modernen romanistischen Forschung, wie der Inhaltswandel der aequitas, die Bezogenheit auf das Gemeinschaftsinteresse und die Lebenswirklichkeit des Volkes in der Gesetzgebung und der Auslegung der Rechtssätze, die Bedeutung von Generalklauseln ( 1) usw . erscheinen so heute in aktuellster Bedeutung. Sie sind alle schon in der rechtshistorischen Diskussion mit dem grossen Um bruch der Werte in Zusammenhang gebracht worden, der im spät antiken Staat zugleich mit der Entfaltung des Christentums beginnt. Bekanntlich sind insbesondere von einer modernen Forschungs richtung grundlegende Umwandlungen des nachklassischen Rechts auf die christliche Sozialethik oder auf das Eindringen kirchlicher Rechtssätze zurückgeführt worden. Man denkt sich das Eindringen christlicher Rechtsgestaltung in das staatliche Recht vermittelt durch das religiös bestimmte neue Rechtsbewusstsein , das durch die Lehren der Kirchenschriftsteller erhellt und geformt wird und insbesondere konkret sich gestaltet in der Rechtsprechung der episcopalis audientia . Einer der verehrten Leiter dieses Kongresses, Herr Professor Salvatore Riccobono, hat in mehreren Arbeiten durch den gewichtigen Ernst seiner Fragestellung die volle Auf merksamkeit der Wissenschaft wieder auf das bedeutsame Thema gelenkt und seine Ergebnisse in dem angedeuteten Sinn program Fruchtbarkeit von den Fachwissenschaften noch lange nicht erfassten Auffass ung der Antike führte (W . JÄGER, STENZEL U. A .; vgl. insbesondere auch das demnächst erscheinende Buch des Königsberger Philosophen Paul Heyse , Idee und Existenz; bedeutsam auch das Werk von Walter F. Orro, Die Göller Grie chenlands 1929 und neuere Werke aus 0 .' s . Schule. Für das röm . R . jetzt als Versuch auf eine nach Ihering so sehr vermisste Gesamtschau hin : Fritz Schulz, Prinzipien des römischen Rechts 1934. ( 1) Vgl. neuerdings im allgemeinem Zusammenhang : HEDEMANN, Die Flucht in die Generalklauseln : eine Gefahr für Recht und Staat 1933. Christentum und nachklassisehe Rechtsentwicklung 93 matisch - eindringlich formuliert. Unter dem Vorgang von Herrn Baviera , Pietro Bonfante u. a. haben audere italienische Gelehrte ebenso wie im ganzen auch die deutsche Forschung eine grundle gende Bestimmung des grossen Kompilationswerkes durch spezifisch christliche Einflüsse im Gebiet des Privatrechts und seiner Dogma tik , insbesondere also in den Digesten, verneint. Selbstverständlich wird auch von dieser Richtung der christliche Einfluss im Gefolge des Kirchenrechts, in Staatsrecht und Strafrecht und bestimmten Teilgebieten des Privatrechts, wo er ja (vornehmlich im Rechte des Codex und der Novellen ) oft in Gestalt neuer Rechtsinstitute mit Händen zu greifen ist, keineswegs bestritten (1). Die folgenden Ausführungen möchten einen bescheidenen Bei trag zum Problem der nachklassischen Rechtsentwicklung in der (1) Uebersicht über die Literatur am besten bei ROBERTI, Contributo allo studio delle relazioni fra dirillo romano e patristica etc. Sonderheft der Rivista di Filosofia Neo -Scolastica 1931 ; ferner etwa STEINWENTER ZSSt, Rom . Abt. 52 (1932) 412 n . 3 ,Kan. Abt. (1934 ) 1 ff. ; CHIAZZESE Ann . Palermo 16 (1931) 399 ff. In Bezug auf Straf- und Staatsrecht ist von Belang die Studie von Marchi, Studi Senesi 38 , 1924 ; öfters etwa auch FERRINI, Dirillo penale (so z . B . 415 n. 4 : Ausdehnung der Peculatsnorm auf Kirchengut durch Interpolation in D 48 , 13 , 4 , 1) , neuer dings in mehreren Abhandlungen VOLTERRA, etwa Studi Bonfante II, 113 tl'. Auch für das Familienrecht ist der kirchliche Einfluss anerkannt, vgl. statt vieler bei BONFANTE etwa Corso I, 298 ff. u . ö . ; GRAY, I diritto nel Vangelo e l' influensa del Cristianesimo sul diritto romano (1922) 99 ff. Die (lose ) Ank nüpfnug des justinianischen Seelteils an Augustin (Christus als frater und cohe res) macht wahrscheinlich SCHULTZE, Augustin und der Seelteil des germanischen Erbrechts 1928 . Vgl. dazu die eben erschienene Abhandlung von E . BRUCK in den Studi Riccobono : Kirchlich - sosiales Erbrecht in Byzans. Johannes Chry sostomos und die masedonischen Kaiser. - - Vgl. auch die verdienstlichen Zusam menstellungen der caritativen Institutionen Konstantins und seiner Nachfolger (Kinder- und Gefangenen fürsorge , Armenärzte , Steuerstufung usw .) bei COMBĖS, Doctrine politique de St. Augustin 170 Anm . Dabei ist aber auch die allge meine Ethisierung und Moralisierung, die sich etwa in den lateinischen beidni schen Inschriften nach Konstantin bemerkbar macht, stark zu beachten : vgl. den eindringlichen Exkurs bei LAQUEUR a. a. O ., Probleme der Spätantike 31 ff. Es ist jedenfalls stark in Rechnung zu stellen , dass eine allgemeine, nicht spe zifisch christliche Zeitströmung auch in der caritas und humanitas, dem Schutz der Schwachen usw . zum Ausdruck kommt. Dies wird auch von RICCOBONO , Corso Il 1934, 579 ff. in Erwägung gezogen . Die Anknüpfung « christlicher » Interpo lationen an klassische Gedanken vollzieht ineist mit Recht CHIAZZESE a. a. 0. Vorsichtig auch ARANGIO -Ruiz, Storia 357 ff. – Sehr viel patristisches Material zu allen Rechtsgebieten in der vortrefflichen Storia sociale della Chiesa von BE NIGNI, insbes. II, 2 (1915 ). Alexander Beck - - - - - -- -- - - Weise beizusteuern versuchen, dass eine Gruppe für das Problem gewichtiger kirchlicher Quellen (vor allem abendländische) erneu ter Prüfung unterzogen wird , soweit sie innerhalb eines allge meinern Zusammenhangs markante Bedeutung haben . Eine solche Darstellung will nicht mehr als eine vorläufige Skizze sein . Ange sichts der Ueberfülle des verstreuten Stoffs,um der Hervorhebung der Einzelproblematik willen , konnten die Brücken zur Institutionen geschichte nur vereinzelt näher herausgearbeitet werden . Auch sind selbst einem erweiterten Vortrag durch Zweck und Form enge Grenzen gesetzt. Für eine umfassende Untersuchung wären beide Beziehungsgrössen (kirchliches Recht und christliche Ethik aufder einen Seite , die Gesamtheit des justinianischen Rechts auf der an deren ) aus der ganz durchdrungenen Einzelheit heraus in einen weiten geschichtlichen Rahmen zu stellen -eine Aufgabe, die weit ins Neuland der Forschung hineinragt. Auch eine Auseinanderset zung (die eine solidere staats -und wirtschaftsgeschichtliche Unter mauerung bringen müsste) etwa mit der wertvollen Studie von Marchi ist nicht beabsichtigt. Eine befriedigende Darstellung des christlichen Gehalts des justinianischen Werks könnte aber letztlich nur durch den sicheren Nachweis geistesgeschichtlicher Entwick lungs- und Abstammungsreihen geleistet werden . Und eben hierzu fehlt es , da das antike Christentum selber eine durchaus komplexe (1 ) und in der Bildung begriffene Grösse ist , noch an den notwendigsten Grundlagen. Es fehlt auch heute noch ,trotz einzelner dankenswerter Ansätze (so neben Ferrinis und Rotondis Arbeiten vor allem Ro bertis Abhandlung in der Mailänder Augustin -Festschrift ) eine sy stematische Zusammenstellung der in Betracht kommenden Stellen aus der umfangreichen patristischen Literatur, eines “ Index , der die Forschung gewiss durch Rationalisierung der mühevollen Lek türe der Kirchenschriftsteller wesentlich erleichtern könnte (2). Ebenso erschweren die bekannten und oft beklagten Schwierig keiten des Quellenstandes, sowohl im Gebiete der kirchlichen wie der profanen Rechtsgeschichte , die Arbeit noch sehr. Ganz beson ( 1) So auch DE FRANCISCI, Archivio giuridico 93 (1925 ) 157 ff. ( 2) Damit unterstütze ich aufs wärmste den Vorschlag von Herrn Professor Roberti (vgl dessen Vortrag), möchte aber doch nicht verhehlen, dass mir die Gefahr einer vorschnellen Ausdeutung des Materials zu bestehen scheint. Hand in Hand mit der Sammelarbeit müsste wohl eine Reihe von Monographien in Angriff genommen werden . Christentum und nachklassische Rechtsentwicklung 95 ders vermisst aber auch der Jurist, der von der Patristik her an die Erforschung der nachklassischen Rechts - und Methodenge schichte herangeht, dass ihm die Sprach - und Philosophiegeschichte , namentlich auch die philologische Quellenforschung, so wenig si chere Stützpunkte bieten . Ich darf mir erlauben an den Appell zu erinnern , den wir hier von einem um die juristische Methodenge schichte so verdienten Vertreter der Altphilologie hörten (vgl. den Vortrag von Johannes Stroux ). Gerade die Patristik mit ihrem reichen dialektischen Gehalt würde zu einer methoden - und gei stesgeschichtlichen Erweiterung der Rechtsgeschichte vorzüglich beitragen können. Aber dass die Juristen hier noch sowenig getan haben , liegt nur zum kleinen Teil an ihnen selbst ; sie können allein nichts ausrichten. Um nur ein wichtiges Beispiel zu nennen : das so ausserordentlich fein verästelte Problem des Neuplatonismus wird erst seit kurzem behutsam von der philologischen Quellen geschichte her in Angriff genommen ( 1). Für die Kirchengeschichte besitzen wir allerdings jetzt in Erich Caspars grossangelegter Ge schichte des Papsttums (2) einen ganz kostbaren Wegweiser. Aber trotz allem wird die Forderung einer wirklich intensiven , frucht baren Bearbeitung der Patristik für die Zwecke der romanistischen Rechts - und Dogmengeschichte ,wie sie Contardo Ferrini, Giovanni Rotondi und Josef Partsch längst erhoben, voraussichtlich noch geraume Zeit Wunsch und Programm bleiben müssen . So dürfte die Besinnung über die Hilfsquellen der Arbeit es rechtfertigen , wenn im folgenden unternommen wird , nur für einige vereinzelte, aber u. E . wesentliche Entwicklungsreihen im Christen tum Beziehungen zur nachklassischen Rechtsentwicklung herzu stellen . Es soll dabei zunächst vom Endpunkt der Entwicklung, der justinianischen Kodifikation , abgesehen werden. Die Notwendigkeit dieser Methode ergibt sich hauptsächlich ausGründen , die mit dem (1) Vgl. WilLY THEILER, Vorhereitung des Neuplatonismus passim ; ferner jetzt die fur die Erkenntnis Augustins (dessen starke und bis ins Einzelne gehende philosophische Abhängigkeit von Porphyrius nachgewiesen wird ) grund legende Schrift desselben Verfassers : Porphyrius und Augustin , in den Schriften der Königsberger Gelehrten-Gesellschaft, geistesw . Klasse, 10. Jahr. (1933 ) Heft 1 ; Interessantes auch bei Ernst Benz, Marius Viktorinus und die Entwicklung der abendländischen Willensmetaphysik (in Forschungen zur Kirchen - und Geistes geschichte , hsg. v . SEEBERG , CASPAR und WEBER, 1 . Bd.) 1932 ; dazu jetzt THEILER, Gnomon 10 ( 1934 ) 493 tl'. ( 2) Der zweite Band ist jetzt eben (1934) erschienen . 96 Alexander Beck religiösen und rechtlichen Charakter des vorjustinianischen Chris tentums zusammenhängen. Man hat m . E . auszugehen von der his torischen Tatsache, dass das Christentum , bevor es durch Lehre und sittliche Norm einen Einfluss auf das römische Recht ausüben konnte, seinerseits durch die Denkweise dieses Rechts auf das stärkste bestimmt war. Die abendländische Kirche wurde um die Wende des 2. zum 3. Jahrhundert in ihrem innersten Gefüge lati nisiert, insbesondere ist sie durch die schöpferische Formkraft des Juristen Tertullian aus der pneumatischen Gemeinde der Heiligen für immer zu einer Rechtskirche geworden . Cypriau verbreitert den eheren Grundbau seines Lehrmeisters durch eine nicht minder schöpferische, grosszügige Kirchenpolitik , im langen , fruchtbaren Nachwirken seiner hochangesehenen bischöflichen Schriften. Dabei fällt als charakteristisch auf, dass die Kirche in ihrer rechtlichen Struktur bei Tertullian zuerst durch die Denkweise des Privatrechts bestimmt wird : obrigkeitliche — " staats- ” und “ verwaltungsrecht liche" - Elemente fehlen in ihr noch fast ganz und sind ihr je denfalls nicht wesentlich . Mit Cyprian, durch die Responsenpraxis der Päpste (bei der das Formular eine bedeutende Rolle spielt) (1 ) und nicht zuletzt als direkte und indirekte Folge der staatlichen Anerkennug und Privilegierung selbst, wird auch das inpere Gefüge der Kirche nun durch einen verwaltungsmässig -obrigkeitlichen Geist mitbestimmt (2 ). Der Glaube, zusammengefasst in der regula fidei, stellt sich seit der “ Verrechtlichung " der Kirche als lex fidei dar, von Gott einmal erlassen und unabänderlich geltend , in der textli chen Fassung als echte regula bis zu einem gewissen Grade varia bel. Sie tritt bei Cyprian zu Gunsten verfassungsmässiger Elemente des Kirchenbegriffes in den Hintergrund und wird dann durch die Kanones von Nikäa ersetzt als dem neuen Grundgesetz der Kirche, das nun interpretiert und nach Bedürfnis auch in üblicher Weise interpoliert wird (3 ). Neben die lex fidei stellt schon Tertullian ein (1) Vgl. etwa CASPAR, Geschichte des Papsttrems I, 322, 436 ff., 455 u. ö. (2 ) Vgl. dazu und zum Folgenden meine Schrift : Römisches Recht bei Ter tullian und Cyprian, in den Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft 7 . Jahr. 1930, Heft 2) passim ; Stutz, Kirchenrecht 290. ( 3) Vgl. etwa Caspar , Geschichte des Papsttums I S. 496 (Interpolation des Kanons VI von Nikäa), ferner S . 518 und Anm . 1, S. 523 , 527. Vgl. auch über Interpolationen in der hellenistisch - jüdischen Literatur Stählin , in Christs Griech. Literaturgesch. 1921, 2 . Teil, 1. Hälfte, 6 . Aufl. 1921, S . 609, 614 , 617. Christentum und nachklassische Rechtsentwicklung 97 Ordnungsgesetz, die lea: disciplinae, die praktisches Verhalten des Christen , Busse, Kult und Kirchenrecht ordnet. (Die Busse insbe sondere wird in abendländisch römisch -rechtliche Terminologie ge kleidet und dadurch schon früh in eine gewisse Parallele zur Praxis der Straf- und Privatrechtspflege gesetzt). Die lex disciplinae ist, wie die im Brauche verankerte Norm magistratischr Kognition, in ihrem Inhalt entwicklungsfähig , sie passt sich nach ausdrücklicher Defi nition Tertullians (1) den veränderten Lebensumständen der Kirche an . Jede religiöse Beziehung des einzelnen Christen zu Gott und Kreatur wird durch iura charakterisiert. Freilich bedeutet Christsein nicht vorwiegend persönliche Religiosität wie im modernen Ver stande, sondern nach echt antiker Auffassung Zugehörigkeit zur christlichen, durch den religiösen Nomos geschaffenen Genossen schaft. Ambrosius etwa steht deutlich in der von dem grossen Apologeten begonnenen Bahn, wenn er in neuer Formulierung des Verhältnisses zwischen Gutt und Mensch in ep . 41, 7 die Ursünde als eine durch Realvertrag, nämlich Darlehen, gegenüber dem Teufel eingegangene Schuld juristisch kennzeichnet. Die sündige Tat stellt das vom Teufel stammende aes peccati dar, das als Dar lehen in das Vermögen des Menschen übergeht. Die Darlehnsschuld vererbt sich von Generation zu Generation . Nun kommt Christus und erbarmt sich der schlimmen Lage des überschuldeten Men schengeschlechts . Er bezahlt mit seinem Blute die fremde Schuld . Und der Mensch , auf dessen Bitte hin Christus interveniert, wird nun Schuldner Christi, der ihm seinerseits die ganze Forderung erlässt: also Bezahlung seiner Schuld auf Grund eines Mandats und nachfolgender Erlassvertrag hinsichtlich der Rechte aus der Die unantastbare Stellung, die schon Leo der Grosse für Nikäa in Anspruch nahm , wird von Gelasius ( auf Chalcedon ausgedehnt und dann von F . Ferrandus (MIGNE PL 67 921 ff) auf die ökumenischen Synoden erstreckt - vgl. Caspar II 249, 261 ff. Nicht lange nach Augustin wird im Symbolum Athanasianum « Die Umbildung der Trinitätslehre als eines innerlich anzueignenden Glaubensgedan kens zu einer kirchlichen Rechtsordnung » abgeschlossen , an deren Beobachtung die Seligkeit hängt (HARNACK , Grundriss der Dogmengeschichte? 1931, 237). (1) virg. vel. 1 (OEHLER I 884); adv. Marcionem I, 21 (K KOYMANN 317 , 21) und dazu meine Ausführungen a . a . 0 . 55 . Alexander Beck actio contraria auf Auslagenersatz (1). Auch die trinitarischen For meln des Abendlandes gehören in diesen geistigen Zusammenhang. Die Reihe geht hier wiederum aus von Tertullian -Novatian . Trotz ihres dogmatisch verwischenden , die feinen Streitfragen oft gar nicht berücksichtigenden Inhaltsvermögen diese - im Orient meist belächelten oder feindlich abgelehnten – Formeln (2) das kirchliche Leben zu einigen und auszurichten . Letzten Endes beruhen sie auf derselben wirklichkeitsnahen politischen Kraft, die den römi schen Prätor einst zur kunstvollen, lapidaren Gestaltung seiner Prozessformeln befähigte . Für den profanen Rechtsgelehrten und Rechtspraktiker der nachkonstantinischen Zeit (wir haben uns zwar im römischen Kul turkreis das Eindringen des Christentums in die Beamtenaristokratie zunächst nur als ein äusserst langsames und kaum tiefgreifendes vorzustellen ) (3) musste eine auf Gott als unmittelbare Quelle zu rückgeführte kirchliche Rechtsordnung keine dem staatlichen Rechte durchaus wesensfremde Züge tragen . Das Kaisertum , das sich in (1) (M 1155 , vgl. auch das Folgende). Ferner etwa 2, 10, 14 ff ; 2, 12, 24 (manumissio : Christus patronus) ; ferner viele Stellen , wo Ambrosius von den Aposteln und Propheten als legis periti spricht (2 , 147, 20; 2, 360, 19 ; 2 , 59, 2 ; 1, 38, 19); in ep. 37, 4 M . 1084 wird vielleicht auf die Pauli sententiae ange spielt : Haec autem epistola . .. de sententiis Pauli esi apostoli qui nos a servitute in libertatem vocat. Vgl. auch (in Bezug auf den Apostel Paulus) 2, 12 , 6 : quis quasi idiotam Paulum vel in ipso iure adserit ? scivit discernere inter libertum et liberum et ideo non perfunctorie , sed proprie dixil ... mancipare ... patronus ... ) ; ferner noch etwa ep . 2 , 12 M . 882 : omnes mercennarii, omnes operarii (gegenüber Gott) usw .; Ambr. 2, 18 , 21 : Tanti igitur beneficii debilor non rependis obsequium ? . . . numera haec et adiunge non tam ad ad debiti nesum quam ad muneris accepli conservationem ; 2 , 325 , 13 : celebramus post domini passionem remisso culpae totius debito chirographoque vuculo ab omni neau liberi; 4 , 62, 5 ; nam si consules adscribuntur tabulis emptionis, quanto magis redemptioniomnium debuit tempus adscribi. habes ergo omnia quae in contractibus esse consuerunt, vocabulum summam illic potestatem gerentis, diem , locum , causam . testes quoque adhiberi solent; hos quoque nativitate suae et generationi secundum carnem Christus adhibuit, dicens « vos eritis mihi testes in Hierusalem » (Act. ap. 1. 8 ). (2 ) Typisch für diese Haltung sind die grossen Kappadozier. Vgl. etwa die or. XII Gregors von Nazianz, der sich über die Dürftigkeit des abendländischen Vokabulars lustig macht, das Ousia und Hypostasis nicht unterscheiden kaun. Dazu Caspar I passim unten 103 n . 1. (3; Dazu vor allem jetzt LAQUEUR, Das Kaisertum und die Gesellschaft des Reichs, in Problemeder Spätantike. Vorträge aufdem 17 . Deutschen Historikertag, Stuttgart 1930 . Vgl. unten 101. 99 Christenlum und nachklassische Rechtsentwicklung - - -- dieser Epoche als Quelle allen weltlichen Rechtes empfand ,trat selber ja mit der Prätention göttlicher Inspiration auf. Das zeigt sich bekanntlich besonders deutlich etwa bei Theodosius d. Gr. und Ju stinian (1). Es bestanden so , theoretisch und für sich genommen , die denkbar günstigsten Voraussetzungen für die Aufnahme kirch licher Soziallehren in das profane Recht, ebenso wie umgekehrt für dessen Einwirkungsmöglichkeit auf die Kirche. Alles hing von der Formstärke und dem rechtsgestaltenden Willen ab , den die beiden Grössen Kirche and Staat repräsentierten . Die stärkere Autori tät (2 ) musste der schwächeren (3) ihr Gepräge da aufdrücken , wo sie einander in derselben Kampfebene begegneten . Auf dem Gebiet des Rechts aber war im Abendland staatliches Recht, d. h. römisches Rechtsdenken , der gebende und formende Teil -Haupthese dieses Vortrags, die im folgenden erörtert werden soll. Im 4. Jahrhundert beginnt die Grenze zwischen praktischer Jurisprudenz und populärer Moralphilosophie von der letzteren her überflutet und verwischt zu werden. Die auf Spekulation, auf letztlich wurzelloser Theorie beruhende spätgriechische Staatsidee muss auch die kunstvolle Disziplin der Rechtslehre allmählich lockern . Trotz allem aber besitzt sicherlich das staatliche, offizielle Recht sowohl (1 ) Vgl. statt vieler etwa die Literatur bei Stein , Gesch , des spätrömischen Reiches ; VASIELIEV u . a . ; ferner Vogelstein , Kaiseridee - Romidee und das Ver hältnis von Staat und Kirche seit Konstantin , 1930 , (Histor. Untersuchungen hsg . V . KORNEMANN, VII). Den Uebergang zum Cäsaropapismus bezeichnet das Henoti cum des Kaisers Zeno v. 482 als einseitiges kaiserliches Glaubensidekt. Vgl. dazu jetzt CASPAR I 35 . Für Ambrosius (« imperator filius ecclesiae » u . a .) vgl. etwa ep. 21, 35 ; v . CAMPENHAUSEN, Ambrosius als Kirchenpolitiker passim . (2) Dass sich die abendländische Kirche am Ende des 5 . Jahrhunderts als selbständige rechtliche Grösse empfindet, zeigt zweifellos schon der Protest Felix III. gegen die Internierung seiner Gesandten durch Zeno. Das ius gentium , auf das sich der Papst als rechtliche Grundlage des Gesandtenschutzes beruft, braucht freilich nicht « Völkerrecht > zu sein , wie CASPAR II 36 (vgl. auch 32, 5 ) offenbar meint. Aber sicher spricht hier der Papst « fast international von Macht zu Macht » . Deutlich auch die bei CASPAR a . a . 0 . 34 n . 1 zitierte Gelasius-Stelle . Ueber den päpstlichen Jurisdiktionsprimat bei Gelasius 1 a. a . 0 ., 61 ff. ; ferner allgemein über das Verhältnis von Kirche und Staat (auctoritas und potestas) S . 66 ff. (3 ) Vol. allgemein über das Missverhältnis der kirchlichen zur weltlichen , d. h . der theologischen zur allgemeinen Bildung von SCHUBERT, Geschichte der christlichen Kirche im Frühmittelalter 1921, 06 ff. Mit Recht weist RICCOBONO, Corso II 626 nachdrücktich darauf hin , dass bis zu Theodosius II die abendlan dische Rechtskultur ohne ieden Zweifel lebendiger ist als die orientalische. 100 Alexander Beck aus der literarischen Ueberlieferung der klassischen Zeit (die gerade, weil sie in vereinfachenden , dürftigen Grundrissen schulmässig gepflegt wird , sich in dem beschränkten Masse auch umso starrer und schülerhafter bewahrt ) als auch durch die Notariatspraxis und das Formular im allgemeinen eine nicht zu unterschätzende Festig keit. Und wenn die Popularphilosophie als Ausdruck der neuen völkischen, religiösen und politischen Gegebenheiten des Reichs (das in vielen Beziehungen ein mosaikartiges, innerlich kaum geglie dertes Nebeneinander geworden ist) auch in der Jurisprudenz auf lösend wirkt, sie steht als Ausdruck der weltlichen Bildung für unsere Betrachtungsweise, die Christentum und staatliche Rechtskul tur einander gegenüber setzt, trotzdem eherauf der Seite des Staates und der Rechtswissenschaft. Das heisst: methodisch muss man m . E . von dem Grundsatz ausgehen , dass für alle neuauftretenden Rechtsbildungen, sofern ihre spezielle christliche Herkunft nicht strikte nachweisbar ist, die Vermutung für einen Zusainmenhang mit der Rechtslehre und den allgemeinen philosophischen Zeitströ mungen spricht ( 1). Die Notwendigkeit eines solchen Ausgangspunk tes ergibt sich insbesondere angesichts der Tatsache, dass die abend ländische Kirche selbst bei Augustin noch keine eigentliche christ liche Soziallehre ausgebildet bat (2). Nur erste Ansätze dazu sind im Westen vorhanden in der Einführung der ciceronianischen Pflich tenlehre in deu christlichen Bereich durch Ambrosius; aber gerade (1) Der Mangel einer Darstellung der antiken Staats und Volksreligion macht sich gerade hier besonders fühlbar so etwa auch Salid , Civitas Dei 237 Note zu 145); sie ist in Aussicht gestellt von Wilh . WEBER. Roberti hat vor allem in seiner Abhandlung in der Mailänder Augustin -Festschrift auf den mög lichen Zusammenhang von Patristik und nachklassischem Vulgärrecht hinge wiesen ; hier ist aber, angesichts der dürftigen Vergleichsmöglichkeiten , m . E . äusserste Vorsicht am Platze. (2) Vgl. unten S. 102 Anm . 2 ; anders alles offensichtlich bei Justinian , wo die bisher nur moralische oder religiöse Norm zu einer solchen des Rechtes wird , am deutlichsten in seinen « Kirchenordnungen » und im Strafrecht. Vgl. etwa v . SCHUBERT a. a . 0 . S . 101 f. MARCHI a . a . 0 . ; auch der augustinische Seelteil, der aus einem « Moralgebot für juristisches Handeln » (SCHULTZE a . a . 0. 188) bei Justinian zu einer Rechtsnorm wird, ist hier einzureihen. Damit tritt aber etwas durchaus Neues , Revolutionäres auf, für das es im Abendland keine Vorstufen gibt, es sei denn der konstantinische Gedanke, der der episco palis audentia vielleicht ursprünglich zu Grunde lag, dass die Bischöfe secun dum legem christianain urteilen und so neues materielles Recht setzen sollten . Christentum und nachklassische Rechtsentwicklung 101 hier zeigt sich, das die Kirche, die als solche forma iustitiae (1) ist, in ihrer noch vorwiegend jenseitigen gerichteten Haltung auf die materielle Gliederung und Durchdringung weltlichen Zusam menlebens wenig Wert legt und auf der andern Seite die staatliche Rechtsordnung als solche grundsätzlich unberührt lässt (2 ), ja sie von ihrem Standpunkt aus unbefangen als Teil der Schöpfungs ordnung betrachtet. Gerade die zahlenmässige Geringfügigkeit des christlichen Ele ments noch in der Mitte des 4. Jahrhunderts fällt für eine vorsich tige Bewertung des christlichen Einflusses auf das abendländische Rechtsleben entscheidend insGewicht (3). Wenn man der neuesten (1) Ambrosius de off. min . 129 (142, M . 65 : Ecclesia autem quaedam forma iustitiae est. Commune ius omuium . : Das steht im engsten Zusammenhang mit dem überall wiederkehrenden Grundthema der Schrift des Ambrosius, dass die christl. fides, das Christus dass fundamentum iustitiae sind. Vgl. Näheres auch unten S . 24 f ; zum Terminus forma FALLETTI, Mél. Fournier 219 ff. (2 ) Als typisch für die christliche Umwandlung erscheint indessen , dass bei Ambrosius die iustitia sich nicht mehr wie bei Cicero (vgl. etwa de officiis I 53) vornehmlich auf die civitas, die res publica als eigentlichen Kern der mensch lichen Gemeinschaft bezieht, sondern auf. das genus humanum schlechthin und die Kirche; vgl. etwa auch die Ehedefinition Ciceros als seminarium rei pu blicae und demgegenüber etwa Tertullian ad uxorem I, 2 (Oehler 1 671) : semi narium generis humani und ähnlich ad Marcionem I. 29 (dazu Beck a. a . 0 . 100 ). Die Bruderschaft in Christo tritt deshalb an Rang grundsätzlich vor die Fa milie (Ambr. De off. I 30 (144) M . 65 : domestici fidei ; andererseits aber doch auch wieder ein praktischer, durch die Tradition gegebener Vorrang der Pflich ten gegenüber den Verwandten in (144) M . 67 : Melius est enim ut ipse sub venias tuis, quibus pudor est ab aliis sumptum deposcere etc.). Für die Stellung zum staatlichen Recht aufschlussgebend sind die Ausführungen De off, inin . II, 29 (148-151) M 143-144 . Es handelt sich da um die Konfiszierung der von einer Witwe zur Aufbewahrung angenommenen Deposita bei der Kirche durch den Staat auf Grund eines kaiserlichen Reskripts. Iu den Gegenargumenten wird die formale Rechtsgültigkeit des Vorgehens nicht bestritten, aber doch deutlich ein Widerstandsrecht von Ambrosius behauptet; eine nicht uninteressante Parallele zu seinem Vorgehen in der Frage der Arianerkirche, die noch viel stärker (da es sich hier doch um reines Privatrecht handelt ) in die politische Rechtssphäre eingreift. Aber man darf nicht vergessen , dass der allmächtige Ambrosius An sprüche durchsetzen konnte , wie nach und vor ihm keiner. Andrerseits zeigt sich bei Ambrosius auch deutlich das Bestreben , konkreten juristischen Frage stellungen , wie etwa in der Frage der Preisbestimmung beim Kauf (vgl. unten S. 18,2 ) auszuweichen . Viel patristisches Material über die (passive) Stellung zum ungerechten staatlihcen Gesetz bei BENIGNI a. a . 0 . II 2, 54 ff.; cf. unten 25, 1. (3) Vgl. die Ausführungen über die episcopalis audientia uuten a. E. 102 Alexander Beck Forschung folgt, so betrugen die Christen zur Zeit Konstantins höchstens 10 % der Gesamtbevölkerung ( 1 ). Aus dem Zeitalter des Ambrosius und Hieronymus weiss man , dass das heidnische Element in der römischen Gesellschaft noch lange überwog, dass zu Ende des 4 . Jahrhundeets eine römische Restaurationsbewegung einsetzt, die sich durch einen starken Widerstand der Gebildeten gegen das Christentum kennzeichnet. Dasselbe traditionsbewusste Römertum setzt sich im 5 . Jahrhundert dann in Kirche und politischer Verwaltung durch , nach zwei Fronten hiu kämpfend, lateinisch -abendländisch gegen die Griechen und reichsrömisch gegen die Barbaren (2 ). Für unsere Problemstellung ist ferner die tatsächliche Abspal tung der beiden Reichshälften voneinander , die geistige und kul turelle Sonderentwicklung von Ost und West, als wesentlich stärker wie üblich zu betonen. Soweit eine Rezeption griechischer Gedanken erfolgt (und alle abendländischen Kirchenschriftsteller sind bei den Griechen, die ihnen als theologische Exponenten der neuplatoni schen Wissenschaft auch die wissenschaftliche Theologie ver mittelten , irgendwie in die Schule gegangen (3 )), so geschieht dies nur in relativ seltenen Fällen in quellenmässig unmittelbarem Auf nehmen , meist durch Vermittlung lateinischer Zwischenquellen . In aller Regel aber findet durch diesen Prozess im Letzten eine Um bildung ins Römische statt, kein passives Uebernehmen. Das gilt selbst für Hieronymus, den Gelehrtesten der Abendländer. Insbeson dere bei Augustin hat man sich vor Augen zu halten , dass es nicht philosophisch -spekulative Ziele sind, die ihn vornehmlich bestimmen (auch keine eigentlich theologischen oder religionsphilosophischen ), sondern vielmehr apologetisch - und propagandorisch -praktische (4 ). (1) Vasiliev, Histoire de l' Empire Byzantin I 1932, mit reicher Literatur ; dazu noch etwa BENIGNI, a . a . 0 . (2) Vgl. über den massgebenden Einfluss der römischen Aristokratie auf das römische Kirchenregiment im 5. Jahrhundert CASPAR, Gesch, des Papsttums Il 25 ff. ; andrerseits von SCHUBERT, a . a . 0 . 71 ff., über das Heidentum zur Zeit Justinians S. 105 . (3 ) Vgl. etwa HARNACK , Grundriss der Dogmengeschichte, 7 . Aufl. 1931, 228 ff. ; über das einheitliche Bild der abendländischen Trinitätslehre S . 236 ff. ; die Einheitlicbkeit des abendländischen Christentums überhaupt S . 290 -91 . (4) Die Ansicht von der philosophischen Selbständigkeit Augustins in auch rechtshistorisch wesentlichen Punkten der christlichen Lehre ist m . E . erschüttert worden durch die Schrift von Willy THEILER , Augustin und Porphyrios 1933, in Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft, Geistesw . Kl. X 1933 ins Christentum und nachklassische Rechtsentwicklung 103 Er wendet sich nicht an den griechisch Gebildeten , sondern an den durchschnittlichen Abendländer, ja oft an die grosse Masse und ordnet diesem Zweck Thema und Gestalt seiner Schriften bewusst und kunstvoll unter (1). Einer unmittelbaren Rezeption griechischer Ideen und Spekulationen werden im nachklassischen Zeitalter aber auch durch Sprachschwierigkeiten elementare Hindernisse entge gengesetzt. Es ist einfach so, dass die abend - und morgenländische Hälfte des Reiches sich nicht mehr sprachlich verstehen . Auf den Verhandlungen der Reichskonzilien verkehren die abendländischen Delegierten nur inühsam mit ihren orientalischen Kollegen durch besondere etwa S . 24 : « Der oft betrachtete voluntative Zug der augnstini schen Ethik stamint ganz und gar von Porphyrios » ; S . 10 : « Porphyrios bat diesen Kosmos (Platos) eigentlich anthropozentrisch gemacht; nicht auf den Ideen wie bei Plato, nicht auf den hinterweltlichen Seelen - und Geistesschick sal wie bei Plotin , sondern auf dem innern Heil... des durch sein Inneres, den εντός άνθρωπος dem νοητός κόσμος verbundenen Menschen ruht vor allen der: Blick des Porphyrios ; S. 20 : im Zusammenhang mit der stoischen voluntas, Igoaigeois , ist es die Blickrichtung der Seele , die bei Porphyrios besonders be tont wird » . Diese wichtigen Ergebnisse sind auch für den Juristen insofern be deutsam , als sie endlich Licht in die Entwicklung der juristischen Willenslehre werfen , die , soviel heute zu sehen ist, jedenfalls nicht spezifisch christlich beeinflusst ist (vgl. etwa auch unten 292 zu Marius Viktorinus). Ueber die Grund linien der civitas dei vgl. insbesondere das immer noch gültige gründliche Buch von SCHOLZ, Glaube und Unglaube in der Weltgeschichte S . 10 ff. Für Au gustin ist zwar in echt römischer Problemstellung der Staat eine geschichtliehe Realität, aber er steht nicht wie Ambrosius selber in dieser Realität : er be trachtet sie als Neuplatoniker doch von aussen , vom Heilsziele aus. Seine civi tas dei ist deshalb keine politische Theorie und enthält keine christliche, ir dische Soziallehre. Vgl. insbesondere auch über das fehlende Organisationsmo ment in der civ. Dei FUCHS, Aug . u . d . antike Friedensidee (Neue Philolog . Unters. III, 1926 , S . 53). Die weitaus grösste Mehrzahl der rechtlichen Tatbe stãode, die Angustin berührt, betrachtet er ferner nicht von einer rechtlichen, sondern bloss von der religiös-moralischen Seite her, die die rechtliche Auffas sung unberührt lässt ; dieser Zusammenhang findet sich ganz ausgezeichnet her vorgehoben bei COMBÈS, La doctrine politique de Saint Augustin 1927 passim , und ist m . E . für die abendländische Patristik überhaupt charakteristisch . (1) Vgl. SCHOLZ a. a. 0 . 10 . Auch die Philosophie stellte sich seit dem ausgehenden 3. Jhdt auf die ethische Massenpropaganda und die volkstümliche Predigt als Hauptaufgabe ein (vgl. WENDLAND , Hellenistisch -römische Kultur, in Hdb. ó. N . T . 2- 3, 1912 ) 81 ff. ; ferner etwa ALFÖLDY, Die Vorherrschaft der Pannonier etc., in 25 Jahre Röm .-German . Komunission 1930 , 19 ff.) . 104 Alexander Beck Dolmetscher (1). Und werden diese Abordnungen zweifellos aus den besten und ge vandtesten Köpfen des abendländischen Klerus zusammengesetzt - wieviel ärger muss es um die Verständigung der Gemeinden untereinander bestellt gewesen sein ! Jedenfalls ist die Kluft zwischen den beiden Reichshälften als durchaus tiefe und wahrlich trennende zu denken . Im Zeitalter Justinians und seiner unmittelbaren Vorgänger ändert sich das Kräfteverhältnis insofern , als nun die östliche , aristotelische “ Scholastik , die von den neu autblühenden Schulen von Beryt und Konstantinopel (2) und der Gelehrtenschule von Antiochien ausgeht, die Geisteswelt beherrscht, aus der dann das justinianische Gesetzgebingswerk erwächst . Hier findet eine Regeneration vom neuen, östlich bestimmten Hellenis mus aus statt, der zu der vorgehenden abendländischen Entwick lung (3) in nur losestem Zusammenhang steht. Diesem östlich griechischen Kreise gehört insbesondere Leontius von Byzanz an , der hauptsächlichste Vertreter des neuen Aristotelismus und Scho (1) Vgl. zur allgemeinen Entwicklung jetzt vor allem LAQUEUR , a. a. 0 . Die feinen theologischen Unterscheidungen der Griechen etwa Basilius des Gros sen oder Gregors von Nazianz (vgl. über des letzteren Feindlichkeit gegen die römische Kultur etwa FLEURY, St. Grégoire de Nazianze et son Temps 1930 , 73 ff.) werden offenbar aus mangelndem Verständnis , nicht nur aus taktisch kirchenpolitischen Ueberlegungen fallen gelassen, trotzdem die Päpste oder eine so repraesentative Persönlichkeit wie Ambrosius diese Kirchenlehrer häufig zi tieren und von ihrem Gedankengut zehren über eine Einzelfrage, etwa Wil BRAND, Ambrosius und Plato , in Römische Quartalschrif 25 (1911) 42 ff. Auch Augustin sprach sich ja eine ausreichende Kenntnis des Griechischen ab. An dererseits bleibt das Lateinisehe im Osten bis zu Justinian die offizielle Hof sprache – eine Geste kaiserlichen Absolutismus, der sich nicht um die völki schen Grundlagen kümmert. - CASPAR , Geschichte des Papsttums 1 328 ff. ; Hahn , Sprachenkampf im römischen Reich bis auf die Zeit Justinians, in Philologus, Suppl. 10 , 1907, bes. 701 ff. ; G . KRÜGER , Handbuch der Kirchengeschichte I, 2 (1923 ) 132. (2 ) Vgl. über die Reorganisation der Schule zu Konstantinopel unter Theo dosius II VASILIEV a . a . 0 . 127 ff. ; über den Neo - Alexandrinismus und seine Wurzeln 151 ff., 159. Dass die Rolle der Rechtswissenschaft in der früheru Zeit noch sehr zurücktritt neben der Rhetorik , zeigt die geringe Zahl von ju ristischen Lehrstühlen an der konstantinopler Schule nach der theodosianischen Neuordnung: Neben 20 Grammatici ( 10 lateinischen und 10 griechischen ) 7 Rhe toren und Philosophien , waren nur 2 Juristen vorhanden. (3 ) Es ist im Abendlande auf kirchlichem Gebiet zu denken an die Schule gelehrter Bibelexegetik , die nach Hieronymus vor allem im Ainbrosiaster kräf tige und eigenartige Blüten treibt. In der Jurisprudenz versagen die Quellen . Christentum und nachklassische Rechtsentwicklung 105 lastizismus, der theologische Lehrer Justinians (1). Zusammenfassend muss man m . E , für die rechtsgeschichtliche Auswertung der Pa tristik betonen : es kann für Rückschlüsse auf das Abendland nur eine äusserst vorsichtige Haltung gegenüber den Quellen der grie chischen Patristik geboten sein . Man gelangt damit zur Aufstellung einer zweiten Arbeitshypo these : Finden sich in der griechischen Patristik Begriffe, die im justinianischen Recht eine Rolle spielen, so spricht die Vermutung dagegen , dass diese in der griechischen Patristik ausgedrückten Konzeptionen die abendländische vorbyzantinische Entwicklung beeinflussten (" byzantinisch " erst gebraucht für den Geist von Beryt und Konstantinopel). Die Beeinflussung wäre durch genaue, insbesondere quellengeschichtliche Nachweise immer zu belegen . Sonst hat man vielmehr davon auszugehen , dass es die neue griechi sche Scholastik war, die, zum teil aus der gleichen Ueberlieferung schöpfend wie die griechischen Väter, ihrerseits die neue Rechts wissenschaft bestimmte (2). Damit wird natürlich die Forderung nach einer genauen Untersuchung der griechischen Patristik auf Uebereinstimmungen mit den Byzantinern hin in keiner Weise fallen gelassen . Auf ihre von berufener Seite oft betonte Dring lichkeit kann nicht genug hingewiesen werden . In den folgenden Bemerkungen möchten wir uns in der Haupt sache auf die Betrachtung einiger rechtshistorisch zentraler Stellen aus okzidentalen Kirchenschriftstellern exemplifikatorisch beschrän ken . Die Abendländer bilden naturgemäss für die Untersuchung des Einflusses des Christentums auf die nachklassischen Rechts entwicklung eine Quelle von um so grösserer Bedeutung , je stärker sie im Geiste und der Praxis ihrer Umgebung verwur zelt sind. Und wenn eine wegweisende moderne Untersuchung den Unterschied zwischen West und Ost in der Rechtsentwicklung dahin festlegte, dass der Westen - von der Antike nimmt, ohne sich durch sie belastet zu fühlen , dass eine praktische Tendenz vorherrsche, die (1) Als Verfasser eines Teils der theologischen Traktate Justinians vermu tet von SCHUBERT a . a . 0 . 121 den Theodorus Askidas. (2 ) Dieser Schluss ergibt sich notwending auch aus der Tatsache, dass die Kompilatoren in Damasus pont. ( C . I , I , I pr.) nur einmal einem abendländi -schen K .-Schriftsteller , die griech. Väter aber häufig erwähnen; vgl. SAVAGNONE, Ann . Palermo XIV (1930) 134 f. Roma · II 106 Alexander Beck sich allenthalben simplifizierend auswirke” (1), so gilt dies ebenso für die kirchliche Sonderntwicklung . Als tragende Kraft offenbart sich im Abendland ein starkes, praktisch bestimmtes, römisches Selbstbewusstsein, wie es sich besonders eindrucksvoll etwa in den dogmatischen Episteln Leos des Grossen äussert. Wie schon angedeutet wurde ( A . 3 zu S . 14 a . E .), tritt diese traditionell gebundene Haltung des Westens auf kirchlichem Gebiet in ei ner, im ganzen gesehen, reinlich empfundenen Scheidung des Re ligiös -Philosophischen vom Bereich des staatlichweltlichen Rechts in Erscheinung. Es gibt auch nur relativ wenige Einzelstellen, an de nen, wie etwa in der Lehre vom iustum pretium (2) dem Seel (1) Levy, Westen u. Osten , in ZsSt. 50 (1930) 293. (2 ) Vgl. ALBERTARIO , Iustum pretium e iusta aestimatio , in BIDR 31 (1920) 1-19 ; L'arbitriumi boni viri nell' onerato di un fedecommesso, in Studi Zanzucchi (Pubbl. Sacro Cuore XIV 1927 s. 32. woselbst weitere Literatur). Die von Al bertario an beiden Stellen zusammengestellten Ambrosiuszitate, sind aber teils nicht überzeugend , weil zu allgemein , teils stammen sie wörtlich aus Cicero. Ich gehe sie der Reihe nach durch . Das allgemeine Gebot : iustus nihil alteri de trahendum putat, ne alterius commodo suum commodum augere velit (de off . min. 3, 2, 13), stammt aus Cicero de off. 3, 5, 21; Detrahere igitur alteri ali quill , et hominem hominis incommodo suum augere commodum mugis est contra naturam quam mors.. . de off. min . 3 , 6 , 37 : Pretiorum captari incrementa non simplicitatis, sed versutiae est ; ibid . 3, 5 , 41: De reditibus igitur glebae expe ctare debes tui mercedem laboris, de festilitate pinguis soli iusta sperare con pendia... stehen ganz offenbar im engstem Zusammenhang mit Ciceroe altrömi scher Hochschätzung der agricultura (de off, 1, 42, 153 i. f.) und der ebenso altrömischen Geringschätzung der tenuis mercatura (ihrer niedrigen Gesinnung wegen , vgl. Cicero a . a . 0 . 1 , 42, 150 : Nihil enim proficiant, nisi admodum metiantur) und illiberalen Berufe. Dass bei Ambrosius keine Ausnahme für die magna el copiosa mercatura gemacht wird , ist freilich typisch ; man wird hier die Begründung für die Zeit des Ambrosius nicht nur im völligen Fehlen eines grosszügigen , traditionsgebundenen , nationalen Unternehmertums (an das Cicero dachte), finden inüssen , sondern auch in einer ausdrücklichen Stellungnahme gegen kaufmännischen Tätigkeit (viele andere Stellen bei BENIGNI 318 ff.). Auf die Gesinnung , die auch Cicero bei der tenuis mercatura veraussetzt, kommt es dem Jailander Kirchenfürsten an, wenn er a . a . 0 . 3, 9 , 57 sagt : Nihil itaque deformius quam nullam habere amorem honestatis, et usu quodam degeneris mer caturile, questu solicitari ignobili, avoro aestuare corde, diebus ac noctibus hiare in alieni detrimenta patrimonii. Wie man in diesen Stellen mit Albertario einen Rechtssatz ausgesprochen finden kann , der den Gegensatz zum naturaliter con cessum ... in prerio emptionis et venditionis... invicem se circumscribere der Ju risten bilden soll, ist schwer einzusehen ; dasselbe müsste man für Cicero be Christentum und nachklassische Rechtsentwicklung 107 teil (1), der Willenslehre u. Ae., in der wissenschaftlicheu Diskus sion christliche Beeinflussung des Privatrechts behauptet werden konnte. Aber gerade an diesen so sehr in die Augen springenden Punkten – die Beobachtung hat m . E . allgemeine Gültigkeit --- kann von einer eigentlichen christlichen Rechtsbildung, in dem Sinne der Entstehung neuen staatlichen Rechtes aus dem christli chen Normenkreise heraus, nicht die Rede sein . Wo christliche Anknüpfungspunkle vorliegen, gehören sie dem Bereiche der kirch lichen Disziplin an , betreffen sie im vorjustinianischen Quellen bestand oft bloss moralischreligiöse Gebote selbst ohne kirchlichen Rechtscharakter. Mit staatlichen Zwang werden s" rst von Justinian bekleidet, der aus seiner abstrakt-spekulativen, „ totalen “ Staats haupten. Ausserdem ist nicht aus den Augen zu verlieren , dass de off. min . sich vornehmlich an die Kleriker wendet ; es besteht seit Cyprians Zeiten (BE NIGNI a . a . 0 . ; Beck 159 ff.) in der Kirche und später im Staat ein grundsätzli ches Verbot des Betriebs von Erwerbsgeschäften durch Kleriker, die nicht von der procuratio divina abgehalten werden sollen . Von grundsätzlicherer Bedeu tung als die von Albertario angezogenen Stellen erscheint zunächst Ambrosius 3 , 9 , 41 ff. im Vergleich mit Cicero 3 , 12, 50 , wo eine Kontroverse zwischen Antipater und Diogenes bezüglich der Kaufpreishöhe erwähnt wird. Soll ein vir bonus, der Getreide in das von einer Hungersnot geplagte Rhodos bringt, mit teilen müssen , dass andere Schiffe auch unterwegs sind oder darf er dies ver schweigen und einen höheren Preis für das Getreide so herausschlagen ? Anti pater sagt, dass die communis utilitas massgebend sein und der Kaufmann deshalb die Tatsache des baldigen Eintreffens weiterer Getreideladungen mit teilen müsse . Diogenes hält dafür, dass nach Zivilrecht nur eine Plicht zur Offenbarung von Sachmängeln bestehe und dass man bei des Antipater Auschau ung zu einer Gesellschaftsform gelangen würde, die keine Privatrechte mehr kennt : ista societas talis est, ut nihil suum cuiusque sit ? Konsequenter wäre es dann , der Kaufmano müsste sein Getreide verschenken . Ambrosius kommt dann typischerweise wie Cicero nichtauf die Frage nach einem pretium iustum hinaus, sondern auf eine a . doli, wobei er es als verwerflich bezeichnet de fume publica negotiari uud aus dem damnum publicum ein lucrum zu machen ; man müsse largitor frumenti sein , d . h . also es als Linderer der Not absetzen , nicht als preri captator. Insoweit ergibt sich eine Bestätigung der Ansicht JOSEF PARTSCH ' s, in ZSSC 42 (1921) 265 n . l, dass die Lehre vom iustuin pretium (ne ben Ansätzen in der spätrömnischen Höchstpreis -Praxis) in der aristotelischen Preistheorie der lootns ihre Hauptwurzel hat und erst in Beryt und Antiochien zur vollen Wirksamkeit gelangte ; zur Cicerostelle vgl. BESELER, Bull. 36 (1931) 345 . Richtig abwägend zum Gesamtproblem DE SENARCLENS, Mél . Fournier 685 ff . (1 ) A . SCHULTZE, E . BRUCK a . a . O . ; aucio bier wird vom Familienrecht, den piae causae, d. Sklavenrecht abgesehen (vgl. aber unten S. 31 f.). 108 Alexander Beck auffassung heraus Religion , Moral und Recht einander gleich stellt und miteinander unrömisch vermengt. Zweifellos ein grandioser Versuch der Bildung eines , christlichen “ Staates, und als solcher für das Mittelalter ein immer wirkendes Vorbild , aber krankend am innern Widerspruch und der synkretistischen Unzulänglichkeit der Gestaltung, jedenfalls aber im tiefsten Gegensatz zur abend ländisch -griechisch -römischen Geisteshaltung, deren wirkliche, tiefe Ganzheitlichkeit damit verlassen war. Die PA patristische Literatur des Abendlandes verkennt den wesent DIO lich verschiedenen Charakter der beiden Ordnungen demgegenüber niemals. Sie bestehen nebeneinander als verschiedene. Bereiche des Lebens und Seins, als die des Weltlichen und des Glaubens. Sie können , unbeschadet der höheren Ordnungsstufe des Religiösen , einander berühren, ergänzen und stützen. Die abendländische Kirche betrachtet das für sie in seiner Gültigkeit nicht zweifelhafte pro fane Recht weder als eine ihr völlig fremde noch gar als feind liche Macht, die sie von vornherein bekämpfen , umformen oder ignorieren müsste : eine fast zwangsläufige Folge der frühen Re zeption rechtlicher Elemente in die Kirche selber und ein Aus druck der überlegenen Position der weltlichen Bildung. Abgelehnt und als zutiefst sündhaft verworfen wird selbstverstàndlich das heidnische Sakralwesen und alles, was mit dem Götzendienst zu sammenhängt. Aber . selbst hier übernahm und übernimmt das immer noch im Werden befindliche Kirchenrecht, mehr oder we niger äusserlich, heidnische sakrale Formen und Begriffe (1), die jenigen insbesondere, die Gemeingut aller nach Katholizität stre benden religiösen Strömungen der Spätantike geworden waren . Was das weltliche Privatrecht angeht, so wird es unendlich oft – wieder deutlich seit Tertullian (2) – dem christlichen Recht gegenüber als ius naturale oder ius gentium betrachtet . Es wirkt beständig weiter als Vorbild für das kirchliche Rechtsdenken . Ge rade hierin erscheint der abendländische Ambrosius als typisch (3). (1 ) Vgl. BECK a . a . 0 . S . 131, 156 ff. ; W . WEBER , Röm . Kaisergeschichte u . Kirchengeschichte, 1929; STEINWENTER, in ZSSI (1934) weist in exakten Un tersuchungen die von der Kirche empfundene Einheit von kirchl. u. röm . R . . für den Prozess nach (z . B . 25 ff.) . ( 2 ) A . a . 0 . 60 . (3) Vgl. das unbefangene Nebeneinanderstellen etwa Ambr. 5 , 15 , 21 : custo diamus mandata domini et custodiamus omnia ; nam si quis unum mandatum custodiat et alium praevaricetur, nihil ei prodest .. . utique in uno convictus pu . Christentum und nachklassische Rechtsentwicklung 109 Aber gerade er steht am Ende der privilegierten Zeit der epicopalis audientia , an der historischen Stelle , wo in Verbindung mit dem starken kirchlichen Selbstbewusstsein auch eine ausgeprägte christ liche Lebens- und Rechtsordnung erwartet werden könnte . Dass das Bewusstsein der kirchlichen Aufgabe im Staat, ein wahrhaftes, verantwortungsvolles Gefühl der religiösen Würde, eine freudige Bejahung grosser seelenhirtlicher Aufgaben vorhanden war, offen bart nichts deutlicher als die edle Gestalt des Ambrosius selber. Wer nun aber auch nach reichen , mannigfaltigen Formen und Gedanken des neuen christlichen Rechtes, zumindest in der kleinbür gerlichen Lebenssphäre Ausschau hält, die vom Bischofsgericht um gestaltet werden mochte , kann zunächst nicht anders als der Ent täuschung Ausdruck geben (1). Zu rechtschöpferischer Tätigkeit hätte die episcopalis audientia ein Berufungs - und Exekutionspri vileg gar nicht nötig gehabt. Aber wollte sie überhaupt das Pri vatrecht umbilden ? Ich glaube nein : Die pneumatische, noch we sentlich aufs Jenseitige und die Wahrung des geistliches Kirchen friedens gerichtete Haltung des antiken Christentums stand dem nitur etiam legibus saecularibus nec prodest ei alterius criminis abstinentia , si in altero fuit deprehensus; 4 , 111, 6 : erat enim deforme liberos non habere, quod etiam legum civilium auctoritate multatum , promiserat eam filio suo Judas et diu pactarumo foellera distulerat nuptialium . per moram promissi defunctus est sponsus; ep . 40 , 15 (M . 1107): utcerte si iure gentium agerem (im Gegensatz zum religiösen Gebot) dicerein quantas Ecclesiae basilicus Judae tempore imperii Juliani incenderint. Duas Damasci. quarum una vix reparato est, des Ecclesiae, non synagogae impendiis...; Ambr., 4 , 15 :3, 3 : ita etiam a deo potestatum ordi natio, a malo umibitio polestatis. .. non ergo muneris aliqua culpa est... sed ad ministrantis actio . num ut de caelestibus ad terrena derivemus exemplum , dat honorem imperator et habet laudem . quod si quis male honore usus fuerit. non imperatoris est culpa sed iudicis. Die Zitate könnten beliebig vermehrt werden . Vgl. aus der reichen Lit , etwa noch SOKOI.OWSKI, Schr. d . Kgby . Gel. Ges. cit. 1924, 133. (1) Literatur bei WENGER, Inst. des röm . Zivilprozessrechts 333 ; STEIN WENTER, By: . Zeitschrift 30 (1929- 30) 660 ff.; jetzt vor allem zsst. KA 54 ( 1934) I ff. Auch etwa Augustin hat ganz offenbar nicht das Bewusstsein , in der ep . audientia neues christliches Recht anzuwenden , wenn er sich in De opere mop . 29 , 37 (M . 40, 576 ) beklagt, dass ihm der Erwerb juristischen Wissens unverhältnismässig viel Zeit wegnehine, dass der juristische Wert der Entschei dungen doch ineist wieder von den Parteien bezweifelt würde und dann dringend rät, sich doch lieber an die ordentlichen Gerichte zu wenden , wo wirklich rechts kundige Magistrate sitzen. (Vgl. weiter die letzte Aninerkung zu dieser Arbeit). 110 Alexander Beck grundsätzlich entgegen . Und wie die episcopalis audientia ihre staatliche Einsetzung der Unsicherheit und Verwirrung der weltli chen Rechtssprechung zum grössten Teil verdankt, so kann sie sich doch auch selber – und gar noch wider eigenen Willen – nicht über den unschöpferischen und matten Rechtsgeist des Zeit alters erheben (1). Man hat sich zweifellos Zweck und Art der bischöflichen Schiedsgerichtsbarkeit in engster Verbindung mit der bischöflichen Intervention , die damals in allen Zweigen der Ver waltung stattfindet, in den Grundzügen ähnlich vorzustellen wie diese letztere sich in den justinianischen Quellen darstellt : als Versuch der Einschaltung eines unabhängigen Kontrollorgans, das Missbräuche und Härten der Verwaltung (insbesondere auch der Strafvollstreckung ), Schäden des politischen und wirtchaftlichen Le ( 1) So bleibt, neben der Propagierung des Seelteils als testamentarische Bestimmung vor allem das Predigen der Kirche gegen das Zinsennehmen schon in der alten Kirche (vgl. Beck a. a . 0 . 109 ff.) als bewusstes, freilich erfolg loses Einwirken auf die Gestaltung des Privatrechts . Aber auch da geht die Kirche von der religiösen Seite aus an die Frage heran , nämlich vom meri tum -Erwerb durch Almosen . Vgl. etwa Ambr. ep . 19, 4 ( M . 983): Non dabis pecuniam tuam ad usuram . Ps. 14, 5 . .. nam ille supplantatur qui usurarum captat emolumenta . ltaque vir christianus si habet, det pecuniam quasi non re cepturus: aut certe sortem , quam dedit, recepturus. Habet in eo non mediocrem gratiae usuram . Alioquin decipere istud, est non subvenire. Quid enim du rius, quam ut des pecuniam tuam non habenti , et ipse duplum exigas ? Qui simplum non habuit unde solveret, quemadmodum duplum solveret ? etc . ; vgl. auch Ambr. 4 , 6 , 4 u . ö . Zur Zinsfrage auf den Synoden von Arles und Nikäa vgl. A . ESMEIN , Mélanges d 'histoire de troit et de critique 1886 , 303. GRUPE, ZSSt 46 ( 1926 ) 28 weist mit Recht darauf hin , dass selbst Bischöfe die Regel nicht als bindend ansehen . Auch die Stellung , die die Kirche seit Cypriansme ritum - und Almosenlehre gegenüber dem Reichtum einnimmt (der Christ nur Verwalter und Nutzer des Vermögens, das er zum Seelen heile gebrauchen soll ) ist allein durch den religiösen Gedanken vom freiwilligen meritum bestimmt. Vgl. aus Ambr. etwa 2 , 502, 16 (Basilius 285 C ) : custos ergo tuarum es, non dominus facultatum , qui aurum terrae infodis minister utique eius, non arbiter... vende potius aurun et eme salutem , vende lapidem eme regnum dei, vende agrum et eme tibi civitatem aeternam ; 503 : 15 : facit tibi debitorem patrem deum , qui pro munere, quo pauper adiutus est, fuenus exsolvit boni debitor creditoris... Auch bei Augustin wird nur der schlechte Gebrauch des Geldes verworfen (sermo 50 vgl. COMBĖS a . a . 0 . 96 , viele Stellen und Literatur auch bei ROBERTI, a. a . 0 . 356 ff ., BENIGNI 301 f. Der christliche « Eigentumsbegriff » ist nämlich ein rein religiöser, kein rechtlicher. Mit der Freiwilligkeit des meritums, dem Ueber-die Plicht-hinaus würde ja auch seine eigentlich christlich-religiöse Basis entfallen. Christentum und nachklassische Rechtsentwicklung 111 bens der zuständigen Behörde resp . Aufsichtsbehörde gegenüber aufdecken und auch unter Privaten ausserhalb des Rechtsweges ausgleichen und versöhnen soll (1). Die Anwendung weltlichen Rechts wird von den bischöflichen Schiedsrichtern gar nicht eigent lich gewollt ; aus Not nur, weil sie eben dem seinem Wesen nach jenseitig -pneumatischen christlichen Nomos keine Regeln entnehmen können und doch Streitigkeiten entscheiden müssen, lehnen sie sich an die Formen des bestehenden staatlichen Rechts an . Sie werden , wo es immer ging, schwierigere Entscheidungen möglichst von sich gewiesen haben , wo sie sich nicht im Zusammenhang mit der Kirchenbusse oder der geistlichen Gerichtsbarkeit präsentier ten (2). Ja, es kann auf Grund des bekannten Materials überhaupt ernstlich in Zweifel gezogen werden , ob sich die episcopalis au dienta praktisch überhaupt ausserhalb dieser beiden Kategorien . von Fällen durchgesetzt hat. Das wirkliche Verhältnis von staatlichem und religiösem Recht offenbart sich vor allem in Gerechtigkeitsbegriff der Patristik (3). Die Uebereinstimmung des Aequitas - Begriffes (4 ) der abendlän dischen Kirche, wie er insbesondere bei Ambrosius (5 ) und Au gustin erscheint, mit dem der ciceronianischen Rechtsphilosophie und der klassischen Rechtslehre ist schlechthin entscheidend ; eine unmittelbare, geradlinige Verbindung zu den Byzantinern lässt sich hier nicht nachweisen . (1) Vgl. etwa von SCHUBERT, a. a . 0 . S. 103 sub ß und y . Für Konstantin COMBÈS 170 , 1. Zum Amt des defensor civitatis , das oft mit dem bischöfl. zu sammenfällt, Marchi 99 ff ; 244 ff. (2) Vgl. Anm . I zu Seite 21 a. E . ; ferner die letzte Aumerkung zu dieser Arbeit. (3 ) Für Augustins Begriffsbestimmung der iustitia und aequitas die im eng sten Anschluss an Cicero steht, vgl. COMBĖS, a. a. 0 . 43 ff.; Fuchs, Aug. und . der antike Friedensgedanke, S . 88, aber auch S . 89. (4 ) Vgl. von den einschlägigen Arbeiten von F . PRINGSHEIMS jetzt vor al dem : Aequitas und bona fides, in Conferenze per il XIV Centenario delle Pandette (Pubbl. Sacro Cuore XXXIII, 1931) S . 193 ff. (5 ) Der auch in dieser Beziehung wie in seiner ganzen Lebenshaltung und verkennbar in der römischen Tradition steht. Vgl. etwa v . CAMPENAUSEN, Am brosius v . Mailand als Kirchenpolitiker (Arbeiten zur Kirchengeschichte XII) 1929, S. 24 ff. Augustin , verhält sich aber grundsätzlich in seiner Einstellung zum Staatlichen ebenso wie sein Lehrer, s. insbesondere COMBÈS, La doctrine politique de Saint Augustiu 1927 passim . 112 Alexander Beck Es empfiehlt sich (1), in der Untersuchung die verschiedenen Bedeutungen auseinander zu halten, die sich mit aequitas auch in der Patristik verbinden . DSie ie erscheint einmal, wie in der rechtsphilosophischen Tradi tion überhaupt (2 ) in der Bedeutung von iustitia als Leitstern für Gesetzgebung und Rechtsschöpfung, als , abstrakter “ (2) Masstab der Kritik , Grundsatz der Interpretation , als oberste Tugend (3 ) mit dem Inhalt des suum cuicque tribuere. Sie kleidet sich als (1) Auf das (als römisch stolz betonte) Moment der Rechtsgleichheit (ge genüber orientalischer Kastenordnung ) wird sowohl von Ambrosius (1 , 89, 3 ; ferner etwa 2 , 34, 22 : par debet esse circa omnes forma iustitiue zur Bekämp fung des biblischen Erstgeburtsrechts und Rechtfertigung Jakobs gegenüber Esau ) wie auch vor ihm schon von Laktanz (FERRINI, Opere Il 497 ; ROBERTI, alla Museo delle die oorlechisch a . a . 0 . 327 ) in Ankuüpfung an die griechische Philosophie hingewiesen , in der der Isotes als Masstab für die gleiche Behandlung die gleiche Würde zu grunde gelegt wird (vgl. etwa HAEGERSTRÖM , Römischer Obligationsbegriff 1927, S . 563; VINOGRADOFF, Outlines of historical Jurisprudence II 1922, 51 ff.; über die römische Umformung in ein obiektives, den Staat ordnendes Prinzip: SOKOLOWSKI, Schriften d . königsb. Gel. Ges. 1924, 125 ; Studi Bonf. I 186 f.) . Von der Sklaverei wird, wie in der frühen Kirche, su auch in der späteren Pa tristik als selbstverstäudlichem Rechtsinstitut gesprochen (zur frühern Entw . BECK, 924, 961, 139; für Ambrosius etwa 4, 143, 26 : qui tantus esset duæ, qui posset masculum et feminan , Judaeum et Graecum , barbarum et Scytham , ser vum et liberum uno regere ductu nisi Christus, für Augustin etwa Sermo 302, 21 M . 38, 1393), dessen Beseitigung nicht verlangt wird. Vgl. auch ROBERTI, Aug. Festschr. 343 ff. ; Publ. Sacro Cuore 40 (1933) 51 ff. ; viel patristisches Material bei BENIGNI 124 f. (2) Vgl. etwa Combès, 141 ff. ; im Ambrosiaster ( M . 17, 162) wird die lex divina als quasi paedagogus auf der via iustitiae bezeichnet. (3 ) Das ist in ihrem Ursprung auch die justinianische aequitos als « norma obbiettiva, eguale per tutti » (RICCOBONO , Riv. Dir . l'iv . 1911, 13 ff.) sie ist aber sicherlich viel eher eine gestaltungschwache, generalisierende Ueber tragung philosophischer Leitsätze auf konkrete Tatbestävde als dass sie von spezifischer Rechtsempfindung des Christentums getragen wäre. — Ganz ähulich prägt sich die - äusserlich und innerlich gesehen – überall eintretende Ni vellierung auch etwa im Inhaltswandel des pietas Begriffes aus, wie das in interessantester Weise Theodor ULRICH zeigte in Pietas (pius) als politischer Begriff im römischen Staute bis zum Tode des Kaisers Commodus (Historische Untersuchungeu hsg . von KORNEMANN und KAEHLER VI) 1930. Natürlich hängen diese Dinge, wie längst gesehen wurde, auch mit der wirtschaftlichen Verelen dung des Reichs zusammen ; in Pannonien , wo die freien Bauern erhalten blei ben , bewahrt sich deshalb auch konservativ -römische Gesinnung am stärksten und längsten, vgl. ALFÖLDY, Die Vorherrschaft der Pannonier im Römerreich etc ., in : 25 Jabre römisch -germanische Kommission 1930, 15 tf . Christentum und nachklassische Rechtsentwicklung 113 solche Gerechtigkeitsidee zwar insofern in ein spezifisch christli ches Gewand als Gott, der Ursprung der Gerechtigkeit, mit dem Gott des Glaubens zusammenfällt. Das Band der christlichen Bru derliebe verbindet ferner grundsätzlich einander brüderlich gleich geordnete Individuen . Die antike Stufung nach der Würdigkeit des Einzelnen und seiner Stellung innerhalb der civitas-Gemeinschaft verschwand also gegenüber dem grossen Abstand zwischen Gott und gleichermassen sündigen Menschen. Andrerseits ist selbstver ständlich mit der religiösen Grundlage der iustitia auch das Pro blem des ungerechten Gesetzes nun nur vom Christentum aus zu entscheiden . Die abendländische Kirche nimmt es in Angriff in ihrer Stellungnahme gegenüber dem staatlichen Zwange zur Ido latrie , in der sie die Generalsünde schlechthin sieht. Hier erfolgt schärfster, unnachgibiger Widerspruch (1), der freilich grundsätzlich im Dulden , im Aufsichnehmen aller Art von Uebel um Christi Willen besteht. Es ist also kein aktives Widerstandsrecht (2), das (1 ) Vgl. schon Tertullian (BECK a . a . 0 . 46 ). In der ganzen Patristik ist es klarer Grundsatz , dass das göttliche Gesetz vorgeht (vgl. COMBÈS 156 -7 und die vielen Stellen uus Chrysostomos, Gregor von Nazian ., Augustin bei BENIGNI II 1, 8 ff.); vgl. über die norinsetzende Gewalt des logos Gottes Am brosius 2 , 174 , 8 : Tertium (scil. praeceptum ) de imperiali potestate, qui verbum dei regale est et iudiciale plenum iustitiae sacerdotis, remunerationem bonoruni actuum et retributionem malorum in iudicium suum servans - vgl. auch etwa Basilius ep. 92 (M . 477). Ferner im Zusammenhang mit aequitas Ambr. 5 , 329, 22 : docuit me inclinare cor meum ad faciendas iustitias, non ad iniquitatem , sed ad aequitatem inclinare propter retributionem . retributio regnum caelorum etparadisi est incolatus. Das Verhältnis von Sittlichkeit und äusserer Rechtsgewalt wird , ebenfalls im Sinne Ciceros, von Pseudo-Ambrosius 2, 363, 1 klar formuliert: qui putet sibi quod non decet non licere: qui se legibus obstringat suis et quod per iustitiam non licet nec per potestatem licere cognoscat ? Non enim solvit potestas iustitiam , sed iustitia potestatem , non legibus solutus est, sed leges suo soleit exemplo.... Die bei Ambrosius akuten Fälle betreffen praktische Fragen des Staatskirchenrechts , wo der Bischof sich als Vertreter einer höheren Gerechtig keit fühlt, während bei eigentlich rechtstechnischen Regelungen insbes. des Privatrechts kein Modifizierungsversuch unternominen wird (vgl. aber 13, 2 ). (2) vgl. insbes. Combès 152 ff.; BENIGNI a. a. 0 ., woselbst reiche Belege. Die m . W . einzige Stelle wo bei Augustin der Umsturz eines allgemein kor rumpierten Staatsregiments gerechtfertigt wird (De libero arbitrio I VI, 14 ; vgl. Cicero de off. 3 , 6 , 31. COMBès 157) bewegt sich wieder, insbesondere in der Betonung des communis utilitas und der honestas gegenüber dem Pri vatnutzen, ganz in Ciceronianischen Gedankengängen. Augustin betont immer wieder dass Gebot, der Obrigkeit zu gehorchen, die bestehenden Gesetze zu 114 Alexander Beck die Kirche irgendwie proklamiert, sondern es wird mit Hinweis auf das Beispiel der Märtyrer innere passive Resistenz verlangt, eine religiös- jenseitige Haltung gegenüber den Dingen der Welt . Ambrosius und Augustin etwa empfinden die kirchlich - religiöse Ordnung als auch schon in der , natura “ vorgebildetes Gesetz ( 1 ), hüten sich aber dennoch , sie in dieselbe Lebens-und Wirklich keitsspäre wie das (kirchlich gesehen) ebenso der Natura entsprung ene staatliche Recht zu stellen. Der politische Einfluss, den ge rade Ambrosius gegenüber den Kaisern ausübt, geschieht durch Rat und Ueberredung. Wie denn überhaupt die Kirche davon ausgeht, dass staatliche Gesetze und staatliche Verwaltungstätigkeit durch die zuständige Behörde freiwillig der christlichen aequitas ange passt werden sollen , deren Sprachorgan der Bischof ist. Der rö misch - stoische der moderatio spielt gerade bei Ambrosius eine beachten . Sehr instruktiv ist ep. 84, 4 (CSEL 34, 390), wo Augustin sich wei gert, Anspruch auf den Nachlass eines ohne gültiges Testament verstorbenen Klerikers für dessen Kloster zu erheben , und aufs schärfste betont dass die privatrechtlichen Intestaterben nicht verkürzt werden dürfen ; eu iura eis ser vare oportet, quae tulibus habendis vel non habendis secundum civilem societatem sunt instituta , ut ab omni non solum re, sed etiam specie maligna... nos absti neamus et bonam famam custodiamus dispensationi nostrae multum necessariam insbesondere auch bezügl. der Steuergesetze , und zwar dies trotzdem er den Fiskus (enn. in l'salmum 146 , 17) als einen alles verschlingenden Drachen be zeichnet. ep . 96 ; exp . quar. prop. ex Ep . ad Roman . 72 (M . 35, 2038 ff.) dazu COMBES 148 ff. Im Anschluss an Cicero), wird hingegen schon bei Tertullian (BECK a , a . 0 .) das ungerechte idolatrische Gesetz als nichtig erklärt. Dem folgt auch Augustin (Stellen bei ROBERTI 329). (1) Bei Hieronymus und Ambrosius wird eine Anknüpfung an naturrechtli che Gedankengänge sichtbar , wie sie von PEROZZI . a . als byzantinisch be hauptet wurden : die lex naturae wird auch auf Tiere erstreckt; vgl. Ambro sius I, 182 ; I, 189, 3 (Staat der Vögel). Cf, PEROZZI, Ist , I 91, n . 3 ; CASTELLI, Intorno a una fonte greca pr. 1, § 3 D . 1, 1 war mir nicht zugänglich . Auch die christliche Nächstenliebe wird in Anknüpfung offenbar an Cicero natur rechtlich gerechtfertigt (Ambros. 4 , 316 -7 : non enim cognatio ficit proximum , sed miseri cordia , quia misericordia secundum naturam . Nihil enim tam secun dnm naturam quam iuvare consortem naturae Vgl. ferner etwa Ambros. 1, 508 - 9 : nec mirum si barbarus ius novit naturae.... maior lex natura equam legum praescriptio est; Ambros. ? , 170 , 1 f., Ambros. 2 , 175 (Naturrecht und Gesetzes recht decken sich ) und öfters, vgl. auch bei Tertullian und Cyprian , Beck a. a. 0 . passim , ROBERTI a . a . 0 . Christentum und nachklassische Rechtsentwicklung 115 grosse Rolle ( 1). Allein in Sachen des Glaubens vertritt der Bi schof übrigens ein Recht, gehört zu werden , denn hier ist jede an dere Beratung unzuständig. Am stärksten prallen die Gegensätze in der bekannten Frage der Basilika aufeinander, wo Ambrosius dem Kaiser gegenüber Eigentum Gottes an der Kirche behauptet (2), die ohne Sakrileg nicht den arianischen Ketzern ausgeliefert wer den dürfe . Hier stehen sich an einer grundsätzlichen Stelle (es handelt sich wiederum um die Idolatrie) hart staatliches und reli giöses Recht gegenüber. Ambrosius setzt sich zwar in der religiösen Frage unbeirrt durch, verneint aber an anderer Stelle ausdrücklich die Möglichkeit eines Gegensatzes zur Staatsgewalt in Bezug auf vermögensrechtliche Belange der Kirche (3). (1) Oft auch mit temperantia synonym . Sie gehört natürlich in die Geschichte des berühmten suminium ius summa iniuria . Vgl. insbesondere Ambrosius de paen . I 1, 2 ( M . 13, 1076 ): Salomon ait Noli iustus esse nimium ; debet enim iustitiam temperare moderatio ; ep. 6 , 7 (M . 900 ): Gabionitae nihil pensum ac moderatum habentes ; öfters in De off. min . ; hierher gehört auch die iustitiae moderatio im Schreiben Leos der Grossen v. 5 , 5 , 450 (ep . 66 ). Eine ähnliche Anschauung vom Amt des Bischofs, der als Vertreter der christlichen Religion bei den Staatlichen Behörden in Einzelfällen um gemilderte Durchführung staat licher Rechtssätze interveniert (ohne deren Gültigkeit zu bestreiten ) findet sich auch häufig in der Briefen des Basilius, Augustin u . a . Die Härten der Steuer eintreibung betreffen Basil. ep . 104, lo und 110 ; 108 betrifft Vollstreckung ; 111, 112 etwa den Strafprozess: Basilius bittet den erkennenden Praefekten um eine milde Bestrafung des Angeklagten . Zur Abwandlung des harten , abschre ckenden Strafgesetzes nach den Grundsätzen der misericordia im einzelnen Fall auch Augustin ep. 153, 15 . Vgl. auch die zahlreichen Stellen über moderatio und temperantia (offenbar stoischen Ursprungs) aus Seneca, Cicero, Cyprian , Novatian und anderen bei Koch , Cypriunische Untersuchungen 1926 , 275 ff. fer ner allgemein BENIGNI 29 ff. (2) vgl. ausführlich v. CAMPENHAUSEN a . a. 0 . 200 ff. ( 3) vgl. Sermo contra Auxentium c . 33 (M . 16 , 1017 ): Agri ecclesiae solvunt tributum : si agros desiderat imperator, potestatem habet vindicandorum : nemo nostrum intervenit. Recht vorsichtig wird Theodosius gegenüber ein Recht des Ambrosius als des Vertreters der Kirche formuliart, an Beratungen des Kron rats teilzunehmen und von den Beschlüssen in Kenntnis gesetzt zu werden , in ep . 40 , 28 ( M . 111 ) : si de causis pecuniariis comites tuos consulis, quanto ma. gis in causa religionis sacerdotes Domini aequum est consulas ; schärfer in c. 1 ( M . 1102) : Et tamen si in causis rei publicae loquar, quamvis etiam illic iu stilia servanda sit, non tanto adstringar melu , si non audiar ; in causa vero Dei quem audies, nisi sacerdotem non audias, cuius maior peccatur periculo ? c . 5 : causam ergo Dei tacebo ? ep. 51, 2 (M . 1160) : Soli mihi in tuo comitatu ius na turae ereptum videbam audiendi, ut et loquendi privarer munere : motus enim Alexander Beck 116 Neben aequitas als rechtsphilosophisch -religiösem Begriff, dessen Definition sich eng an Cicero (insbesondere in der Betonung der communis utilitas) anlehnt (1), sucht man bei Ambrosius und den Abendländern vergeblich nach jener verschwommenen, subjektiven aequitas der Byzantiner, welch die bona fides der Klassiker er setzt (2). Ueberall da , wo es sich um die konkrete rechtliche Ent scheidnng eines einzelnen Falles oder die Anwendung einer kon kreten Einzelbestimmung handelt, geschicht dies m . W . in der abendländischen Patristik in nüchterner Abwägung aller Umstände und Interessen , unter Berücksichtigung des wahren Sinnes und Zwecks der Norm (3 ). Es wird bisweilen sogar als Gebot der christ freqnenter es gnod ad me pervenissen , oliqua quae in consistorio tuo statuta fo rent. Andrerseits wird in ep. 17 , 12 (M . 964 ) Valentinian gegenüber in Analogie zum Prozessrecht nachhaltig fast ein Rechtsanspruch erhoben : Si civilis causa esset, diversae parli responsio servaretur ; causa religionis est, episcopus convenio. De tur mihi exemplum missue relationis (scil. des Symmachus betr . des Victoria Altars; auch hier handelt es sich wieder um Idolatrie) ut ego plenius responde bam ... certe si aliud statuitur, episcopi hoc aequo animo pati el dissimulare non possumus. In ep. 50, 2 stützt A . das Recht zur Meinungsäusserung auf die alt römische Libertas (hoc interest inter bonos et malos principes, quod boni liber tatem amani, servitutem improbi; vgl. auch ep , 21, 9 (M . 1004): leges enim im perator fert, quas primas ipse custodiat ; ferner über die Unterordnung des Kai sers gegenüber Gott resp. Christus, der inagistrat des Weltstaates ist, Ambr . 4, 350, 24 (zu Lucas 15 , 28 ; Matth . 5 , 25 ); ep. 57, 8 (M . 1176 ); (Pseudo-) Ambr. 2, 363, 1. und viele andre Stellen . (1) Nirgends findet sich . W . ( sowenig bei Augustin wie bei Ambrosius) eine « utilità sociale » in den Sinne des Nutzens einer bescbränkten , zufälligen Gruppe von Menschen oder gar eines Grundstücks, wie sie bei der justiniani schen Regelung der Miteigentums und der societas begegnet und von RICCOBONO in seiner bekannten Abhandlung in den Essays in Legal History (Oxford 1913 ) auf christliche Einflüsse zurückgeführt wurde. Die ciceronianische communis utilitas, wie Aug . und Ambr. sie singemäss verstehen , bezieht sich immer auf das Interesse der gesamten staatlichen resp . christlichen Gemeinschaft. Das Ausgehen vom subjektiven Einzelfall und die Verallgemeinerung dort vorschnell gefundener Billigkeitsregeln demgegenüber vielmehr als typisch byzantinisch . (2) PRINGSHEIM , Conference insbes, 197. (3) Vgl. Ambrosius 2, 361, 13: bene admonet evangelica lectio (Joh . 8 , 11): etiam cum peccatum appareat, sobrium tamen debere iudiciis esse iudicem ac memorem unumquemque esse oportere suae conilicionis meriti. saepe enim etiam in iudicando maius peccatum iudicis est quam peccatum ipsius de quo fuerat iudicatum . nam si praescriptum est a quibusdam sapientibus mundi, ut in iudi cando caveatur, ne maior poena quam culpa sit (Cicero , de Off. I, 25 , 89) idque servatur, quanto magis id servandum videtur, ne unusqnisque de alio iudicaturus se ipso prius iudicet nec minora in alio condemnet. Vgl. auch etwa ep . 5 , 19 (M . 897) und Basilius ep . 92, 2. Christentum und nachklassische Rechtsentwicklung 117 lichen Aequitas bezeichnet, die Todesstrafe rasch zu vollstrek ken (1). Auch an der Institution der Folter stösst man sich oft grund sätzlich nicht (2). – Vou jener verallgemeinernden , weichlichen und unkonsequenten humanitas und caritas (3), wie sie in den by zantinischen Quellen auftritt, finden sich nichts. Hingegen begegnet man auf Schritt und Tritt vor allem bei Ambrosius einer aus Ori genes, Philo und der zeitgenössischen Rhetorik stammenden Ausle gungsmethode, die häufig mit Distinktionen arbeitet, so etwa mit der Unterscheidung von specialis und generalis interpretatio (4 ); allerdings wiegt die neuplatonisch-allegorische Ausdeutung vor. (1) Ambr. 5, 457, 54 ; feruer ep. 60, 1 (M . 1183): Hostem ferire victoria est, reum aequitas, innocentem homicidirem (vgl. auch etwa Cicero de off. 1, 25 , 88 ) ; es wird sehr scharf zwischen Mitleid schlechthin und iusta misericordia unter schieden, welch letztere allein Ursache und Wirkung abwägt und dem göttli chen Gesetz entspricht, vgl. Ainbr. 5 , 165 , 4 ff. : iusta misericordia ... iniusta ... ut si quis latronem filiis deprecantibus motus... absolvendum putat, nonne inno centes tradet exitio qui liberat multorum exitia cogitantem ?. . . deinde inter duos, hoc est accusatorem et reum pari periculo de capite decernentes, alterum si non probasset, alterum , si non esset ab accusatore convictus, non id quod iustitiae est iude. sequatur, sed , dum miseretur rei, daminat probantem , aut, dum accusatori favet qui probare non possit, addicat innoxium ? non potest igitur haec dici iusta misericordia . . . in ipsa ecclesia , ubimaxime misereri decet, teneri quam maxime forma iustitiae dass nicht die communio durch die facilitas des Priesters ver weigert wird )... hoc eo dictum est, ut sciamus secundum verbum dei, secundum rationem dispensandam esse misericerdiam debitoribus. . . vgl. auch die Ausfüh rungen über die Anwendung des Gesetzes nach der ratio legis bei Augustin sermo 47, 6 ( M . 38, 298 ) und 13, 7 (a . a . 0 . 110 ). Viel Zitate zum Problem der Todestrafe bei BENIGNI 42 f. ( 2) Etwa Augustin de Civitate Dei XIX , 5 (die ganze Erörterung ist übri gens aus Varro übernommen , vgl. Fuchs, a . a. 0 . 11). Kirchl. Einfluss in C . Th . 9, 35 , 4 ; cf. BENIGNI 50 f. STEINWENTER , in 2Sst, Kan. Abt. 1934, 28. (3 ) ALBERTARIO , Rend . Ist. Lomb. 44 (1931). (4 ) Vgl. Ambr. 5, 116 , 14 : qui legem venit non solvere, sed tueri etiam ab interpretationibus perfidorum ; (Pseudo-) Ambrosius 2, 362, 11: Quid igitur ? nequamus factum an repudiamus magistrum ? nihil horum ; sed qui speciem obicit communitatem consideret ; species facti est communitos naturae. nihil igi tur mirum si intra generalitatem species est, agnosco enim hominem fuisse Da vid , et nhil mirum : agnosco commune ut homo peccet... peccavit quod solent reges, sed paenitentiam egit quod non solent reges... oblitus imperii et memor culpae: u . ö. Sehr oft findet sich (wohl in Anschluss an Origines und Philo ), eine dreifache, natürliche, moralische und mystische Auslegung vgl. etwa ep. 33, 2 (M . 1072) : verum ipse non ignoras quod interdum scriptura cum allego riam dicit, alia ar speciem Synagogue, alia ad Ecclesiam refert : alia ad ani 118 Alexander Beck Auch die voluntas- Lehre , mit der sich die christlichen Schrift steller vornehmlich im Zusammenhang mit der Kirchenbusse und im Anschluss an die klassische strafrechtliche voluntas beschäftigen weist keine byzantinischen Züge auf. Insbesondere fehlt es an dem in der natura-contractus- Lehre von den Byzantinern betonten , beson deren rechtsgeschäftlichen Willen durchaus (1 ). Als Ausdruck der mam , alia ad verbi mysreium , alia diversas species et qualitates animarum ; Ambr. 2, 86 , 4 : hoc de mysterio . ceterum quod ad moralem pertinet locum , quia omnes salvos vult fieri dominus deus noster, dedit etiam per Joseph his qui sunt in servitute solacium ; 2, 11, 3 : haec moraliter ; mystice autem vidit dominus Jesus Paulum ; u. ä . häüfig , vgl. etwa Ambr. 4, 112, 2? ; 4 , 122, 22 ; 4, 122, 22 ; 4 , 147, 3 (mysticus numerus); 213, 16 ; 248, 6 ; 259, 17 ; 270, 5 ; 273 , 15 ; 286, 1. Ferner Ambr. 5, 159, 5 : spiritalem utique legem dicit... nam qui corpo raliter legem interpretati sunt, non custodiunt legem , sed praevaricantur ; 1, 324, 18 u. ö . Mit Basilius übereinstiminend istdie Unterscheidung von accidens und substantialis in Ambr. 1, 27, 27 : quod dominns earum malitiam creaverit, cum utique non substantialis , sed accidens sit malitia , quae a naturae bonitate defle cerit; cf. atwa 2, 26 , 9 ff. Vgl. auch zur Herkunft der byzantinischen Aporiai kai lyseis aus der spätpatristischen Aporienliteratur resp. der hellenistischen Philologie PETERS, Oströnische Digestenkommentare ( Berichte d , Sächsischen Ges. f. Wiss . phil. hist. Kl. 65 (1913) S. 40 . Ferner etwa ALFARIC , Evolution intel lectuelle de St. Augustin 1913 , 367 ff.; gen smer in Bd . I 397 dieser Atti. ( 1) Vgl. etwa Ambr . 5 , 135 , 3 : lex enim non solum agendimunus informat verum etiam secretae mundat mentis affectum etc. ; 1, 537 , 11 : nullu aetas erat culpa immunis. .. et qui possibilitatem perpetrandi criminis non habuit , habuit adfectum ; 2, 10 , 9 : Non est quod cuicquam nostram adscribamus aerumnam nisi nostrae voluntati. nemo tenetur ad culpam , nisi voluntate propria deflexerit... non habent crinen quae inferuntur reluctantibus, voluntaria tantum commissa sequitur delictorum invidia ... bei der folgenden Ausführung : neminem iugo ser vitutis adstrictus possidet (sc . diabolus), nisi si ei prius peccatorum aere vendi derit wird in keiner Weise , wie auch sonst nicht, ein besonderer rechtsgeschäft licher Wille betont, der auf die Rechtsfolgen des Kaufes sich richtet. Die ein zigen Stellen , in denen mir affectus bei Ambrosius in Verbindung mit einem speziellen normativen Tatbestand begegnet ist, sind nur ganz schwache Brü cken , ep. 5, 17 (M . 896 ): accusator , qui affectnm accusatoris iamdudnm exer cuit, qui sermone suo accusationem detulit ; ep. 17, 7 (M . 962): ipsis gentilibus displicere consuevit praevaricantis affectus ; libere enim debet defendere unus quisque fidele mentis suae et servare propositum . Die bei ROBERTI a . a. 0 . S. 332 ff. für die rechtliche Wirkung von consensus und nudum pactum ange führten Stellen , sind teils nicht beweiskräftig (so betrifft De contin . 1, 2, M . 40 , 331 die Gedankensünde, keinen rechtsgeschäftlichen Willen ; åhnlich verhält es sich sich mit allen anderen Stellen , bei deren Zitierung z. T. Druckfehler unter laufen sind ), teils beziehen sie sich offensichtlich auf philosophische Grundätsze (Vgl. Cicero, de Officiis I, 8, 23 : dictorum conventorumque constantia et veritas; Christentum und nach klassische Rechtsentwicklung 119 neuplatonischen Wissenschaft überhaupt bilden wohl die neuplato nischtheologischen Formulierungen der Hypostasenlehre eine gewisse Verbindungsbrücke (1). Jedenfalls finden sich im Abendland keine Spuren der byzantinischen Verschuldensgrade (2). Mit ihnen stehen III, 24 : Pacta et promissa semper servanda ) vgl. andrerseits aber auch die Be zeugung der stipulatio bei Hieronymus in einer juristischen Erklärung v . Jerem . 32, 12 in CSEL 59, 420 : a propheta et sacerdote emitur possessio scribiturque in libro atque signatur et adhibentur testes argentumque diligenter appenditur, ut omnia venditionis et emptionis iura serventur et sit certa possessio stipulatiuni bus et responsionibus roborata ... libros, num signatum , alterum apertum quae emptionum consuetudo hucusque serratur, ut quod intrinsecus clausum signacula continent, hoc legere cupientibus apertum volamen erhaeseat. Sehr interessant bezeichnet Hieronymus ebendort bingegen (S. 405, 3) das Testament, weil es eine voluntas enthalte , als ein paclum : licet el testamentum recte pactum appellatur, quia roluntas in eo atque testatio eorum qui pactum ineunt, continetur . .. Vgl. andrerseits aber auch die beachtliche Ausführung bei Augustin ep. 3 , 6, 10, der eine Willenserklärung (iuramentum ) ausdrücklich nach dem objektiven, übli chen Erklärungsinhalt, nicht nach dem subjektiven Willen des Erklärenden aus. gelegt haben will: non secundum verba iurantis , sed secundum espectationem illius cui iuratur, quam novit ille qui iurat, fides iurationis est implenda (cf. 17, 83); 3, 18 , 10 : expectationem eorum quibus iuratur, quisque deceperit non potest esse non periurus. Vgl. für Ehescheidung und Besitz aber BECK a. a . 0 . 97 n . 4 u . die dort zitierten ; ALBERTARIO , Stud . Bonf. I 661 und dessen dort angegebene Schriften ; ferner Augustin -Festschrift cit. 366 ff. (1) Vor allem die Lehre der Kappadozier, wie sie etwa im 38. Brief des Basilius ausgedrückt ist ; die Hypostasis hat einen « Mittelsion zwischeu Per sönlichkeit und Eigenschaft (Akzidenz und Modalität) so jedoch , dass der Per sonenbegriff der stärkere » ist (HARNACK ). Dabei ist es notwendig , dass alle die Hypostase ausmachenden , eben wesentlichen Eigenschaften im Augenblick der Entstehung der Hypostase vorhanden sind. (vgl. auch über auch die (spezifisch abendländische ?) Betonung des Willensmoments in der Hypostasenlehre des Marius Victorious bei ERNST BENZ, Marius Victorinus und die Entwicklung der abendländischen Willensmetaphysik , Forschungen zur Kirchen und Geistesge schichte hsg v. E . SEEBERG , E . CASPAR und W . WEBER. I, 1932, insbes. 59 : « Die Selbsthypostasierung ist als erster Akt der transcendenten Potenz ein Akt des freieu Willens » . Daneben wäre doch vielleicht zu halten die Lehre von der natura contractus der Byzantiner, die durch die Willensrichtung des animus im Augenblick des Vertragsschlusses bestimmt wird : ein pactum ex intervallo wird in die aio nicht aufgenommen , muss immer durch exceptio geltend genacht werden : BIONDI, Iudicia bonae fidei, in Annali Univ. Palermo VII (1918) 26 ff.). (2) In Ainbr. b , 35 , 2 wird in durchaus römischer Weise eine Rangordnung zwischen neglegentia und imprudentia auf Grund der scientia hergestellt : aperte neglegentiam graviore damnat iudicio quam imprudentiam ; frigidus est eniin qui 120 Alexander Beck sicherlich viel eher in geistiger Verwandtschaft die starren Bus stufen, die die orientalische Busspraxis kennzeichnet ( 1). Eine Bemerkung schliesslich noch zum kirchlichen Prozess recht. So viel sich übersehen lässt und wie dies vor allem neuestens durch Steinwenter (2) in detaillierter m . E . hier endgültig klärender Untersuchung nachgewiesen wurde, lehnt sich die Kirche aufs eng ste an die Normen des staatlichen Verfabrens an . Das ist nicht nur der Fall in den Verhandlungen der Konzilien, wo man sich im Hinblick auf die in wichtigen Sachen immer bestehende Kon fliktsmöglichkeit wohl zur eigenen Sicherung gerne in von der kai serlichen Gewalt prozessual anerkannten Formen bewegte , son dern trifft auch zu für die geistliche Buss- und Strafgerichtsbarkeit. Wenn aber in der Entwicklung des kirchlichen Prozesses neben der als un problematisch erscheinenden und begrifflich oft gar nicht bewussten Anlehnung an das staatliche Recht sich doch auch wieder aus Vorstellungen des christlichen Traditionsgutes schöpferische Abwandlungen , ja mitunter neue Institutionen bildeten , so mag zunächst freilich die Annahme nicht damit im Einklang erscheinen , dass eine alle Bereiche des Lebens durchdringende Religion den Geist des materiellen Privatrechts habe unberührt lassen können . Im Gegensatz zum Prozess, den sich die kirchliche Bussgewalt schaffen musste, lag indessen im Privatrecht eine aus der religiösen Haltung selber sich ergebende Notwendigkeit der Neubildung und innige Be rührung im allgemeinen nicht vor. Das Bild der civitas Dei steht in seiner metaphysischen Jenseitigkeit und Innerlichkeit auch in der ausgehenden Antike dem römischen Recht im tiefsten fremd und fern gegenüber. Allmählich mag sie der die antike Lebensform überall spaltende Geist des Christentums vielleicht auch in der abendlän dischen konservativen Rechtspflege bewusster geworden sein – die Stadien einer solchen Entwicklnng sind uns heute nicht fassbar – fidem nescit , calidus qui sancti spiritus furore succensus est. qui ergo calorem fidei non habet, tolerabilius illi fuerat fidem non accepisse quam neglexisse... (10) : neuter ruidem excusetur, nec ille qui legit, nec ille qui legere noluit ; sed plus delinquit qui negavit quod legebat quam qui opera non fecit quae facienda non cognovit. (1) ERICH SEEBERG , Die Synode von Antiochien im Jahre 324 -25 . Ein bei trag z. Gesch . d. Konzils von Nikäa, 1913 (in Studien :. Gesch , d . Theol. u . dd . Kirche XVI) 32 ff. 53 ff. ( 2 ) ZSS Kan . Abt. 1934 . Christentum und nachklassische Rechtsentwicklung 121 um dann in der Vereinigung mit der byzantinischneuaristotelischen Wissenschaft vom Osten her durchzustossen. Zunächst aber stärkte das Christentum die rechts- und staatserhaltenden Kräfte und erfüllte so die politischen Hoffnungen Konstantins. Auch der von der Kirche so oft betonte Schutz der Schwachen geht, wie dies in der Dis skussion unseres Problems schon häufig hervorgehoben wurde, einig mit den ökonomischen , steuerlichen und innerpolitischen Belangen der Staatsgewalt, so im Kampfe gegen die grossen Feudalherren , im Bestreben der Aufrechterhaltung der Getreideversorgung und anderer staatlich " geplanter " und steuerlich grundlegender Wirt schaftszweige. Das gilt wahrscheinlich auch vom favor libertatis im Sklavenrecht, der in Anbetracht der elenden Lage der Kolonen zudem ja eine mehr als zweifelhafte Wohltat darstellt. Wo sich die Kirche durch bischöfliche Intervention zur Verminderung von Härten und Missbräuchen als Vermittler einschaltet, so tut sie dies (vom Kaisertum selbst in diese Aufgabe eingesetzt) vermöge einer höhern, jenseitig bestimmten auctoritas, nicht auf Grund einer po testas der weltlichen Rechtsverwirklichung, zu der sie sich auch subjektiv in keiner Weise berufen fühlt. Trotzdem mündet wohl von hier aus – auch in Anknüpfung an die nur in diesem Rahmen zu verstehenden , spärlich gestalteten Grundsätze der episcopalis audientia (1 ). – eine spezifisch christliche Tendenz nach Ausgleich (1 ) Alle Fälle , die der zivilrechtlichen episcopalis audientia überliefert sind , schliessen sich, soviel ich sehe, an kirchliche Disziplinärverstösse an , bei denen der Bischof als kirchlicher Strafrichter zugleich auch die zivilrechtliche Wieder gutmachung in versöhnlichem Geiste wohl meist durch Vergleich der Parteien ordnet. Hierbei ist sehr wohl – in Anbetracht der als Hauptstrafe empfundenen kirchlichen Disziplinierung – eine allgemeine Tendenz zur Milderung der Poe nalfunktion der privatrechtlichen Deliktsklagen denkbar : vgl. etwa unter den von MARTROYE behandelten Fällen den des Bischofs Antonius in den Mémoires des Antiquaires de la France, 7e Sér ., 10 (70) 1910 – Hier verlangt Augustin die Durchführung eines Vergleichs, nach dem Antonius nur den einfachen Wert der durch verschiedene Delikte erlangten Vermögensvorteile zurückzugeben hat. Mit Recht verweist Martroye dabei auf den Zusammenhang mit den Schutzbe stimmungen für die kleinen Leute und die Institution des defensor civitatis . Bei der Ueberlastung der Bischöfe und der Schwierigkeit der Rechtsfragen werden sie wohl sicher auch die schiedsrichterliche Erledigung von Fragen mö glichst von sich gewiesen haben , die mit der religiösen Seite nur in entferntem Zusammenhng standen, wie sich denn auch nach den m . E . überzeugenden Ausführungen DE FRANCISCI's, Ann . Perugia 30 (1915 ) die Privilegierung der Roma - II 122 A . Beck - Christentum und nachklassische Rechtsentwicklung und nivellierenden Milde in den grossen allgemeinen Strom des nachklassischen Rechtsdenkens. Und doch lassen sich keine sichern Brücken zu der byzantinischen Lehre vom temperamentum und mo deramen aufzeigen die Ratti in eindrucksvollen Ausführungen darstellte. Dieselbe Beobachtung gilt auch offensichtlich für die Interpolationsnachweise um die Worte benignitas, caritas, humanitas, moderatio, aequitas usw ., die wir Albertario verdanken . Die nachklas sische Rechtsentwicklung – so möchte ich meinen Gesamteindruck fassen – kann von der Seite des Christentums her nicht als kontinuierlicher Weg zur wissenschaftlichen Haltung der Kompi latoren erwiesen werden . episc . audientia nur auf die spirituale Kompetenz bezog . - Spezifisch christliche Einflüsse haben bei der Zurückdämmung der privaten Selbsthilfe (Chiazzese 408 ) sicherlich schon in der vorbyzantinischen Zeit eine Rolle gespielt, doch ist ge rade hier die Tendenz der Zentralgewalt mit Händen zu greifen . Bei allen andern « christlichen » Interpolationen des Privatrechts, so bei der Impensepregelung, dem Fruchterwerb, der deductio ne egeat, dem Grundsatz des alterum non laedere, der desuetudo der lex Cincia, liegen % , T. nach Chiazzeses treffenden Nachweisen die Ansätze schon im klassischen Rucht oder in der allgemeinen Entwicklung oder weisen, wie auch der favor religionis, so deutliches byzantinisches Gepräge auf, sind insbesondere auch mit der kirchlich - disziplinären Fragestellung oft nur schwierig in dieser allgemeinen Fassung vereinbar, dass alle diese Quellenve ränderungen für unser Problem ausschalten müssen . G . BAVIERA PROFESSORE ORDINARIO DI IST. DI DIR . ROMANO NELLA R . UNIVERSITÀ DI PALERMO LA CODIFICAZIONE GIUSTINIANEA E IL CRISTIANESIMO (Sunto della relazione) · Il problema se – e quanto – il Cristianesimo abbia influito sul diritto romano, o , più ristrettamente formulato , il problema dei rapporti che corrono tra la codificazione giustinianea e il Cristia nesimo, presuppone risoluti alcuni problemi metodologici, specifici per un simile studio , che però, finora , tutti gli autori indistintamente – sia che neghino, o ammettano una influenza - hanno lasciato o del tutto da banda, o appena adombrati e solo in parte. Infatti occorre preliminarmente fissare il concetto e il con tenuto di « Cristianesimo » – sapere, cioè, che cosa si debba intendere, ciò che si indica con questa parola sintetica, di quali elementi consti – o quale di essi abbia potuto influire sul di ritto e sull'opera codificatrice di Giustiniano. Come ogni religione, cosi il Cristianesimo ebbe i suoi elementi costitutivi, variabili nelle varie epoche. Esso ha dovuto formarsi un ordinamento di precetti di istituzioni, di dottrine : ha avuto un complesso di principi etici, che lo differenziarono e lo individuarono. Occorre, quiudi, in via pregiudiziale, enucleare prima tutti questi elementi per po tere studiare – poi – quali di essi abbiano potuto, e in che limiti, influire. : E influire su che cosa e come ? Il legislatore Giustiniano e i compilatori, che creavano il nuovo ordinamento giuridico si trovavano dinnanzi a norme esi stenti, che regolavano e disciplinavano la vita sociale della loro epoca e i bisogni sociali del tempo . Ora essi poterono – in omaggio a precetti religiosi e dottrine dogmatiche del Cristianesimo divenuto religione di Stato ufficiale di loro libero arbitrio e per motivi politici – creare una serie di norme e imporle , anche quando non erano del tutto sentite e volute dalle esigenze della vita sociale dell' epoca. Essi 126 G . Baviera potevano cosi fissare il delitto di haeresia e il concetto dihaereticus (di quei cristiani che non seguivano, cioè, le massime teologiche e meramente religiose stabilite dai quattro concili ecumenici di Nicea , Costantinopoli, Efeso e Calcedonia): abolire la pena capitale del supplizio della croce ; imporre che si festeggiasse la domenica; ri conoscere il diritto alla libertà del servo che avesse voluto diven tare sacerdote o entrare in un convento , o allo schiavo cristiano acquistato da un dominus non ortodosso, o al servo non ebreo cir conciso dal padrone ebreo ; concedere che il servo cristiano fosse sepolto accanto al padrone cristiano ; vietare il matrimonio tra cristiani e ebrei, punendolo come l' adulterio , o a chi avesse fatto voto di castità, o rivestisse gli ordini maggiori; tra padrino e figlioccia, tra cognati e affini entro il secondo grado in linea colla terale (con Augusto proibito in linea retta senza limitazione di grado); favorire le donazioni per causae piae (intensificando e organizzando la preesistente pubblica beneficienza); ammettere la manumissione sacrosanctis ecclesiis (parallela alla manumissio vindicta avanti il magistrato romano, visto che l' ecclesia era diven tata un istituto pubblico amministratore nello Stato ). Tutte queste innovazioni furono fatte indubbiamente in omaggio a principi dottrine e istituti meramente religiosi e gerarchici del Cristianesimo : basterebbe a provarlo l'invocazione alla Santa Trinità con cui si inizia l'attività codificatrice di Giusriniano . Ma nel campo dei veri e propri rapporti patrimoniali e istituti sociali, che costituiscono la materia del diritto privato, l' influenza dell'etica cristiana fu nulla o quasi nulla . Nello stesso istituto del matrimonio , che sembra sia stato il più influenzato, gli sforzi di Giustiniano furono senza effetto : e quelle medesime poche mo dificazioni che vi introdusse in omaggio a principi etici cristiani, o caddero immediatamente dopo la sua morte, o innestate nella struttnra dell' istituto romano, rimasero prive di vita e sono perfino contraddittorie ! Giustiniano, ad es., vieta lo scioglimento del matrimonio per volontà unilaterale di uno dei coniugi o per mutuo consenso – però non lo dichiara nullo ! – e impone invece ai coniugi la perdita dei beni e l'entrata in un convento (novità che il suo immediato successore fu costretto con la Nov. 148 ad abolire , ripristinando il divorzio per mutuo consenso ). Ma nello stesso tempo ammette il divortium bona gratia per la prigionia di guerra dell'altro coniuge. Proibisce le nozze fra affini in linea col La codificazione giustinianea e il Cristianesimo 127 laterale entro il secondo grado – ma ripermette quelle fra cugini (ciò che Teodosio I aveva vietato e punito) – e concede il divorzio se la pazzia di un coniuge è furiosa e insanabile. Vuol difendere il vincolo matrimoniale secondo le dottrine dei Padri della Chiesa , ma dichiara turpe il patto di non divorziare : infine ( siccome rileva BONFANTE , Ist. didir. rom ., 9a, pag. 187) afferma ancora « una volta il diritto dello Stato e la realtà umana di fronte alle stesse parole di Cristo : « Nuptiae affectus facit mutuus... Cum autem semel con tractae sint - oportet solutionem sequi aut impunitam aut cum poena, quoniam ex iis, quae inter homines ligatum omne dissolubile ». La ragione di tutto questo credo sia da ricercare in ciò : che nel campo dei rapporti patrimoniali e negli istituti sociali, il di ritto , che ne rappresenta l'intimo equilibrio informativo , la coe sione, non può esser modificato ad arbitrio , in omaggio a principî e dottrine teorici, se contemporaneamente non si modifi cano e trasformano tali rapporti e istituti, assumendo questi un diverso equilibrio, una diversa intima coesione. Ora la società ro mano-ellenica del VI secolo non era stata ancora pervasa e tra sformata dai principî etici e dalle dottrine della nuova religione. E il Ferrini (cui la Chiesa sta per elevare al culto degli altari) rilevava molto opportunamente come « fin dai primi tempi la Chiesa aveva bandito dottrine che si riferivano ben da vicino alle con dizioni giuridiche : e queste idee non potevano non farsi strada (e benchè solo in parte e inconsciamente ) – (il corsivo è suo ) - nella civiltà romana » . Egli però non credeva che « il Cristia nesimo abbia influito direttamente sul diritto romano, bensì che molte idee cristiane potessero penetrare quasi inconsciamente nella civiltà romana e giovare così indirettamente al diritto » ( Storia delle fonti, pag. 100). Concludendo. Nella codificazione giustinianea penetrarono alcuni principî meramente religiosi e dottrinali del Cristianesimo (la mag gior parte sono stati sopra accennati) : nessuna — o quasi – delle sue specifiche dottrine etiche. E ciò si spiega agevolmente : il regno di Dio non è di questo mondo - la vita è una peregrinazione quaggiù – le ricchezze vanno disprezzate – quod superest date pauperibus – gli uomini sono fratelli, perchè figli dello stesso Padre che sta nei Cieli – non fare agli altri quello che non vuoi fatto a te stesso – sono questi principi che stanno fuori del di ritto – in un diverso ordinamento normativo – e non 128 Baviera G . - La codificazione giustinianea e il Cristianesimo possono, quindi, costituire scopi immediati regolabili e di sciplinabili giuridicamente , da raggiungersi nella vita reale di relazione – campo esclusivamente devoluto all' impero delle norme giuridiche. Essi, perciò , non avevano potuto trasformare la vita e gli istituti sociali del VI secolo – e ripercuotersi – attraverso i compilatori giustinianei – sensibilmente o tangibil mente nell' ordinamento giuridico, che stava elaborandosi dai Com missari. Quel che di più umano e di più etico, dirò, che si riscontra nei libri giustinianei, in confronto agli ordinamenti precedenti, proviene quasi totalmente dallo stoicismo – da cui il Cristianesimo assunse (come è stato rilevato ) il concetto fondamentale della ca rità e della giustizia – fondandovi tutta la sua dottrina morale , ma colorendola del nuovo sentimento della rassegna zione e umiltà . Lo stesso principio basilare essenziale del Cristianesimo – che riassume e sintetizza il dovere morale degli uomini verso i proprî simili non fare agli altri ciò che non vorresti fatto a te stesso – si era proclamato già parecchi decenni avanti Gesù Cristo da Hillel l'Antico. Ma questa massima non operò per nulla, neppure nel campo dei diritti reali : la dottrina dell'abuso del diritto, o dei cosiddetti atti ad aemulationem , che ne sarebbe stata una prova, è totalmente estranea alla compilazione giusti nianea . M . ROBERTI PROFESSORE ORDINARIO DI STORIA DEL DIRITTO NELLA UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO LE COLLEZIONI GIUSTINIANEE E IL CRISTIANESIMO (Sunto della relazione) Il tema « Le collezioni giustinianee e il Cristianesimo » ri guarda un argomento che diede origine a vivaci discussioni, cioè i rapporti fra il Cristianesimo e il Diritto romano. Riguardo ai quali sembrò che un dissenso quasi insanabile dividesse per lungo tempo i cultori della storia del diritto romano, affermando alcuni che il Cristianesimo aveva esercitato sopra l' evoluzione storica del diritto romano una profonda influenza ; altri negando che le teorie romane abbiano piegato sotto la pressione della nuova corrente spirituale. Esaminando però le collezioni giustinianee si osserva come tale dissenso si può facilmente comporre su di un terreno comune ; quando cioè si tengano distinte le fonti postcostantiniane da quelle precedenti e sottoponendo ambedue ad un diverso particolare esame, in relazione alle contemporanee fonti cristiane e specialmente agli scritti patristici. Dai quali risulta a nostro avviso evidente un fatto di capitale importanza. Come nell'ordine politico gli aderenti alla nuova religione, pur dichiarandosi fedeli alle autorità costituite, videro nello Stato romano il dominatore delle anime e non vollero sottostare al suo potere quando esso entrava a violare l' intimo regno delle coscienze, cosi nei riguardi del diritto privato la patristica, pur non staccan dosi del tutto, almeno in apparenza, dal diritto romano si mostra del tutto indipendente. Lo ius poli è nettamente distinto dallo ius . fori; le leges saeculi dalle leges ecclesiasticae. La Chiesa intese, fino dai suoi inizi, edificare per conto pro prio un edificio quasi del tutto nuovo, basato su principî e fonda menta del tutto diversi da quelli sui quali basava il diritto romano, pur tenendo conto delle condizioni particolari della società romana, uniformando e contenendo il proprio lavoro di ricostruzione, nel M . Roberti 132 l' apparenza , ma non nella sostanza, nelle linee generali del diritto romano. Dopo di avere esaminato se la nuova corrente abbia risentito l' influenza delle dottrine filosofiche pagane – riguardo alle quali si può ritenere che se il Cristianesimo talvolta giunge per altre considerazioni alle stesse conclusioni, pure alle dottrine pagane si mantenne estraneo – riesce utile ricercare le ragioni per cui la patristica intese costruire un sistema in gran parte nuovo e diverso da quello del diritto classico . La ragione principale si può intravedere soprattutto nell' esi stenza di un diritto sacrale romano, che fino dai tempi più antichi ebbe ad insinuarsi informando il diritto romano antico e clas sico , e la cui influenza perdura ancora evidente nel diritto giu stinianeo. In secondo luogo perchè i principî etici, dai quali si allontanava troppo spesso il diritto romano pagano sono invece posti a base del nuovo diritto cristiano. Il diritto è anzitutto giu stizia : giustizia temperata dalla carità e dalla fratellanza umana . Ma allora fu nulla l'azione del diritto cristiano sopra il diritto romano classico , rappresentato dai Digesti ? E in quali limiti si devono fissare le relazioni fra il cristianesimo e le fonti posteriori al quarto secolo ? Si può cosi rispondere: durante l'età pagana, nei primi tre secoli, la norma cristiana non ha una diretta relazione con le fonti raccolte nei Digesti. Tuttavia essa si insinua nel sentimento , nella vita, nella pratica popolare, dando origine ad un complesso di norme di carattere volgare che trovano la loro fonte prima non nella legge, ma nel costume corrente. Dopo i primi tre secoli invece le relazioni fra Cristianesimo e diritto romano, fra le fonti cristiane e le fonti romane si fanno sempre più vive, più strette, più evidenti. In generale gli storici del diritto romano, salvo qualche ecce zione, hanno affermato che tale azione fu saltuaria e slegata ; ma tale opinione inesatta è dovuta alla mancanza di studi diretti sulle fonti patristiche. Di fronte al Digesto e alle collezioni giustinianee, non abbiano un Digesto patristico riguardante i vari istituti giu ridici ! Ma se con diligente esame venisse fatto lo spoglio di tutti gli autori cristiani e delle varie fonti dei primi cinque secoli, fa cilmente si potrebbe osservare con quale lavorio continuo, instan cabile , attivo, la patristica intese costruire accanto al diritto clas Le collezioni giustinianee e il Cristianesimo 133 sico pagano e accanto allo stesso diritto pregiustinianeo e giusti nianeo un vero codice di diritto privato cristiano. , Non è vero che la patristica si sia limitata a pochi argomenti, che non abbia esaminati e discussi problemi all' infuori dalle solite relazioni famigliari o che hanno relazione coi principî generali di diritto . Se noi vogliamo conoscere le origini di molti istituti di diritto privato e il loro svolgimento storico , specialmente di quelli che hanno un qualche, anche lontano, rapporto con l' etica cristiana, dobbiamo sempre e in ogni caso esaminare le fonti cristiane che invero serbano allo storico del diritto le più interessanti sorprese . Prima di dichiarare che un istituto , nel suo svolgimento storico, non ha relazione con le dottrine patristiche bisogna queste atten tamente esaminare, come prima di discutere sulla portata del con tributo offerto alle collezioni di diritto romano dal cristianesimo, bisogna avere pronto uno spoglio quanto è possibile completo ed accurato delle fonti patristiche, senza del quale ogni affermazione potrebbe riuscire inutile e vana , appunto perchè mancherebbe nella discussione il termine maggiore di confronto. Ma quando si potrà avere dinanzi un siffatto lavoro ? Volendo poi scendere ad un esame più diligente del tema pro . postoci, dobbiamo anzitutto esaminare le relazioni fra il Digesto e il nuovo diritto cristiano. Pur riaffermando il nostro asserto che il Digesto è una colle zione di carattere schiettamente pagano, possono sorgere discus sioni feconde riguardo a talune interpolazioni, le quali si debbono, certamente , al nuovo spirito che animava i giustinianei, quando mutarono in taluni punti o mitigarono l' aspra norma romana. Certo non dovremo nė esagerare da una parte, nè lasciarci cadere nell'eccesso opposto . Certo non dovremo sempre dichiarare di sentire il sapore della nuova norma cristiana, là dove invece non vi è che il senso di una umanità più progredito , forse anche in relazione alle nuove correnti filosofiche. Ma è fuor di dubbio che talune interpolazioni sono di origine schiettamente cristiana. Ri guardo poi alle altre collezioni giustinianee la messe è più abbon dante e matura. Volendo – in queste – tentare una opportuna classificazione, si potrebbe distinguere una influenza diretta e positiva da una influenza indiretta che si risolve in una negazione. 134 M . Roberti - Le collezioni giustinianee e il Cristianesimo Influenza diretta e positiva quando la legge imperiale mostra di accettare principî generali del cristianesimo. Questo studio è ricco di risultati, solo che talvolta l' indirizzo spirituale dallo storico e dal giurista si sente , senza poterne citare le fonti. In secondo luogo, e in seguito a tale influenza , si avvertono numerose modificazioni di istituti che nel diritto romano pagano si mostrano con caratteri del tutto diversi. . In terzo luogo l' influenza del Cristianesimo nelle collezioni giustinianee si mostra nella ricezione di istituti del tutto nuovi, ignoti al diritto romano e già nelle fonti patristiche completamente elaborati. Infine non solo accogliendo talune fondamentali direttive o modificando i caratteristici lineamenti tradizionali di taluni istituti o accettandone di nuovi, ma riportando nelle leggi stesse brani ed espressioni tratte da fonti cristiane. Una influenza pure diretta si avverte quando gli imperatori, con l'ardore del neofita , vanno al di là della giusta misura segnata dalla Chiesa e pubblicano leggi o troppo severe o ingiuste, riget tate o male sopportate dalla Chiesa. Accanto a questi casi di inflúenza diretta si avverte pure una influenza indiretta del Cristianesimo quando il diritto laico , sta tuale, imperiale resiste alle pressioni e si mostra restio nell'accet tare le norme patristiche o recisamente si oppone. . Con tale studio il tema dei rapporti fra Cristianesimo e diritto romano non si può dire esaurito , poichè accanto ad una influenza del diritto cristiano sulle collezioni giustinianee , si avverte altresì il fenomeno opposto di una influenza del diritto romano sulla co stituzione esterna della Chiesa , onde Cristo è romano. Solo in pic cola parte questo ci è rivelato dalle collezioni giustinianee , rien trando tale trattazione in più largo terreno e toccando argomenti di diritto pubblico romano che nelle collezioni giustinianee non sono regolati che in minima parte. NB. - Uno svolgimento più ampio di questo tema venne pubblicato a parte nel volume : Cristianesimo e diritto romano (Milano ed . Vita e Pensiero 1935 ). A . E . GIFFARD PROFESSEUR DE DROIT ROMAIN À LA FACULTÉ DE DROIT DE PARIS L ' ACTIO CIVILIS INCERTI ET LA DONATION AVEC CHARGES DANS LE DROIT CLASSIQUE SUMMARIUM Observationes criticae exponuntur circa actiones quae in iure romano illi competunt, cui donatio lege certa facta sit . Dans le droit de Justinien, la donatio lege certa ou sub modo est sanctionnée , comme le contrat innommé d ' échange, par deux actions : 1º. par un action certaine, contractuelle , dite action prae scriptis verbis, en exécution du pacte joint à la traditio ( 1); 2º. par une condictio certaine, fondée sur l' enrichissement injuste (donc quasi ex contractu ) et tendant à la restitution de la res data ob causam , dans l'hypothèse de la causa non secuta (2). Dans cette même hypothèse , accessoirement, une vindicatio utilis de la res data peut être accordée au dans (3 ). Mais les textes des compilations d ' où sont extraites les trois règles ci-dessus ont été surement interpolés et la question qui se pose est celle de savoir comment était assuré, à l' époque classique, le respect de la lex certa donationi dicta . La question est très con troversée et ne parait pas près d ' être résolue. * * Reprenons-la en n 'utilisant d 'abord que les textes, non su spects, qui nous sont parvenus en dehors du Digeste et du Code. Ces textes sont, à ma connaissance, au membre de deux. 1º. Une constitution des empereurs Dioclétien et Maximien de 294, empruntée par les Fragmenta Vaticana ( 286 ) au livre XIII du Code grégorien . 286 . Quotiens donatio ita conficitur, ut post tempus id, quod donatum est, alii restit u atur , veteris iuris aucto ritate rescriptum est, si is, in quem liberalitatis compend i u m (1) C . 4 , 64, 6 et 8 ; 8, 53, 9. (2 ) C . 4 . 6 , 2 (8 ) ; C . 8, 54, 3 pr. (3 ) C . 8 , 54, 1 et 3 . Roma · II 138 A . E . Giffard conferebatur, stipulatus non sit , placiti fide non servata ei, qui liberalitatis auctor fuit, vel heredibus eius perse cutionem competere ; sed cum postea benigna iuris interpre tatione divi principes ei, qui stipulatus non sit, utilem ac tionem (iuxta donatoris voluntatem ) decernendam esse admiserint , actio quae sorori tuae, si in rebus humanis ageret, potuit decerni, si heres ei, ut affirmas, ex asse facta es, tibi adcommodabitur. P . P . Sirmii XI. Kal. Oct. Aug. IIII. et III. cons8 (1). (a. 291) . 2º. Une scolie de Théodore aux Basiliques rapportant l'in terpretatio que le maitre beyrouthin du Ve siècle , Eudoxius, don nait de la constitution du Code grégorien citée ci-dessus. Εάν τινι χαρίσηται τις πράγμα, εφ' ώ μετά χρόνον δούναι αυτό άλλω, ο μεν ήδη τυχών της δωρεάς έχει τον εξ λέγε κονδκτίκιον. ο δε μετά ταύτα οφείλων λαβείν αυτήν, ει μεν επηρώτησε κινεί την εκ στιπουλάτου. ει dÈ un ennpornoev, Exel TÌv Övtihiav åyoynv, tovTÉOTI, TÌv praescriptis verbis ούτως γαρ ο ήρωα Ευδόξιoς τo της ουτιλιάς όνομα ενταύθα ενόησεν. ( THÉODORUS in Schol. Basil. 47, 1 , 72. Heimb. T . IV , p . 593 ). A . - Dans l'opinion traditionnelle, l'actio sanctionnant dans les textes ci- dessus la lex donationi dicta , ne serait autre que l'action incertaine et contractuelle, dite " praescriptis verbis , qui sanctionne les contrats innommés. Cette action aurait été étendue, de l' échange à la donatio sub modo, par des rescrits impériaux du III° siècle (2). Mais l' on peut objecter à ce système que l'action accordée au tiers, dans l' hypothèse de la constitution de 294, n' est que l'action qui aurait pu être accordée au dans. Or, on ne peut concevoir pour le dans, qu' une action en ré pétition de la res data fondée sur l' enrichissement injuste causa non secuta (3 ). Ajoutons que le système traditionnel ne peut plus être soutenu si nous admettons, après les travaux décisifs de Perozzi et de (1) Je suis le texte de SECKEL et KUBLER dans la Jur. Anteiust. II, 302, J' ai mis entre ( ) les mots : iuxta donatoris voluntatem . A mon avis . ils peuvent avoir été ajoutés par Justinien qui applique le texte à sa vindicatio utilis. ( 2 ) Voir la Bibliographie dans DE FRANCISCI, vválayua, I, 254 et s . ( 3 ) DE FRANCISCI, 1. C ., 266 et les auteurs cités. L 'actio civilis incerti et la donation etc. 139 Beseler, suivis par Lenel et de Francisci, que le contrat innommé d 'échange n 'était sanctionné à l'époque classique que par la con dictio (certi) et une actio in fuctum prétorienne. B . - Comme l'action prétorienne in factum , qui ne comportait pas de praescripta verba (1), est surement exclue ici, il reste que l'action donnée au dans ne peut être qu 'une condictio . C 'est l' opinion aujourd 'hui admise : dans le droit du IIIe siècle, la lex donationi dicta n 'aurait été sanctionnée qu' indirectement par la condictio de la res data, c' est -à - dire par une action certaine en révocation de la donation . C . - Mais à ce système on peut faire diverses objections. 1º. Il semble bien que l' inexécution de la charge n' est de venue une cause de révocation de la donation, pour ingratitude qu' à l'époque byzantine (2). 2º . Jamais les Beyrouthins n 'ont appelé “ action praescriptis verbis , la condictio certaine, alors que nous savons qu' ils appelaient de ce nom la condictio utilis d'un incertum (3 ). 3º. L 'action donnée au dans dans la constitution de Dio cletien et Maximien de 294 est une action utile , quae potuit decerni. On ne peut dire cela de la condictio certae rei ou certae pecuniae qui est une action directe quae competit. 4°. L 'action donnée au dans dans le cas de la lex dicta eu faveur d' un tiers n ' est pas une action certaine, mais une action in id quod interest, aux termes d 'une constitution de Dioclétien et Maxi mien de 290 (4). 5°. Enfin une constitution des mêmes empereurs de 294, dans une partie non interpolée (5 ), atteste en matière de donation sub modo l'existence d'un judicium incertum . (1) C 'est ce qui dit expressement une autre scolie anonyme sur la c . de 294 : « Les Anciens appellaient p. v. l'actio in factum civile et non l' action in factum pretorienne » . (HEIMBACH IV , 593 ). ( 2) Voir HAYMANN, Schenkung unter einer Auflage, 1925, 124 et s . ; MIT TEIS , RPrivatr . 201. A l' époque classique la condictio (certi) n 'est admise que si la lex a pris la forme d ' une condition résolutoire de la donation : C . 4 , 6 , 2 a . 227 ; 4 , 6 , 3 a . 257. Comparer ibid . c . 6 de 293. (3 ) Mes articles dans Mėl. Riccobono et dans Mél. Pappoulias Précis Dallos, II, 1934 . (4) C. 8, 38, 3 (a. 290). (5 ) MITTEIS , RPrivatr . 202 ; l' interpolation id quod interest authen tifie « iudicium incertum » . Cfr. Mél. Riccobono 278 . IN 140 A . E. Giffard De tout ceci résulte que l'action utilis (quae decerni potuit) de la constitution de 294, appelée par Eudoxius “ action praescriptis verbis , est bien une condictio ; mais c' est une condictio incertaine, la condictio dite incerti, dont nous croyons avoir démontré l' existence dans les matières voisines, du précaire et des pactes dotaux (1). Dans ce nouveau système, la lex donationi dicta , à l'époque clas sique, ne fait pas naitre d'action . C ' est un simple pacte et : “ Ex pacto non nascitur actio , . Mais l' inexécution de la charge fait apparaitre une obligatio fondée sur l'enrichisement sans cause, donc une condictio. Mais comme l'enrichissement du donataire n ' est injuste que pour la partie de la res data qui correspond a la valeur de la charge inexécutée — qu ' il y a là un incertum – , la condictio dite incerti était seule concevable (2 ). Reprenons maintenant les principaux textes des compilations de Justinien relatifs à la donation sub modo. Ce sont en majorité des rescrits impériaux du IIIe siècle, éma nant de Dioclétien et Maximien . Voici les particularités que ces textes attribuent à l'action qu ' ils accordent dans le cas où la lex dicta n 'est pas respectée. 1° . Cette action est une actio incerti, un judicium incertum (3 ) . Ces noms conviennent parfaitement pour désigner la condictio de l'incertum dans notre hypothèse. Car dans le cas de traditio lega dicta , aucune confusion n' est possible avec l'action incertaine de bonne foi, qui sanctionne les contractus bonae fidei. La donatio certa lege n' est pas un contrat et l'actio incerti qui la sanctionne n 'est nulle part désignée comme une action de bonne foi (4 ). (1) Mél. Riccobono, I. c . (2) Notez qu ' elle n ' a été admise que par une benigna interpretatio des divi imperatores parce que l'actio civilis etait en principe interdite lorsqu' il y a donatio. Ils ont admis que la donatio sub modo était, pour partie, un negotium . Cfr. Mél. Riccobono, 278 et n . 6 . Comparez l' élégante réponse d ' Ariston au D . 2 , 14 , 7 , 2 (obligationem esse) et au même texte (8 3) le cas ou le pactum parit actionem . (3 ) C . 4, 64, 6 ; 8 , 53, 22. (4 ) Mél. Riccobono , 1. c . 280 n . 3 ; DE FRANCISCI, I, 36 s. L ' actio civilis incerti et la donation etc. 141 20. Cette action est une actio civilis (1). Nous le comprenons car la condictio dite incerti est basée sur la théorie jurispruden tielle de l'enrichissement injuste et, dans notre hypothèse, sur la benigna interpretatio des divi principes (2 ). 30. Cette action est utile (3 ). Elle doit être demandée (4 ) par le dans (postulatio , impetratio) et décernée par le gouverneur (decernanda, danda est) (5 ). Nous le comprenons, parce que la con dictio incerti qui, d 'après Lenel, n 'avait pas sa formule dans l’édit, était une action décrétale . 4º. En décernant cette action , le gouverneur de province exerce un urguere, tendant à l' éxécution du pacte : ad implendum pacitum (C . 8 , 53, 9 et 22). Nous le comprenons, parce que la con dictio de l' incertum , comme toutes les actions personnelles de droit strict incertaines, comportait une taxatio (6 ), et, dès lors, le dona taire sera indirectement contraint par la menace de la condamna tion à exécuter la lex dicta. Par tout ceci, nous voyons que les rescrits impériaux du IIIe siècle relatifs à la donation sub modo out été beaucoup moins largement interpolés que ne l' ont cru les plus récents interprètes ( 7), mais ils l' ont été. Il suffit de rapprocher le texte de la constitution de 294, tel qu'il figure aux Fragmenta Vaticana (286), du texte du Code de Justinien (VIII, 51, 3 ) pour s' apercevoir que, là où le Code gré gorien parlait d 'une action quae decernenda est, quae decerni potuit, Justinien parle d'une action quae competit. C'est une interpolation (1) D . 19, 5 , 16 ; C . 8 , 53, 22, 1 ; 4 , 64, 6 . (2 ) C . 8 , 54, 3 , 1. Les divi principes de la constitution sont, peut être , Valérien et Gallien , auteurs de la constitution de 258 (C . 8, 54, 1 pr.). Cfr. C. 4, 6 , 4 . (3) C. 8, 54, 1; Fr. Vat. 285 . (4) C. 4, 61, 5, 8 (Sicut postulas). C. 8, 54, 1 (impetrare). Cette postulatio est, selon moi, une postulatio simples . Voir ma communication aux Journées de Juin 1935 de la Société d ' Histoire du Droit de Paris et RHD 1935 . (5 ) C . 4 , 64, 6 ; 8 , 54, 3 . (6) Voir mon article dans RAD 1933 et comparer PERNICE, Labeo, t. 2 , loc. cit. (7 ) DE FRANCISCI 260 et s. 142 A . E . Giffard - L 'actio civilis incerti et la donation etc. certaine que l'on retrouve dans d 'autres textes (1 ) et dont l'im portance ne paraît pas avoir été bien comprise . Elle s' éclaire si on la rapproche d 'une constitution bien con nue, de Théodose , de 428 (2 ), abolissant l'exceptio non impetratae actionis, “ si aptam rei et proposito negotio competentem (actionem ) esse constiterit , Cela revient à dire que la distinction des actions directes et utiles, encore très nette du temps de Dioclétien ( 3 ), a disparu par la suite en même temps que la conceptio formularum (4 ). Il n ' y a plus besoin de demander (impetrare) la condictio de l' incertum , Celle -ci a cessé d 'être une action utile et donc extraordinaire que l' on postulait sans en dire le nom . La condictio incerti, dans le cas de la lex donationi dicta , s'ap pelle maintenant l' actio praescriptis verbis et cette action , confon due par Justinien avec l' actio in factum prétorienne, sanction de l'avovvuov ovvażdayua, apparaît dans les textes interpolés par lui (5 ) comme la sanction directe et contractuelle d ' un pacte qui n ' est plus considéré comme un pactum nudum . Ces observations trop courtes me paraissent de nature à éclairer d' un jour, que je crois nouveau, quelques points obscurs de l'hi stoire de la donation avec charges, de l'actio praescriptis verbis et la dénomination des actions en général. ( 1) Cf. LEVET dans RHD 1933, 153, 1. Le mot competere n 'est, à mon sens, critère d ' interpolation que quand il s 'agit d 'une action utilis ou décrétale. (2 ) C . J. 2, 57, 2 . (3) Voir ma communication à la Société d'Histoire du Droit, de Fév . 1933 dans RHD 1933 et mon rapport au congrès de Varsovie 1933, Résumés, I, 287. (4) C . J. 2, 57, 1. (5 ) Voir notamment C. 4, 64, 8 où la phrase: eum huiusmodi .... muniatur a été ajoutée et où le mot competit a remplacé danda est; C. 2, 3, 10 = 5 , 14 , 1 et comparer le tetxe pur C. 4, 61, 6. EMILIO BETTI PROFESSORE ORDINARIO D ' ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO NELLA R . UNIVERSITÀ DI MILANO STRUTTURA E FUNZIONE PROCESSUALE DEI LIBELLI CONVENTIONIS E CONTRADICTIONIS uns SUMMARIUM Libellus conventionis, cum ius reddenti offertur, exprimit simplicem postu lationem , qua actor petit ut ei facultas rei conveniendi prestetur. Cum autem per exsecutorem reo traditur, debet libellus speciem tionis ei notam facere, quam tamen adhuc emendari vel mutari ei licet prout ius reddentis decernit aequitas. Conventio , quae cum editione actionis uno eodemque actu fit, necessi tatem imponit reo respondendi per libellum contradictionis. Lis autem tunc con testata dicitur, cum ius reddens per narrationem propositam et contradictionem obiectam causam audire coeperit : quo fit ut libelli vice scripturarum fungantur, per quas narratio causae praeparatur. Quae quondam propria erant litis conte stationis, tribuuntur in novo ordine iudiciorum praecipue conventioni, per quam lis inchoata vel controversia mota videtur * ). Il processo libellare del diritto giustinianeo offre un partico lare interesse storico, sia in senso retrospettivo, per le molteplici sopravvivenze degenerative del processo formolare – del quale tiene fermo, fra l'altro, il principio della tipicità delle actiones e tramanda l'uso di formole, conservateci nei commentari greci alla codificazione giustinianea - , sia in senso evolutivo , in quanto costituisce il punto di partenza dello svolgimento che, attraverso il diritto comune, condurrà al processo civile moderno. *) V.: WIEDING, Der justinianeische Libellprozess ( 1865), 129 sgg. 151 sgg.; 184 sgg.; BETHMANN-HOLLWEG , Civilprozess, III (1866 ), SS 150 -164: 227 sgg.; EISELE , Zur Geschichte der Ladung-denuntiation , in « Beitr . zur röm . Rechtsgesch » (1886 ), 268 sgg.; KIPP, Die Litisdenuntiation als Prozesseinleitungsform im 1. C. Pr. (1887), 184 sgg. ; 191 sgg. (altra bibliogr. in Costa, Profilo, 150 n . 1 ) ; BRUGI, Il nome dell' azione nel libellus conventionis giustinianeo, nel vol. « pel 500 anno d 'insegnam . del p . Pepere » (1900), 16 sgg. ; il nome dell' azione nel lib. proce durale del dir . greco rom ., nel vol. « per le onoranze a M . Amari » ( 1910 ) ; Istituz. dir . rom . (giustin .) (3a ed .) 149 ; 153 sg . ; MITTEIS , Grundzüge der Papy ruskunde II, 1 (1912), 32 sgg. ; 36 sgg.; STEINWENTER, Studien zum röm . Ver säumnisverfahren (1914 ), 110 sgg . ; 129 sgg. ; ALBERTARIO, « Lis contestata » e « controversia mota » , in « Rend . ist. lomb. » 47 (1914), 505 sgg. ; 565 sgg.; anche in « Z . Sav. St. » 35 , 305 sgg. (cfr. « Riv. it . sc . giur.» 52, 13 sgg.) ; R . SoHm, Die litis contestatio in ihrer Entuvicklung vom frihen Mittelalter bis zur Gegenwart 146 Emilio Betti Qui indagherò brevemente nel loro significato giuridico gli atti introduttivi del processo libellare, prescindendo da questioni di dettaglio che hanno minor interesse . Tale significato non sembra sia stato esattamente colto dal Collinet nel suo recente studio su « La procédure par libelle » (1932 ), pur così diligente nella infor mazione e minuzioso nell'analisi. Vanno considerate distintamente, anzitutto, A ) la struttura (forma) caratteristica degli atti proces suali in parola, inoltre, B ) la funzione loro sia a) in ordine al processo (i cosi detti effetti processuali) sia b) in ordine al rapporto (1914), 4 ; 89 sgg. ; WLASSAK, Zum röm . Provinzialprozess ( 1919), in « Sitz . Ber. Akad. Wien » 190, 4 : 36 sgg. ; Boyè, La denuntiatio introductive d ' instance sous le principat (1922), 247 sgg. 328 sgg.; FLINIAUX, in « Nouv. Revue histor. » 1923, 102 sgg. ; 195 sgg. ; Contribution à l' histoire des modes de citation au Bas Empire : la postulatio simplex, in essa riv., 1930, 194 sgg. ; PREMERSTEIN . Li bellus, in « Real- Encyki. d . klass. Alt. wiss » XIII, 1 (1926 ), 53 sgg. ; 56 ; 58 ; STEINWENTER , Neue Urkunden zum byzantinischen Libellprozesse, in « Festschrift f. Hanausek » ( 1925 ). 36 sgg . ; particolarmente Die Litiskontestation im Libell prozesse, in « Z . Sav. St. » 50 (1930 ), 184 sgg. ; BIONDI, Appunti intorno alla sen tenza nel proc. civ . rom . (1929) in « Studi Bonfante » IV , 47 sgg. (n . 10 - 16 ) ; Dir. e processo nella legislazione giustinianea , in « Conferenze per il XIV cent. delle Pandette » (1931), 165 sgg. (cfr. CHIOVENDA, in « Riv . d . sc . giur.» 1933 , 10 sgg.) ; COLLINET, Études historiques sur le droit de Justinien , IV : La proce dure par libelle (1932) trattazione fondamentale , ricca di notizie e d' idee : rec . crit . di STEINWENTER , in « Z . Sav. St. » 54, 373 -82, ove giustamente si combattono talune nuove vedute del C ., che anche noi respingiamo in questa comunicazione ( comunicazioni al congresso sul medesimo tema sono state fatte dal BALOGH e dal Biondi ; dello STEINWENTER, da ultimo, Die Anfänge des Libellprozesses, in « Studia et documenta historiae et iuris » 1935, 132 sgg.). Su singole innovazioni processuali : DE FRANCISCI, Synallagma : storia e dott. d . contr. innominati, II, 246 sgg . ; BETTI, La conditio pretii del proc. civ . giust., in « Atti accad . Torino » 51 (1915 - 16 ), 1019 sgg. ; BIONDI, Summatim cognoscere, in « Bull. dir . rom . » 30 (1921), 225 sgg. ; H . KRUEGER . Summatim cognoscere, in « Z . Sav. St. » 45 , 39 sgg . ; 84- 86 ; RICCOBONO, ivi 47, 107 sg. Delle trasformazioni di significato e di valore subite dai termini actio , exceptio , interdictum , tratterà il COLLINET nel Vo vol. di « Etudes » : intanto v . SCHULZ, Prinzipien d . röm . R . (1934), 64 n . 44 ; 67 sg . e lett. ivi cit.; sulla genesi storico-dogmatica del concetto della obligatio quale « mater actionis » , AFFOLTER, D . röm . Institutionem - System (1897 ), cap . IV , 70 sgg. 77 sg.; DONATUTI, Le preasumptiones iuris, in « Riv. dir. priv.» 1933, 188 sgg. ; in generale , ora , ALBERTARIO , Introduzione storica allo studio del dir. romano giustinianeo I (1935 ), cap. IV, 81 sgg. Die manuali v .: Mayr, Röm . Rechtsgesch . IV , 66 sgg. ; BERTOLINI, Appunti didattici, III, 129 sgg. ; Costa, Profilo 151 sgg. ; WENGER , Zivilproz. 256 n . 34 ; 265 sgg.; ARANGIO -Ruiz , Istituzioni 147 sgg. ; GIFFARD , Leçons de Procéd . civ . rom . 175 sgg. Struttura e funzione processuale ecc. 147 litigioso (i così detti effetti di diritto sostanziale) (1). In quale mo mento è radicata la litispendenza ? Vengono gli effetti di diritto sostanziale ricollegati alla notifica del libellus conventionis o alla instaurazione del contradittorio ? O vengono essi ripartiti fra l'una e l' altra ? Quale effetto si designa come « rem in iudicium dedu cere » ? Viene esso giustificato mediante finzione di un atto pro cessuale in realtà mancato, o ad un atto bilaterale cui si trasporta la qualifica di litis contestatio ? Adempiono forse i libelli, rispetto a tale atto, la funzione di scritture preparatorie ? Ecco una serie di questioni che concernono la funzione degli atti introduttivi del processo libellare. Ma cominciamo dalla loro struttura. A ) Quanto alla struttura del libellus conventionis (tò tỉs únouvň GEOS Bibliov), si domanda anzittutto che specie di documento fosse e quale dichiarazione ne costituisse il contenuto. Per quel che è dato argomentare ( 2 ) dai Papiri d 'Ossirinco ( vol. XVI) n . 1876 e 1877 (assegnabili, l'uno, all'anno 480 e l'altro al 488 all'incirca), il lib . conv. è un documento autografo (3 ), redatto in prima persona, il quale porta la sottoscrizione (unoyoagi ) della parte che lo presenta o nel cui nome è presentato (Oxy. Pap. 1877 lin . 10 : Ilaroidios Bongos roquevtſov &midédoxa (?) ]). La dichiarazione in esso contenuta consiste in una domanda, motivata da una serie di affermazioni. La domanda è indirizzata al magistrato , preside della provincia e amministratore della giustizia , e mira a ottenere da lui l' autoriz zazione a citare in giudizio l'avversario designato per nome (Oxy . Papyri XVI, n . 1876 lin . 8 : oös åžio tÒ Oòv mėyevog ratavaynaojivai ovve avveojai ngÒS εvyvouooúvnv xai.... n . 1877 lin . 7 - 8 : nagarađô tiiv υμετέραν μεγαλοπρέπειαν πρ[οστάξαι...] συνελαύνεσθαι προς ευγνωμοσύνην). Infatti il libello dev'essere preliminarıente presentato al magi strato, perchè ne autorizzi la notifica all'avversario : va quindi (1) Per la nozione dogmatica cfr. : CHIOVENDA , Principii di dir. proc. civ. ( 3& ed. ), 135 sgg.; 659-61 ; Istituzioni di dir . proc. civ. I, 146 sgg.; BETTI, Dir. proc. civ . (1933), S 15 : 309 sgg. ; 318 sgg. ; Diritto romano I, 608 sgg. (2) Esorbiterebbe dal nostro tema discutere della legittimità di illazioni come quella indicata : questione inseparabile dal problema delle origini del processo libellare. In proposito ved . da ultimo STEINWENTFR, Die Anfänge des Libell prozesses, in « Studia et documenta historiae et iuris » , 1935 fasc. 1. (3) Per la nozione dogmatica cfr. CARNELUTTI, La prova civile (1915, 194 sgg . 148 Emilio Betti sottoposto anzitutto alla sua approvazione. Sulla base di quali ele menti è il magistrato chiamato a dare l' approvazione richiesta ? Tali elementi sono le affermazioni che motivano la domanda di autorizzazione. Il libello deve enunciare le affermazioni di fatto indispensabili a identificare , almeno in via approssimativa e prov visoria , la ragione che s' intende far valere : e ciò , allo scopo di render possibile al magistrato adito un giudizio preliminare di rilevanza giuridica de' fatti affermati. Si esaminino infatti i papiri di Ossirinco . Nel Pap. 1876 lin . 4 -6 è detto : oi ÉENS Únotetaynévoi oquouevoi ånò... ÈXpeo ]ornoav qot pa νεράν χρυσίο[υ] ποσότητα κατά την δύναμιν της γεγενημένης εις εμέ παρ' αυτών χειραγραφίας, υποθέμενοι εις το [χρέος..... επειδή ούν διεληλύθασιν ενιαυτοί δεκαπέντε εξ ου διά της φυγής περιγράφειν το χρέος εσπούδασαν, ουδείς δε αναφαίνεται και υπέρ τούτων μοι [αποκρινόμενος (?)]. Nel Pap. 1877 lin . 5 -7 si legge : oi eins Únotetay’évoi doubļevot [dò.... Tejuvoi tot vaº lot xac cac bapopos todos, xa optop λάκις παρ' εμού υπομνησθέντες.... ευγνωμοσύνης προς εμέ θέσ] θαι ουκ ήνέσ xovto toù ov[v ]xogεiv. Cfr. anche Pap. 1881 lin . 10-11 : aitiaoamévov ήμας περί χρέους. Come si vede, la ragione che s'intende far valere viene desi gnata mediante una enarrativa abbastanza estesa ( contro l'opinione di Bethmann- Hollweg , Civilprozėss III, 243). Il che è conforme anche alla pratica giudiziaria antecedente , nella quale andò matu randosi il processo libellare: si ricordi C . Theod . 2, 4 , 6 (inter ipsa cognitionum auspicia rationem exprimere ac suas allegationes iubeatur proponere). Del resto , la formulazione appare essenzialmente libera, non legata all' osservanza di schemi logici e sanzionata solo dal rischio di non veder concessa la chiesta antorizzazione per insufficienza o incertezza circa la ragione da far valere. Sotto questo aspetto il libellus conventionis, considerato nel momento in cui è presentato al magistrato , si differenzia profondamente dalla formula del processo formolare . Se ne differenzia non solo perchè non enuncia conclusioni di merito paragonabili alla condemnatio della formula (le conclusioni - condanna, accertamento etc. — sono proposte in una fase successiva) nè affermazioni di circostanze im peditive o estintive raffrontabili alla exceptio (Wieding, Justin . Libellprocess ( 1865 ), 401), ma soprattutto perchè manca di quel rigore logico che governa la intentio della formula . Il che sembra naturale , quando si pensi che in esso la premessa enarrativa serve Struttura e funzione processuale ecc. 149 soltanto a giustificare la domanda di autorizzazione alla chiamata in giudizio . Deve nel libello essere specificato il rapporto litigioso attra verso la definizione tecnica del nomen actionis ? La questione non può essere risolta esattamente , se non vien posta in termini esatti ; e a questo fine occorre, a mio avviso , ben distinguere le due fasi che il libello attraversa : a) la fase preliminare, in cui viene pre sentato al magistrato e b ) la fase ulteriore, in cui viene notificato all'avversario. Rispetto alla fase preliminare la soluzione non può essere che negativa, perchè il preventivo giudizio di rilevanza giuridica non esige quella definizione. Le testimonianze richiamate dal Brugi (da ultimo in Istituzioni di dir. rom ., 34 ed., 149, 153-54 ) in tal senso si riferiscono in realtà, se mai si ritengano probanti, alla fase successiva (cfr. Collinet, op . cit., 51-55 ). Riguardo a questa seconda fase, peraltro, le testimonianze sembrerebbero a primo aspetto contradittorie . Perchè accanto a quelle addotte dal Brugi ve n ' è un 'altra che indurrebbe a concludere in senso negativo : quella di C . J . 7, 40 , 3, 3. Ma si vedrà più oltre come l' una e le altre vadano interpretate. Considerato , dunque, nella sua fase preliminare, il libello non è che una domanda di autorizzazione alla chiamata in giudizio : domanda unilaterale, cui vanno riferite le denominazioni di postu - latio simplea e di μονομερής εντυχία (cosi gia Fliniaux, Contribution a l'histoire des modes de citation au Bas-Empire, in Revue hist. de droit fr. et étranger, 1930, p . 194 sgg . partic . p . 221 -22). Decisiva in tal senso è anche la gradazione logica e cronologica in C . J. 3, 9 , 1. Non sembra potersi accogliere la contraria tesi del Collinet (op . cit., 241 segg., partic. 255 sgg .), che vorrebbe ri ferire la postulatio simplex a un momento ulteriore del processo , e cioè a quello denominato litis contestatio. Inconcludente , fra altri, è l'argomento che si vorrebbe trarre dalla definizione che del po stulare si dà in D . 3 , 1, 1 , 2. Certamente fra lib. conv. e postulatio non c' è coincidenza, perchè vi può essere una postulatio senza li bello ; ma il punto essenziale è questo : che all'atto della sua presen tazione al magistrato il libello esprime e documenta una postulatio. Sulla postulatio simplex documentata nel libello il magistrato provvede, dopo una cognizione sommaria , mediante un decreto : ånógaois (Oxy. Pap. 1881 lin . 11 ), drażania , interlocutio - non sen tenza (Chiovenda, Preclusione e cosa giud., in Riv . it. sc. giur. 150 Emilio Betti 1933, 11 sgg .). Il decreto suona autorizzazione per il postulante e ordine all'ufficio (rášis) dipendente (Oxy. Pap. 1877 lin . 12 : Ý tugis ÚnouvÝDel....). Ordine e autorizzazione, peraltro, la cui efficacia è subordinata – secondo le norme delle Novelle 112 (cap. 2 proem .) e 96 ( cap. 1) – alla condizione che l' attore si assuma, verso l'auto rità giudiziaria adíta, l'obbligo di continuare la causa una volta promossa , proponendo le sue conclusioni entro un termine che decorre dalla conventio : obbligo, la cui inosservanza (lapsus tem poris) ha per sanzione la sua decadenza (causa cadere : arg. da C . Theod. 2, 6 , 1). Forte di tale autorizzazione e previa assunzione di siffatto obbligo, l'attore richiede e incarica un subalterno del magistrato ( ènßißaotńs, exsecutor ) di notificare il libello al convenuto, citandolo in pari tempo in giudizio . Prima, però , di essere notificato, il li bello dev' essere non solo modificato nella sua redazione (che va fatta in seconda persona), ma soprattutto integrato con talune in dicazioni, dirette a identificare con maggior precisione di quanto non sia stato fatto prima il tipo del rapporto litigioso, in partico lare specificando il nome tecnico dell'actio esperita . Ciò si trova attestato in modo preciso da una fonte attendibile quale il catalogo pregiustinianeo de actionibus (Zeitschr. d . Sav. St. XIV ), dove, al § 1 , è detto : ÉV TO SIANÉNA EO a 1 Bibiiov åváyun Ogiteoðai tiv åyoyv: nel trasmettere , cioè, il libello al convenuto , l'attore ha l'onere di definire il nomen actionis. E al § 2 si rende ragione di questo onere : χρή δε τον ταύτην υποδεχόμενον διασκοπείν ει το φορώ εκείνω υπο keitai: vale a dire , la definizione del nomen actionis serve a met tere il convenuto in grado di riscontrare se vi siano le condizioni per la trattazione del merito , in particolare, se il giudice adito sia competente a conoscere della causa in suo confronto. Questa testimonianza, per sè sola decisiva, ricevo poi appoggio da altre convergenti nel medesimo senso, richiamate dal Brugi : Basil. 7 , 18 , 1 (ove si parla di un edere actionem in senso che diremmo moderno – επιδείξαι την αγωγής – e di un χαρτίον dal quale, come dall'antico albo pretorio , va desunto il nome dell’actio edita) ; Pa raphrasis ad Inst. (Ps. Theoph.) 4 , 15 , 8 e ancora Basil. 60, 19, 1 schol. 6 di Doroteo. Sintomatica in questo senso per la pratica giudiziaria postclassica è anche la Consultatio V , 2 ; 7 (quotiescumque ordinatis actionibus aliquid petitur, ideo petitor cogitur specialiter genus litis edere, ne plus debito aut eo quod competit postuletur) ; VI, 2 . 151 Struttura e funzione processuale ecc. Nè potrebbe addursi, credo, in senso contrario la interpreta zione autentica o, se si vuole ritenerla tale, la riforma operata daila nota costituzione di Giustiniano del 531 – C . J. 7 , 40, 3 3 (1) – la quale stabili che « qui obnoxium suum in iudicium cla maverit et libellum conventionis ei transmiserit, licet generaliter nul lius causae mentionem habentem vel unius quidem specialiter, tan tummodo autem personales actiones vel hypothecarias continentem , nihilo minus videri ius suum omne eum in iudicium deduxisse » . La portata di questa legge processuale interpretativa non è già quella di ammettere libelli « astratti », sforniti di qualsiasi enunciazione della ragione fatta valere (così Collinet, op. cit. 41): giacchè, se sono concepibili negozi astratti (come ad es. cautiones indiscretae), non è invece configurabile — per la stessa natura e funzione che le è propria - una domanda giudiziale astratta (4 ). L 'espressione « causa » , di cui si dice irrilevante una indicazione specifica nel libello , non significa lo stesso rapporto litigioso, ma la fattispecie generatrice di esso (5). La legge mira a reprimere l'abuso di eccezioni cavilla torie e vuol dire solo che, per l'effetto d ' interrompere la prescri zione estintiva, basta – nel libello notificato – contrassegnare il rapporto litigioso come actio personalis o hypotecaria , salvo a pre cisare o ad integrare più oltre la deficiente o incompiuta indica zione della fattispecie . Alla notificazione (editio actionis in senso giustinianeo), che ha per oggetto il libello col nomen actionis, si accompagna la chiamata in giudizio (usouvnois, conventio), fusa con essa in un atto solo. Atto di parte, questo, piuttosto che atto d 'autorità , sia pure compiuto dietro autorizzazione del magistrato e per ministero dell'exsecutor da lui dipendente e irrecusabile da parte del citato . Esso trova il suo precedente storico mediato in quella specie di denuntiatio che era praticata nel processo delle provincie (6 ) e che il Wlassak (4 ) Cið deriva dalla diversa funzione giuridica della domanda giudiziale : la quale non è destinata – come il negozio – a dettare un certo regolamento d ' interessi (che può fare a meno di esprimere la causa ), ma, per l'appunto, a provocare l'accertamento di un concreto precetto di diritto obbiettivo : essa è quindi concettualmente coordinata all'affermazione di tale precetto e, in questo senso, sempre causale (cfr. « Riv. dir. proc. civ . » 1932, 218 sg.). (5 ) In proposito, nostro « Diritto romano > I, 642. (6 ) Dopo i persuasivi rilievi dello STEINWENTER, Anfänge d . Libellpr., 150 -52, bisogna però accentuare il carattere mediato di tale derivazione. 152 Emilio Betti (Zum röm . Provinzialprozess, 36 sgg.) ha proposto di qualificare semi-ufficiale con riguardo all' ibrido miscuglio che presenta di un atto d 'autorità con un atto di parte (Steinwenter, Festschrift f. Hanausek, 51; Z . Sav. St. 50, 186 sg. e scrittori ivi citati a p . 186 ). Esteriormente considerato, codesto tipo di chiamata in giudizio può classificarsi fra i sistemi così detti di citazione mediata , ove si assuma per criterio differenziale la circostanza che la chiamata in giudizio, anzi che essere immediata da parte a parte ( come nel l'antica vocatio in ius o nella privata testatio abolita da Costan tino : C . Theod . 2, 4, 2) o anzi che esser commessa direttamente dalla parte all' ufficiale giudiziario senza previa permissione del inagistrato (come nella citazione ordinaria dell'odierno processo italiano), viene ordinata o previamente autorizzata dal magistrato. Sotto l'aspetto intrinseco tuttavia , giova tener presente questa es senziale differenza : che la previa presentazione del libello al ma gistrato non ha punto la portata giuridica (che ha invece negli odierni sistemi di citazione mediata ) d 'investire effettivamente della domanda il giudice adito prima ch 'essa venga notificata all'av versario . Essa non è che un atto preparatorio della conventio, al quale non si ricollega alcun effetto conservativo sostanziale . . . Il tenore della chiamata in giudizio è quello di una dichia razione comminatoria , che mette il destinatario (ormai convenuto) di fronte all'alternativa di riconoscer fondata la ragione fatta va lere soddisfacendo il diritto affermato, o di contestarla assumendo su di sè il rischio del processo. Ciò è attestato da : Oxy . Pap. 1877 lin. 12 -13: casts 0 oụnjo£i gò bioms cas coũ companievo0 C ) didaoxahių [.... ñ ávtideyov]tas dináoaojai Bibliov enoteNOMÉvovs. Oxy. Pap. 1881 lin . 11 - 12 : tñs inoqÚoEWS.... tis Bovãouévns ņ diakuoaojai i diráoaojar. Berl. Griech . Urk . 2745 lin . 15 -16 : ÜROUVNodroovtai dià της τάξεως ή το δέον δίκης εκτός επιγνώναι η αντιλέγοντες δικάσασθαι εν τω δικαστηρίων . Ove il convenuto si risolva a contestare, la sua risposta deve avvenire nella forma di un documento, che si dice libellus contra dictionis, tò tìs årtiogijoeng Bibhiov, åvteniotahua. Nella stessa risposta il convenuto, dopo aver contestato la ragione fatta valere , deve assumere l'obbligo di costituirsi in giudizio comparendo dove sarà tenuta l'udienza , e di proseguire la propria difesa fino ad esau rimento del giudizio . Si veda soprattutto Oxy. Pap. 1881 lin . 12 - 13 ; 15 -20 : ÉNELQIGÓNevoi toivvu tois MÉTÉQOLG Dualois kis TÌv déſovo ]av Struttura e funzione processuale ecc. 153 αντίρρησιν εληλύθαμεν....κατά τούτο ομολογούμεν εξ αλληλεγγύης επομνύ μενοι.... επί τώ ημάς εντεύθεν ήδη αναπλε[0] σαι εις την τάξιν όπου δ' αν διάγει το δικαστήριον και δικάσασθαι προς τον προκείμενον αντίδικον και μη απολιφθήναι άχρι πέρατος τύχη τα της υποθέσεως [ε]ις [το ] εν μηδεν]ί ημάς ueuqdival. Inoltre : J. 4, 11, 2; C . J. Lat. VIII, 17, 896 (su cui Cuq, Inst. 891 n . 2) e, per il termine dilatorio dialmeno 20 giorni per l' innanzi, di 10) che deve intercedere prima dell'udienza, Nov. 53, 3 , 1 e 2. Posto che il convenuto risponda - come è suo onere – il libellus contradictionis viene a sua volta notificato , per ministero dell'exsecutor , all'attore. I due libelli notificati formano cosi una narratio e una corrispondente contradictio preliminare, le quali sono destinate a preparare l' udienza in contradittorio e a predisporre la discussione orale del merito , che in questa dovrà svolgersi : di scussione, codesta , alla quale viene trasportata, con profondo mu tamento di significato, la vecchia denominazione di litis contestatio, ngoKÁTagiS (C . J. 3, 1, 14 , 4 (1) : cum lis fuerit contestata , post ( = per ) narrationem propositam et contradictionem obiectam ; C . J. 2 , 58 (59), 2 pr.; C . J. 3 , 9, 1 cit. più oltre ). Narratio negotii e con tradictio si chiamano rispettivamente durimmois tis inodégewS e åvtina tártaois (sulla struttura della l. contestatio cfr . C . Th . 4 , 14, 1 ; 10, 10 , 27, 5 ; d'altro avviso , R . Sohm , Litis contestatio , 4 ; 89 sgg. il quale vi ravvisa non un atto processuale , ma la designazione di un momento del processo, in cui entrerebbe in vigore la finzione di una litis cont. nel senso classico ; ma sulla vera portata della fictio affermata in qualche testo v . più oltre sub Bb , 155). B ) Questa ora brevemente descritta è la struttura degli atti introduttivi del processo libellare , quale si desume da una spre giudicata valutazione delle testimonianze di cui oggi disponiamo. Resta ora a parlare della funzione, cioè degli effetti a ) di di ritto processuale e b) di diritto sostanziale. a ) Diciamo anzitutto degli effetti processuali. Per quanto concerne la previa presentazione del libello al magistrato , non è da credere che essa sia un atto autonomo dotato di effetti proces suali propri. La sua funzione è puramente quella di render possi bile, cioè formalmente legittima, la conventio , provocando il decreto che dovrà autorizzarla . Neppure il decreto di autorizzazione segna l' inizio del processo : ma è destinato soltanto a giustificare esso Roma · II Emilio Betti 154 inizio, il quale però è sempre rimesso all'apprezzamento della parte, che potrebbe anche non farne nulla . Soltanto la chiamata in giu dizio (conventio ), con la notifica del libellus conventionis cui va con comitante, vale a radicare la litispendenza , a costituire cioè il rapporto processuale fra i litiganti - che soltanto ora diventano attore e convenuto – e fra ciascuno di essi e il giudice adito . Anzitutto, essa fissa nell'attore e nel convenuto la qualità di soggetti del rapporto processuale relativamente alla ragione pro posta a giudizio. Dall'un lato, a carico dell'attore, spiega effetto preclusivo sull' actio esperita nel senso che gl'impedisce di far valere ancora e altrove la medesima ragione e lo espone a decadenza per inerzia processuale nel termine che ne decorre (C . J. 2 , 2 , 4 pr. e 2 : ο άπαξ αίτιασάμενός τινα ... μετά υπόμνησιν προσενεχθείσαν αυτό μηκέτι τον aỏtov 0316000 + ... aicuảo0o ... Già Tộ Tool Sukaơn Tawauf =to ). D'altro lato, a carico del convenuto , crea un onere di rispondere la cui inosservanza è sanzionata dal rischio della contumacia (C . J . 1 , 12 , 6 , 4 : si hoc facere detractat aut differt, iudiciorum legumque solitus ordo servetur) e gli preclude eventuali eccezioni declinatorie del foro desumibili da circostanze sopravvenienti dopo la notifica , operando ne' suoi riguardi una perpetuatio iurisdictionis (C . J. 2 , 2 , 4 , 1 : 0 dè tijv únouvNOI değáuevos ei vai els Étégav ļetaotain taşiv ,..., αποκρινέσθω πάντως εν το πρώτο δικαστερίω ..., μηδεμίαν έχων φόρου πα payoagir). Inoltre, la notifica del libello (editio actionis nel nuovo signifi cato giustinianeo) ha, a norma di C . J. 2, 1, 3 (cfr. § 2 del cata logo de actionibus), la specifica funzione processuale d 'identificare e di portare a cognizione del convenuto la natura dell'actio e della controversia , che da questo momento si designa con termine tec nico quale actio o controversia mota ( D . 5, 3, 25 , 7 ; C . Th. 2, 4 , 1 pr. C . J. 7, 16 , 11 ; 31 ; 7 , 19, 5 ; 7, 45, 8 : Albertario , Rendiconti dell' Ist. Lomb. 1914, 510 ; 565). Il tenore attuale della cit. costit. è il prodotto di una interpolazione facilmente determinabile : edita actio (speciem ] (...) (?) futurae litis (contestationis) (demonstrat], [quam emendari vel mutari licet], prout edicti perpetui monet auctoritas (vel ius reddentis decernit aequitas] (species = eidus, quous tis åroris). Dove è interessante notare che nel nuovo processo neppure con la notifica del libello la ragione fatta valere viene identificata in modo definitivo, essendo rimesso in facoltà dell'attore – facoltà , per vero, controllata dall' apprezzamento discrezionale delmagistrato 155 Struttura e funzione processuale ecc. – apportare al libello notificato quelle integrazioni e correzioni che sembrino più convenienti anche in corrispondenza con la risposta che sarà stata data dal convenuto nel libellus contradictionis. b ) Ora possiamo domandarci: quali effetti di diritto so stanziale – in ordine cioè al rapporto litigioso – si ricollegano alla notifica del libellus conventionis ? In massima è da ritenere che ad essa siano ormai fatti risalire, sia direttamente , sia indiretta mente – attraverso una finzione di retroattività – quegli effetti di carattere conservativo , che consistono nel preservare il rap porto litigioso da eventuali fatti estintivi sopravvenienti e che nel processo formolare si ricollegavano invece alla litis contestatio (7 ). Tale, in particolare, la perpetuatio di un'actio di carattere temporaneo, che consiste in sostanza nella rimozione di una decadenza inerente alla vita del rapporto giuridico : Basil. 23 , 1 , 70, schol 5 di Thalel. : πάσα γαρ αγωγή και παραγραφή πρόσκαιρος μεθ ' υπόμνησιν διηνεκής γί vetai. Tale parimenti la ormai possibile trasmissione all' erede di un rapporto giuridico per sè intrasmissibile (cfr. C. Th. 1, 2, 10, a . 396 ). Tale ancora la interruzione della prescrizione estintiva , attestata dalla costit. giustinianea C . J. 7 , 40, 3, che si è già avuto occasione di richiamare. Rispetto a quest'ultimo effetto è caratte ristica la finzione di una litis contestatio con la quale si cerca di giustificarlo in una costit. dell'anno 331, che a mio avviso consente di argomentare per analogia al processo libellare - C . J. 3, 19, 2 , 1 : tamquam lite quae ei ingeritur ex die , quo possessor ad iudicium vocatus est, ad interrumpendam longi temporis praescriptionem con testata . Si opera qui con una finzione di retroattività che proba bilmente ha senso anche per il processo libellare . Si potrebbe in fatti dubitare che decorrano contemporaneamente dalla chiamata in giudizio tanto il termine di decadenza prefisso all'attore per la proposizione delle sue conclusioni definitive quanto il nuovo ter mine di prescrizione che presuppone radicata la litispendenza (Stein wenter, in Zeitschr. d . Sav. St. 50, 188 -89). Ma la incompati bilità logica fra i due termini scompare , ove si pensi che il nuovo termine di prescrizione non cominci effettivamente a decorrere se non a litis contestatio avvenuta : da questo atto , peraltro , con ef fetto retroattivo al momento della conventio. (7 ) Su di essi v. ora nostro « Diritto romano » I, 608 sgg. ; e per la distinzione dagli effetti di carattere attributivo (satisfattivo), ivi, 612. 156 Emilio Betti In ogni modo, però, è forza riconoscere che non tutti gli ef fetti di diritto sostanziale propri della litis contestatio formolare sono stati ora trasportati alla chiamata in giudizio o giustificati con una finzione di retroattività della nuova litis contestatio libel lare. Questa non solo è un atto processuale nettamente distinto dalla citazione in giudizio così sotto l'aspetto cronologico come sotto quello funzionale (cfr. Wieding, Libellprozess, 337 sg.; Mitteis , Papyr. 41; Fliniaux, in Revue historique 1923, p . 195 ; Riccobono , in Z . d . Sav. St. 47, 106 ; Steinwenter, ivi, 50, 188 sg.), ma ha anche taluni effetti sostanziali suoi proprî. Rispetto ad essa i libelli adempiono la ulteriore funzione processuale di scritture prepara torie : scritture indispensabili in ogni processo che, come quello libellare, è ispirato al principio dell'oralità . In essa l'attore pro pone al giudice la sua intentio (évayori ), prende le sue conclusioni definitive. E perciò , solo con essa si ha propriamente - a norma di C . J . 3, 9, 1 – la in iudicium deductio , intesa come fissazione definitiva del tema della controversia, che ora soltanto si qualifica come lis inchoata . Dispone la citata costit . – notoriamente inter polata (Steinwenter, Versäumnisverf. 130 n . 2 ; Wlassak, Anklage und Streitbefest. 180, n . 89 ; Boyé, La denuntiatio introd. 249 n . 38 ; Fliniaux, Revue hist 1923, 102; Wenger, Zivilpr. 278 ; Goldschmidt, Der Prozess als Rechtslage, 89 sg. ; Lenel, Ed.3 61, n . 5 ; Steinwenter, Z . Sav. St. 50, 199, n . 3 ; Collinet, Procéd. par lib . 208 ; 317 sg .) – « res in iudicium deducta non videtur, si tantum (postulatio simplex celebrata sit vel] [actionis species ] (formula iudicium reo (cognita ] (edita est ). inter litem enim ante contestatam et editam [actionem ] (formulam ) permultum interest. (lis enim tunc vi detur contestata, cum iudex per narrationem negotii causam audire coeperit] » . Ora a codesta funzione processuale della litis contestatio libel lare corrispondono varî effetti. Non solo l'effetto (processuale ) che da essa, e non dalla chiamata in giudizio , decorre la perenzione della litispendenza statuita da C . J . 3, 1, 13 ivi, $ 1 : non ultra triennii metas post litem contestatam ). Ma vi corrisponde anche come è logico - l' effetto di radicare in capo al procurator even tualmente costituito il dominium litis, inteso come la spettanza dei poteri derivanti dal rapporto processuale , poteri che in caso di sua morte passano al rappresentato ( C . Th . 2, 12, 7 ). E soprat tutto vi corrisponde, secondo ogni probabilità , quell'effetto sostan Struttura e funzione processuale ecc. 157 ziale che ha per eccellenza il carattere di un prodromo della sen tenza positiva di accoglimento : l'effetto cioè di fissare il rapporto litigioso, determinando l' ambito di quanto sia per spettare all' at tore nell' ipotesi di accoglimento della domanda. Quantunque ciò non sia detto esplicitamente, deve tuttavia ammettersi per logica illazione come conseguenza della funzione assegnata alla litis con testatio libellare, di segnare la deductio in iudicium . Se infatti è naturale che gli effetti conservativi si producano sin dal momento in cui l'attore ha manifestato al convenuto – chiamandolo in giu dizio – il proposito di far valere il proprio diritto, non sarebbe logico stabilire altrettanto per l'effetto prodromico in parola , una volta che la chiamata in giudizio non preclude punto all'attore la facoltà – controllata dall' apprezzamento del magistrato ( C . J . 2, 1 , 3 : sopra sub a ) – d ' integrare, correggere o mutare, in confor mità con la risposta data dal convenuto , le affermazioni dirette a identificare la ragione fatta valere. Pare legittimo concludere che alla litis contestatio libellare si ricolleghino quelli, fra gli effetti propri della litis contestatio clas sica, che hanno carattere attributivo (satisfattivo), in quanto inte grano il contenuto della sentenza di accoglimento : laddove quelli che hanno carattere conservativo si ricollegano già alla conventio , ossia alla notifica del libello . BIONDO BIONDI PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO ROMANO NELLA UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO IL PROCESSO CIVILE GIUSTINIANEO (METODO E SPUNTI DI RICOSTRUZIONE ) 4 - - - - - - 1 .. . .. SUMMARIUM Ius processuale civile tempore Iustiniani profluit non ex formulis, sed ex cognitionibus extra ordinem , quae iam ineunte primo saeculo oriuntur. Collectiones iuris ab Imperatore Iustiniano confectae, ut ipse dicit, elementa et regulae vivae et mortuae complectuntur. Quare ius Iustiniani non ex omnibus fragmentis et legibus quae in C . I. inveniuntur, sed potius ex interpolationibus et constitu tionibus sive ipsius Iustiniani sive praecedentium Imperatorum ad cognitiones pertinentibus deduci oportet. 1. Mentre il sistema delle legis actiones e formulare ha formato obbietto di studi approfonditi, tanto che le nostre conoscenze sono relativamente precise, il processo giustinianeo nella letteratura mo derna è quasi del tutto trascurato . Le opere del Wieding e del Bethmann - Hollweg, tanto per ricordare le trattazioni più ampie ed organiche, presentano i difetti che tutti sanno : troppo superficiale e descrittiva la seconda, troppo astratta , talvolta fantastica, la prima. La lacuna si riscontra anche nelle pregevolissime esposizioni del processo civile romano del Ber tolini, del Costa , del Wenger e del Giffard , nonchè nei libri di Istituzioni e di Storia , giacchè al processo giustinianeo si trova de dicata una parte troppo esigua e sommaria in confronto delle fasi precedenti. Questa trascuratezza, che peraltro non è limitata al campo processuale (basta aprire qualunque libro moderno di Istituzioni per accorgersene), non ha alcuna giustificazione : se è vero che il diritto giustinianeo ha perduto ogni forza di legge e non presenta quei pregi di perfezione tecnica del diritto classico, non è meno vero che l'epoca giustinianea conclude l'evoluzione romana del di ritto, e costituisce il punto di partenza di quella successiva riela borazione dei materiali giuridici romani che doveva sboccare nel diritto moderno. ! Trascurato o non precisato il diritto giustinianeo , risulta incerta , se non addirittura falsata , tutta la storia del diritto . Nè si invochi quella splendida fioritura romanistica dei secoli scorsi, giacchè essa rappresenta solo la continuazione del diritto giustinianeo : non ci 162 Biondo Biondi presenta l' assetto giuridico al tempo di Giustiniano, ina costituisce piuttosto l'antecedente immediato delle moderne legislazioni. Appunto perciò richiamo l'attenzione degli studiosi sulla ri costruzione del processo giustinianeo, la cui conoscenza, come si vedrà, ha la massima importanza anche per la stessa conoscenza delle sorti del diritto al cadere dell'epoca classica, e gioverà a comprendere meglio la linea della evoluzione del processo dopo Giustiniano, nonchè la formazione del processo moderno. 2. Si pubblica or ora un magnifico volume del Collinet sulla procedura per libello, che rappresenta una profonda revisione delle fonti. Però a me sembra che qui lo storico abbia sopraffatto il giurista. L ' insigne romanista infatti, seguendo la tendenza comune degli storici del diritto giustinianeo, dichiara in via programmatica di servirsi del metodo storico esegetico. Non intendo discutere questioni di metodo, giacchè sono ben persuaso che sia ottima qualunque via che ci conduca a scoprire la verità . È necessario però precisare il problema e porre esatta mente l'obbietto della indagine. Orbene nel nostro caso si tratta di ricostruire organicamente il sistema processuale giustinianeo, quale fu concepito dal legislatore. Mai bisogna dimenticare che Giusti niano non è semplice raccoglitore, ma legislatore. Ed allora non basta raccogliere scrupolosamente tutte le fonti e sottoporle ad esegesi penetrante, ma bisogna tener conto di un elemento decisivo, che è la volontà del legislatore. Pertanto non possiamo affidarci unicamente alla esegesi ed alla valutazione storica delle fonti. Anzitutto è notissimo che il Corpus luris è ben lungi dal contenere un compiuto sistema processuale : molto è presupposto sia nei con cetti che nel meccanismo pratico. Ed inoltre nel nostro campo il contrasto tra elementi disparati è più manifesto : accanto a dispo sizioni delle XII Tav. abbiamo Novelle di Giustiniano. Orbene se in tema di diritto sostanziale è possibile parlare di sviluppi e con tinuità storica, è certo che in materia processuale è avvenuto un profondo rivolgimento, dalle formule al processo extra ordinem . Ora io non contesto la necessità della esegesi ; dico solo che non è sufficiente. L ' elemento storico -esegetico è certo il punto di partenza ; ma la ricostruzione del processo , come in genere del di ritto giustinianeo, non può prescindere dalla ovvia considerazione che il Corpus Iuris, nel pensiero di Giustiniano, è un organico corpo Il processo civile giustinianeo 163 di leggi. Troppo spesso si è dimenticato , specie dai moderni, che le compilazioni giustinianee non sono soltanto raccolta di materiali giuridici, ma piuttosto organico sistema legislativo, animato da un proprio spirito e da una propria volontà legislativa . Pertanto la ricostruzione del processo giustinianeo non può esaurirsi in una più attenta valutazione degli elementi storici od in una più accurata esegesi delle fonti ; nò il progresso in tale ricostruzione può riporsi soltanto nella scoperta di nuovi documenti giudiziari che ci rap presentino il processo nella sua viva realtà , ma piuttosto in una più esatta e profonda penetrazione dello spirito che anima ed orienta il sistema legislativo giustinianeo . Con ciò nulla propongo di nuovo, ma credo di applicare al diritto giustinianeo quello stesso procedimento che è consueto nella ricostruzione di ogni diritto vigente. Bisogna dunque considerare il diritto giustinianeo, non come rudere storico , ma come diritto vivo al tempo di Giustiniano. Occorre certo procedere dalla storia e dalla esegesi del testo , senza di che le nostre ricostruzioni risul terebbero arbitrarie , ma è necessario, attraverso tali indagini, colpire la volontà legislativa, onde ricostruire organicamente il si stema. Ed ecco perchè io sono convinto che i migliori interpreti del processo giustinianeo siano stati sempre gli scrittori del diritto co mune, ad incominciare dalla Glossa, i quali, ignoranti di storia e mediocri esegeti, ma grandi giuristi, hanno saputo isolare la vo lontà legislativa di Giustiniano dal caos della compilazione. Osserva esattamente il Savigny che, nonostante le dichiarazioni delle fonti, una applicazione della litis contestatio romana neppure fu tentata dagli antichi interpreti, anche perchè di essa non si aveva suffi ciente cognizione. Il rilievo potrebbe generalizzarsi, giacchè la igno ranza intorno agli istituti processuali formulari contribuiva alla retta intelligenza dei principi della legislazione giustinianea. Noi moderni ci troviamo in condizioni più svantaggiose , a causa appunto delle nostre migliori conoscenze del processo formu lare, poichè talvolta siamo tratti inconsapevolmente ad attribuire agli istituti formulari, che troviamo ancora nel Corpus Iuris, quello stesso valore , o poco difforme, che avevano prima. Gli antichi inter preti li intendevano, cosi come si potevano intendere nel sistema giustinianeo, ma falsavano la storia ; noi li intendiamo esattamente come erano intesi al tempo delle formule, ma falsiamo lo spirito 164 Biondo Biondi della legislazione, perchè difficilmente sappiamo sottrarci al mi raggio delle nostre conoscenze storiche . 3. Per la ricostruzione del processo giustinianeo bisogna par tire da una premessa. Il processo giustinianeo non si riattacca al processo per for mulas, ma piuttosto conclude la evoluzione di quella cognitio extra ordinem che, sorta in modo confuso e sporadico fin dal I sec. del l’ Impero, si organizza gradatamente nella prassi giudiziaria classica e postclassica , finchè potò divenire compiuto sistema nel Corpus Iuris. Nessun addentellato o trasfusione di principî dalle formule , giacchè si tratta di diversi sistemi aventi diversa impostazione. Si può dire che null'altro hanno in comune all' infuori di quella ge nerica funzione inerente a qualunque sistema processuale . La cognitio sorge non come inesplicabile degenerazione del l'ordo, ma piuttosto come una neoformazione giuridica , dal lato sia processuale che sostanziale , del tutto autonoma ed indipendente, la quale per tutta l'epoca classica coesiste, come qualche cosa di eccezionale e di secondario , con il sistema giuridico rispecchiato dalle formule . Che cosa è infatti la cognitio, che assai efficacemente si chiama appunto extra ordinem ? Non si tratta certo di tutta la legislazione imperiale, giacchè buona parte di questa si inquadra nel sistema giuridico esistente, o le relative innovazioni possono attuarsi nel quadro dei principi esistenti e per mezzo delle formule. La cognitio è invece altra cosa . Si tratta di ordini del Principe, emanati da prima per casi singoli e rispetto a determinate persone, che stanno tanto fuori il sistema giuridico , che per essi non può adattarsi al cun schema di formula ; si pensi al fedecommesso, agli alimenti, alla pollicitatio ecc. ecc. Ordini che gradatamente vengono applicati a casi uguali ed anche analoghi in guisa da dar luogo a principi generali. E poichè tali ordini non potevano avere attuazione per mezzo delle formule, se non si vuole supporre che il Principe avesse voluto fare uno scherzo od una semplice raccomandazione, bisogna ammettere che Egli dovesse altresì provvedere all' attua zione dell'ordine emanato . Ed invero nel complesso dei poteri del Principe si trovava base giuridica e mezzi sufficienti non soltanto per imporre una determinata condotta ai singoli, ma altresì per provvedere alla relativa esecuzione. Il processo civile giustinianeo 165 Si delinea cosi all'orizzonte la cognitio, la quale a torto finora si è considerata solo sotto l'aspetto processuale. Essa è invece so stanza e processo . Il Principe infatti non pensa di instaurare un nuovo processo , nè la cognitio si attua nelle provincie imperiali per semplificare il processo , giacchè, se così fosse, non si comprende rebbe come la cognitio potesse coesistere con l' ordo per due o tre secoli, ed avere anzi rispetto a questo una funzione secondaria. La creazione di un nuovo processo , che man mano si organizza non ebbe lo scopo di soppiantare le formule, ma soltanto fu mezzo per dare esecuzione a quelle ordinanze del Principe che non rientra vano nello schema delle formule . La cognitio ha dunque una fun zione più vasta : il Principe emana degli ordini e provvede alla loro esecuzione. Ecco i due lati, sostanziale e processuale , della co. gnitio ; essi si presentano come inseparabili, e l'uno suppone l'altro. Abbiamo pertanto un nuovo diritto ed un nuovo processo, im perniati sull'autorità del Principe. È lo Stato che, direttamente e senza compromessi, crea il diritto, e provvede alla sua attuazione. È una nuova concezione che spunta ; sono germi fecondi di ulteriori sviluppi, che sorgono non solo indipendentemente, ma anzi direi in contrasto con le concezioni giuridiche tradizionali, sia per la sostanza del diritto che per il processo . Infatti il processo per formulas, questo tipico ed originale si stema processuale latino, che non ha riscontro in altre legislazioni, non è che imposizione di arbitrato , la quale si puó spiegare solo tenendo presente la tradizionale mentalità quiritaria , a cui ripu gnava che lo Stato si ingerisse negli affari riguardanti i singoli. Lo Stato latino non ha propriamente quella funzione che noi chia miamo giurisdizionale; interviene solo con l' imporre un arbitrato che risolva la contesa fra i singoli. Ed è così che l'attività delle parti domina tutto il processo, dall' inizio all'esecuzione; ed in fondo è sempre il singolo che provvede alla tutela del diritto . Il processo è un affare privato che riguarda il singolo e non lo Stato, il quale richiede soltanto delle garanzie formali. L ' unico elemento pubblicistico è costituito dal iussus iudicandi, che non al tera però la impostazione privatistica della litis contestatio e di tutto il processo : ed invero per tutta l' epoca formulare non c' è processo senza litis contestatio, cioè senza volontaria soggezione alla decisione del iudex . Lo Stato mai interviene a giudicare direttamente una controversia tra i singoli. 166 Biondo Biondi Tale carattere spiega bene come mai, di fronte al rigoroso formalismo che domina tutto il campo del ius civile, il processo formulare sia scevro di ogni forma solenne. Nessuna forma per convenire in giudizio : le XII Tav. regolano soltanto la facoltà del creditore di trascinare l'avversario in giudizio . Nessuna forma per gli atti processuali; sconosciuto il sistema della prova formale ; nessuna formalità per la decisione del iudex e per la sua esecu zione. Giustiniano qualifica le formule come aucupium syllabarum . Ma questo giudizio poteva darsi solo quando non si intende più il valore della formula . Se infatti si considera che la formula non è altro che lo schema dell'arbitrato , irretrattabile e senza appello , da sottoporre al iudex , si spiega bene come tale schema, appunto per chè delimitava il compito ed i poteri dell'arbitro, dovesse essere preciso e rigoroso, come avviene peraltro ancor oggi. Si aggiunga che la formula racchiude tutta la sostanza giuridica, e quindi deve presentare quella precisa e rigorosa redazione che hanno oggi le disposizioni legislative. Qualunque processualista abituato alle infinite formalità di cui è intessuto ogni processo , specie moderno, resta sorpreso come mai il diritto , che si ritiene il più formalistico del mondo, nel campo processuale presenti la più assoluta mancanza di forme. Ma qualora si tenga presente che una forma processuale solo dallo Stato può essere imposta, e che il sistema formulare non è creazione dello Stato,ma sopravvivenza dell' antica autodifesa del singolo, si spiega bene come il processo sia non formale, appunto perchè, in massima parte , non è altro che libera attività del singolo. Lo Stato si limita ad imporre un arbitrato secondo schemi prestabiliti. Ed ecco perchè l' unica forma, se così si vuol chiamare, è la redazione dell' arbitrato. Il processo formulare è privato non perchè così ha voluto la legge, ma perchè ciò era conforme alla tradizione ed alle concezioni giuridiche romane. Il punto di partenza non è l' autorità dello Stato , ma l'autonomia del singolo. Ed ecco perchè non è possibile raf figurare, come fa il Mommsen , il sistema del iudex privatus come il trionfo della democrazia . A parte la considerazione che il pro cesso civile è indipendente dall' assetto politico (basta osservare che il sistema formulare si instaura proprio nell' agonia del regime repubblicano ed è nel pieno rigoglio quando tramontano le antiche libertà ), è chiaro che il sistema del iudex pricatus non è conquista 167 Il processo civile giustinianeo della democrazia o palladio di libertà, ma piuttosto un primo passo dell' intervento dello Stato in quella sfera che noi chiamiamo pro cessuale , in cui, un tempo , per tale intervento non c' era posto. Non è verosimile peraltro che un legislatore abbia escogitato un sistema tanto bizzarro. Era piuttosto l'unico modo con gistrato si credeva potesse intervenire negli affari Lo Stato non annulla la difesa privata , anche perchè cosa sostituirvi. Si limita soltanto a disciplinarla ed cui il ma dei singoli. non sa che organizzarla per opera dell'arbitrato obbligatorio , il quale è un mezzo, che, ancor oggi, nei rapporti internazionali si ritiene possibile senza le dere la sovranità dei singoli Stati. Lo Stato latino non ritiene suo compito intervenire nelle cose dei singoli, se non in quanto interessino la res publica , cioè qua lora la questione cessi di essere privata per rientrare nella sfera pubblicistica. Pertanto come non è compito dello Stato la forma zione del ius privatum , così non è funzione dello Stato l' amministra zione della giustizia tra i singoli. Specialmente nei tempi più an tichi, quando i magistrati supremi erano impegnati nelle guerre, e quando intorno alle sorti di questa si appuntava ogni interesse della collettività, la composizione del contrasto di interessi tra i singoli era cosa che toccava i singoli e non la civitas. L 'unica cosa che interessava la res publica era che il contrasto non degenerasse in conflitto violento, e questa esigenza era pienamente attuata con l' imposizione dell'arbitrato . Questa situazione rispecchia non una situazione arcaica, ma la precisa realtà per tutto il tempo in cui furono in vigore le for mule . Tutto il processo formulare non rappresenta amministrazione della giustizia , come funzione pubblicistica, ma piuttosto imposi zione e risoluzione di arbitrato. Sorgono gradatamente organi legislativi ; il ius non è più tutto estrastatale ; l' imperium del magistrato e del Principe incide pro fondamente nella sfera di libertà del singolo ; ma il tradizionalismo romano si adagia sempre nelle antiche forme ; ed anche quando il Pretore, forte del suo imperium , crea tutto un nuovo sistema giu . ridico, questo si fa valere sempre nello stesso modo e con il me desimo schema, cioè attraverso la imposizione dell'arbitrato . La preoccupazione della civitas in questo campo è solo quella della vis privata . Lo Stato non assume funzione giudiziaria per un ideale etico , non considera l'amministrazione della giustizia come suo Biondo Biondi 168 compito essenziale, bensì interviene nell'interesse della pace ed entro i limiti di questo fine politico ; la sostanza del diritto e la attuazione di esso non interessano essenzialmente la civitas. Il sistema delle formule non è un ibrido compromesso tra ele menti pubblicistici ed elementi privatistici; rappresenta piuttosto l' intervento del magistrato in un affare che mai cessa di conside rarsi come privato, in quanto interessa solo il singolo. Il processo romano parte da una concezione diametralmente opposta a quella moderna : oggi non esiste difesa del diritto all' infuori dello Stato ; invece nel mondo latino è il singolo che provvede alla difesa del proprio diritto . Lo Stato impone soltanto che la difesa avvenga non violentemente, ma con una determinata forma ; quindi l' agere violento ed arbitrario diventa legis actio, e poi arbitrato. Dunque lo Stato impone solo forma ed arbitrato ; per tutto il resto il pro cesso è soltanto un affare privato che riguarda il singolo e non lo Stato. Il processo è dunque privato non solo nel senso puramente esteriore che la decisione sia devoluta ad un iudex privatus, ma nel senso ampio che, dall' inizio alla fine, il processo non è altro che attività giuridica del singolo all'ombra della legge. Il processo, in fondo, resta sempre un affare privato. L ' unica cosa che interessava e preoccupava la civitas era che i singoli non venissero alle mani; e questo scopo veniva raggiunto pienamente con l' imposizione del l' arbitrato , Un organo che, nel senso moderno, dichiari ed attui il diritto non esiste ; né il praetor né il iudex , i due organi su cui si im pernia tutto il processo, hanno tale funzione; non il praetor perchè egli si limita a rilasciare uno schema ipotetico di assoluzione o di condanna, subordinatamente cioè alla prova delle pretese dedotte in giudizio ; non il iudex perchè egli non dichiara direttamente il diritto, ma si limita o ad assolvere, cioè a sciogliere dal vincolo risultante dall'arbitrato, o a condannare in una somma di denaro. Ciò suppone certo il riconoscimento del diritto ; ma non c ' è di chiarazione di diritto, molto più se si considera che, per effetto della trasformazione processuale, l'attore vittorioso acquista un di ritto nuovo e diverso rispetto a quello dedotto in giudizio. Certo questi concetti hanno subito qualche attenuazione so pratutto nella tarda epoca classica ; ma il tradizionalismo romano ha impedito ogui mutamento nella impostazione del processo , che Il processo civile giustinianeo 169 resta privato : formula , litis contestatio , iudex privatus, restano sempre i perni del processo. In questo campo possiamo constatare la più perfetta continuità ideale e la persistenza degli antichi concetti. È sempre l' idea della difesa privata che domina tutto il processo , dalle epoche più remote fino a tutto il periodo in cui furono in vigore le formule ; difesa violenta un tempo, difesa permezzo dell' arbitrato ora ;ma è sempre la difesa per opera del singolo che campeggia in tutto il processo. Ed anche quando il Pretore si afferma come organo più moderno e potente di trasformazioni giuridiche, questo nuovo diritto si muove sempre nello stesso schema processuale ; si attua sempre at traverso la formula , o. in svariati mezzi processuali, che culminano sempre in una formula . Si consideri ad es. il sistema della bono rum venditio, che rappresenta una delle più importanti novità pre torie : qui non è lo Stato che espropria e provvede al sodisfaci mento del creditore, il quale piuttosto viene sodisfatto dal bonorum emptor, considerandolo come successore del debitore. Il pretore non opera direttamente per la tutela del diritto, ma, esercitando la sua autorità , si limita a rendere inattivo il debitore, impone solo che egli si lasci vendere il patrimonio. Siamo in presenza di concezioni tutte speciali, che difficilmente possono inquadrarsi nella nostra mentalità giuridica . Come lo Stato non ritiene essere suo compito la formazione del ius, inteso come ius privatum (si ricordi che il pretore, nonostante l' imperium , per i Romani, non può creare il diritto), così non ritiene che tra le sue attribuzioni rientri quella che noi chiamiamo amministrazione della giustizia . Quello che intende raggiungere lo Stato è l'attua zione dell' ordine e della espressioni edittali vim pace sociale : si ricordino le tipiche fieri veto ; tale scopo si ritiene raggiunto per mezzo dell'arbitrato obbligatorio . Scrive egregiamente un no stro insigne processualista , il Chiovenda : « nemmeno si deve pen sare che la difesa giuridica che il privato attua da sè sia la stessa cosa di ciò che avviene nel processo : il risultato economico può essere lo stesso ma le due cose sono ben diverse. Nel processo si svolge una funzione pubblica e questa è l' attuazione della legge » . Alla stregua di questo concetto dovremmo concludere che il sistema formulare non è un processo. Non è infatti lo Stato che attua il diritto, come sua propria funzione, ma è sempre il singolo che agisce ed opera per la difesa dei propri diritti attraverso quella lotta pa Ruma · II 170 . Biondo Biondi cifica che impone lo Stato con l'arbitrato . Non è solo l' impulso del singolo che inizialmente dà vita al processo, ma tutto il pro cesso è attività del singolo . Il processo è un continuo agere. 4 . Tra le formule e la cognitio c' è diversità di impostazione non solo del processo, ma della sostanza stessa del diritto . Anche a prescindere dal carattere extrastatuale del ius civile, in tutto il sistema formulare riscotriamo la assoluta compenetra zione del diritto nel processo . La formula è enunciazione di diritto e mezzo di difesa . Il diritto civè non esiste indipendentemente dalla formula ; ma è piuttosto quello che risulta dalla formula e dalla pronuncia del iudex . Non ho bisogno di ripetere che tutto il diritto classico è un sistema di actiones : il diritto sorge, si sviluppa, si conosce, si ela bora sempre sotto il profilo dell’actio ; e non ho bisogno di insi stere sul concetto che, per quanto riguarda il contenuto , il diritto segue le trasformazioni processuali dell’actio : quello che deduce in giudizio l'attore è qualche cosa di diverso di quello che ha rico nosciuto nella sentenza, e questo a sua volta è diverso di quello che ottiene coattivamente ; così ad es. il creditore deduce il suo credito in giudizio, ma ottiene una condanna pecuniaria ; agisce esecutivamente , ma, secondo il ius civile, ottiene l' impossessamento del debitore, e nel sistema della bonorum venditio ottiene, mai la prestazione o l'obbietto della condanna, ma una certa somma di denaro da parte non del debitore, ma del bonorum emptor. .. Tutto ciò è del tutto estraneo alla cognitio. Qui il diritto si profila come qualche cosa di separato dal diritto , tanto che l'am ministrazione imperiale cerca di organizzare un sistema processuale per l'attuazione di questo nuovo diritto che non trova posto nelle formule. 5 . Queste fugaci osservazioni dimostrano quale profonda di versità di struttura esista tra la cognitio e la formula . Non si tratta solo di due diversi sistemi processuali, ma piuttosto di due conce zioni diverse. Mentre la cognitio si impernia sul carattere statuale sia del processo che del diritto, nonchè sulla separazione del di ritto dal processo, la formula invece ha carattere privatistico, ed importa totale compenetrazione del diritto nel processo. Il processo formulare resta sempre il regolamento giuridico della difesa del Il processo civile giustinianeo 171 singolo . La cognitio ha impostazione , nettamente pubblicistica, in quanto l'attuazione della legge al caso concreto è fatta dallo Stato , e l' amministrazione della giustizia si ritiene suo compito essenziale. La contrapposizione non potrebbe essere più netta e precisa . Ciò conferma come nessuna derivazione potesse avvenire dall'uno all' altro sistema. 6 . Il sistema del iudex privatus è cosi profondamente radicato nella coscienza sociale che resiste nei secoli, anche di fronte alle trasformazioni politiche. Cadono i comitia , decade sia la interpre tatio Prudentium che l' attività creatrice del Pretore,ma le formule sussistono, anche quando l'assolutismo del Principe si delinea netto e preciso. Ciò perchè la formula non era processo, ma anche so stanza giuridica. Non era possibile abolire il lato processuale e mantenere la sostanza giuridica, data la intima compenetrazione dei due aspetti. . Quello che invece potè determinare il crollo delle formule non furono nè considerazioni politiche nè volontà del legislatore, ma piuttosto lo sviluppo della cognitio. Accanto al massiccio complesso giuridico, sostanziale e pro cessuale, risultante dal diritto civile e pretorio nonchè dalle costi tuzioni imperiali che a tali sistemi si riattaccano, fin dai primi tempi dell' Impero spunta una nuova formazione giuridica , che schiude un nuovo mondo, per il modo inconsueto con cui il diritto si afferma e si esegue. Non formule ed azioni che cristallizzano principi tradizionali, ma precisi ordini di condotta imposti dall'au torità del Principe ; non regolamento della autodifesa, ma esecuzione della volontà della legge. Abbiamo tutto uno sviluppo storico che va di pari passo, da una parte con la decadenza degli organi legislativi repubblicani, e dall' altra con l' incalzare del potere del Principe . Gli ordini, da prima sporadici ed emanati caso per caso, diventano sempre più numerosi e con carattere generale . Ed allora appare naturale che per queste ordinanze legislative, dalla stessa autorità imperiale do vesse escogitarsi tutto un meccanismo rivolto a darvi esecuzione. Tutto ciò indubbiamente rompeva la tradizione. Anche agli stessi giuristi romani questi nuovi polloni che at fiorano nella complessa amministrazione imperiale si presentano come qualche cosa di nuovo e di insolito , per quanto in sostanza 172 Biondo Biondi provengano da loro stessi. Non si riesce a trovare anzitutto una denominazione, che serva a individuare questa neoformazione giu ridica ; si parla solo di cognitio , ed anche di cognitio extra ordinem , mettendo con ciò in rilievo che si tratta di provvedimenti presi caso per caso, oppure il lato negativo ; ed in verità null' altro si poteva dire che essa stava al di fuori dell' ordo. Ed appunto perciò i giuristi, mentre operano attivamente nella cancelleria imperiale alla emanazione delle ordinanze, non tentano affatto né di innestare questi nuovi germi nel complesso giuridico esistente, né di orga nizzarli a sistema, come fecero quei giuristi che fundaverunt ius ci vile ; ciò è dovuto non solo alla decadenza della interpretatio , ma sopratutto al fatto che si trattava di qualche cosa di nuovo , bene spesso ripugnante con la tradizione giuridica latina. Questi nuovi germi si sviluppano gagliardamente, mentre le formule si atrofizzano ; quando con l' Editto perpetuo si chiude il ciclo delle formule, è la cognitio che ha il sopravvento assoluto. Certo non si può escludere a priori che la legislazione impe riale potesse svilupparsi sullo schema tradizionale delle formule , cioè introducendo nuove formule e tipi di azioni corrispondenti ai nuovi istituti che man mano si riconoscevano. Ma il regime delle formule doveva sembrare già troppo anacronistico ed impacciante per ritenere che l'evoluzione giuridica dovesse seguirne la falsariga . Ed ecco perchè mentre si fissa nell' Editto perpetuo tutto il bagaglio giuridico precedente, racchiuso in una serie di formule , il nuovo diritto prende nuove vie e segue altri mezzi, più conformialle esi genze pratiche e all'assetto politico del tempo. Ed è così che la legislazione imperiale e la prassi giudiziaria dovettero creare tutto un regolamentu processuale, che, secondo le necessità della pratica, si sviluppa e perfeziona giorno per giorno : si precisano le modalità , gli atti, le forme attraverso i quali la vo lontà del Principe può avere attuazione. Il vecchio sistema formu lare non serve e nulla può dare. Sorgono invece atti giudiziari completamente scouosciuti al processo formulare. Si afferma così un rigoroso formalismo negli atti processuali, dalla citazione alla esecuzione. Avviene cosi un fenomeno alquanto singolare : quando non si intende più il significato della formula, questa appare un vuoto formalismo, mentre il legislatore ben altra formalità impone. È un giudizio analogo a quello che danno i classici della legis ac tiones, i quali possono ben dire che il populus abbia voluto le azioni Il processo civile giustinianeo 173 certas solemnesque. Quando non si intende più il significato della legis actio e della formula , queste si qualificano come vuote ed in ceppanti formalità , mentre in realtà le vere formalità solo nel pro cesso pubblicistico incominciano ad avere la loro esistenza . Certo la cognitio assume molto dall' ordo, e precisamente quel tanto che è compatibile con il proprio sistema. Ma sarebbe stoltezza ed incomprensione considerare i due sistemi solo come due diverse procedure , ed a svalutarne le profonde differenze. Certo la funzione è la stessa, ma la cognitio , anche nell'ultima epoca classica , diverge dalle formule per questi due caratteri fondamentali : 1) mentre il processo formulare resta sempre un processo privato , la cognitio è un processo pubblicistico . 2 ) La formula rappresenta la tradizionale compenetrazione del diritto e del processo ; mentre la cognitio sup pone la indipendenza tra ciò che è sostanza , da ciò che è strumento di attuazione del diritto . 7. Per tutta l' epoca classica la cognitio non poteva sopraffare le formule , perchè essa aveva lo scopo non di soppiantare ma di completare l'ordinamento esistente. Pertanto formule e cognitio coe sistono come sfere giuridiche autonome e indipendenti dal lato sia processuale che sostanziale. Le formule racchiudono tutto il diritto tradizionale , civile e pretorio , la cognitio contiene invece il diritto nuovo, suscettibile di sviluppi. Pertanto l'eqnilibrio tende a spostarsi a danno dell' ordo: mentre questo è atrofizzato, la cognitio si sviluppa fino al punto da diven tare l' unico sistema giuridico che possa seguire l'evoluzione sociale . Ciò ben a ragione, giacchè il nuovo sistema risultava non solo più rispondente alle nuove condizioni politiche, ma altresì più pratico ed opportuno di fronte al sistema dell' ordo, che di giorno in giorno doveva apparire come qualche cosa di remoto ai nuovi tempi. Si arriva cosi al IV sec., quando la cognitio ha preso tale svi luppo da sovrapporsi completamente a quel complesso giuridico ai cui margini era sorta e si era sviluppata . La simbiosi è finita col trionfo della cognitio . Trionfo graduale , dettato da esigenze pratiche, e attuato nella prassi giudiziaria . L ' ordo cade come un ramo secco, senza la volontà di alcun legislatore, e sopratutto senza lasciare traccia di sé. Non è possibile seguire qni questo processo di sovrapposizione. Interessa piuttosto rilevarne le conseguenze. Biondo Biondi 174 La sovrapposizione non poteva essere totale . C ' è qualche cosa di morto , e qualche cosa che sopravvive. Tutto il diritto classico, civile e pretorio , risultava compenetrato nella formula . Questa non è soltanto atto o documento processuale , ma enunciazione di so stanza giuridica. Orbene il trionfo della cognitio non importa affatto abolizione di questa sostanza giuridica , la quale rappresenta ancora gran parte del diritto vigente. Quello che trionfa in pieno è solo il lato processuale della cognitio. Questa si organizza compiutamente, tanto da non tollerare alcun dualismo, e pertanto si viene ad ap plicare anche a quel campo prima riservato alle formule . Dunque mentre l'ordo cede la sostanza del diritto, la cognitio fornisce il sistema processuale . Ed allora si pone come assoluta esigenza pratica la separazione del diritto dal processo, cioè la separazione di ciò che è sostanza giuridica da ciò che è soltanto mezzo per la sua attuazione. Pro blema non dottrinale , ma pratico ed urgente , giacchè si trattava di separare nettamente il vivo dal morto, quello che fosse in vi gore da ciò che era caduto per sempre. Continua ad avere vigore la sostanza del diritto classico, la quale , avulsa dalle formule , si fa valere mediante un nuovo sistema processuale, che parte da presupposti giuridici e politici ben diversi. Attuare tutto ciò non era agevole . Negli ordinamenti giuridici in cui il processo si considera come qualche cosa di staccato dal diritto, in quanto si considera come mezzo di attuazione di esso , è ben possibile che resti ferma la sostanza del diritto e muti, an che radicalmente, il sistema processuale, come dimostra l' esperienza legislativa moderna ; si può trasformare il processo , restando inva riato il diritto e viceversa . Invece il diritto classico , civile e pretorio , presenta tale com penetrazione tra diritto e processo, che quello , staccato dalle for mule, bene spesso appare non intelligibile . Ricordo qualche esempio tra i moltissimi. Mentre nel mutuo il debitore non è tenuto a pa gare interessi, nella vendita e in tutti i giudizi di buona fede il debitore inadempiente risponde di tutti i danni ed anche dei lucri. In taluni rapporti la condotta delle parti viene valutata alla stregua del bonum et aequum , in altri tutto ciò va fatto rigorosamente. Gli esempi potrebbero moltiplicarsi. Orbene si saprebbe dare di questa disparità di trattamento una spiegazione diversa che non sia quella ricavata dalla diversità delle rispettive formule ? Ed allora, se fac Il processo civile giustinianeo 175 ciamo sparire le formule , resta una inesplicabile disparità di trat tamento . Dice esattamente il Savigny che sarebbe ben difficile far capire ad uno che conosca i negozi giuridici per pratica e non per teoria , che l'obbligazione derivante da un mutuo abbia natura di versa di quella della vendita ; sarebbe necessario , dice sempre il Savigny, che egli avesse udito delle lezioni di diritto romano (io direi di processo formulare) per potere intendere ciò . Occorreva dunque scardinare il diritto dal processo , e darvi una nuova impostazione. Tutto il diritto classico si impostava sulle formule . Ed allora non bastava abolire le formule , ma occorreva dare una nuova base al diritto, e provvedere ad una sistemazione giuridica indipendente da esse . A questo compito risultava del tutto inadeguata la legislazione imperiale , giacchè ad un legislatore si può richiedere un atto di imposizione, ma non certo una nuova impostazione del diritto, la quale può essere solo il frutto di una lenta e lunga maturazione sotto la guida sapiente dei giuristi. Come la giurisprudenza romana aveva creato tutto un compiuto sistema giuridico sulla base delle actiones e delle formule , cosi occorreva l'opera assidua dei giuristi perchè fosse isolato il diritto dall' involucro processuale . Era ben possibile abbattere le formule da un momento all'altro, ma non era possibile riplasmare improvvisamente su nuove basi quella so stanza giuridica che la sapienza di dieci secoli aveva costruito. La legislazione imperiale prepara certo questa opera, elimi nando solo quello che in modo più appariscente fosse connesso con le formule. Cosi si impone che il giudice debba giudicare non più secondo una istruzione che gli veniva rilasciata caso per caso, ma piuttosto secondo legge, come ordina Diocleziano, il quale in via generale prescrive che il giudice debba giudicare « quod sciat legibus et iuri publico convenire » (c. un. C . 2, 10 ). Costantino di fronte a quella singolare disparità di trattamento, che solo nella diversità della re dazione formulare trovava giustificazione, dispone che « in omni bus rebus praecipuam esse iustitiae aequitatisque quam stricti iuris rationem » (c. 8 C. 3, 1). Già Diocleziano disponeva che « nihil aliud in iudiciis quam iustitiam locum habere » (c. 6 , 1 C . 7, 62). Zenone abolisce formalmente il regime classico della plus petitio, così intimamente connesso con la formula . Biondo Biondi 176 Si tratta però di disposizioni sporadiche, per quanto di gran dissima importanza demolitrice , dettate dalla impellente necessità di rimuovere talune conseguenze del regime formulare, che appa rivano delle vere assurdità o iniquità , ma che non affrontano, nè possono affrontare il problema. Si impone al giudice di giudicare secondo legge, equità e giustizia ; ma il giudice nella giurispru denza classica nulla trovava di tutto ciò ,ma piuttosto una congerie di formule e editti, ed una selva di commenti ad essi. Quale era al lora la giustizia, la legge, l' equità ? Si rinvia alla giustizia , ma nelle opere dei giuristi romani si trovava tutto un regime che solo te nendo presente la formula poteva apparire giusto. Si pone il giu dice in diretto contatto con la legge ; ma i testi classici contengono la figura del pretore, che concede e denega azioni ed eccezioni, vero arbitro del processo , senza riscontro nell' ordinamento giudi ziario del tempo . Ed ecco perchè lo stato del diritto in quest'epoca appare cao tico . La causa di questo innegabile disagio , nonché della improv visa decadenza della giurisprudenza, risulta ora assai chiara . Ciò non deriva dalla massa ingente della produzione giurisprudenziale nė dallo incalzare dell'assolutismo. Si può supporre infatti che quello che fu possibile ad Ulpiano e Paolo dovette sembrare su periore alle forze umane per la generazione immediatamente suc cessiva ? La scienza del diritto è diventata forse improvvisamente tanto complicata , o forse i giuristi sono ora tanto imbelli, che ap pena una generazione è riuscita a troncare una tradizione così ra dicata nello spirito dei Romani ? Perchè tanta confusione e tanto caos ? Perchè mai quella disparità di opinioni fra i giuristi, che per tanti secoli non aveva atterrito nė pretore nè giudice, avrebbe confuso il nuovo giudice preposto all' amministrazione della giu stizia ? E non bastava l’ Imperatore con la sua volontà a risolvere dubbi ed a mettere il diritto al corrente con i nuovi tempi? Orbene io penso non essere puramente casuale che la decadenza della giurisprudenza, nonchè lo stato caotico del diritto in epoca postclassica coincidano con la caduta delle formule . Esistono in questo periodo certo dei giuristi, ma solo conoscitori di leggi, e la loro attività si riduce tutta a fare sunti, parafrasi, raccolte e tra duzioni, tanto che queste opere ed i rispettivi autori, neppure nel nome, passano alla storia . Ed in verità non potevano far di più o di meglio. Di fronte all'accentramento di ogni potere legislativo Il processo civile giustinianeo 177 nella volontà del Principe, risultava addirittura impossibile quella gloriosa interpretatio, che in ogni tempo era riuscita a far seguire al diritto il ritmo delle trasformazioni sociali. Ma ciò non basta a spiegare il fenomeno, che ha cause intrin seche. La verità è che col venir meno delle formule la giurispru denza ha perduto l'ubi consistam ; donde la decadenza improvvisa , come repentina fu la caduta delle formule. Il diritto manca ora di una impostazione intoruo a cui possa muoversi e possa conoscersi. L ' unico monumento legislativo generale , trapassato nell' epoca post classica e che racchiudeva tutta la tradizione giuridica romana, era l' Editto perpetuo ; ma esso risultava inservibile , giacchè non era altro che un elenco di quelle formule , che i nuovi tempi avevano abbattuto . Chiunque trovi singolare la decadenza della giurispru denza , provi a ricavare principî giuridici dalle formule dell'editto perpetuo, ad estrarre formulazioni generali dalla ricca casistica clas sica, e solo allora potrà giustificare quei giuristi postclassici, a cui per un lavoro di tal fatta mancava per giunta ogni precedente. Le fonti classiche apparivano non intelligibili anche per un 'al tra considerazione. Si menzionano editti e senatoconsulti, si parla del Pretore che accorda o nega l' actio o l'exceptio, di giuristi che fissano principi e risolvono casi pratici; ed in ciò consisteva tutto il diritto classico. Ed allora quando del Pretore e della interpretatio non si ha più ricordo alcuno, e d ' altra parte ogni potere legisla tivo si concentra nel Principe, su quale base potevano avere effi cacia giuridica le decisioni dei giuristi o il testo dell' Editto ? Chi può essere oramai quell' organo che accorda azioni ed eccezioni? E che cosa vuol dire dare azioni od eccezioni, quando il diritto si è reso indipendente dalle formule ? È caduto il vecchio , ma il nuovo si trova in uno stato di caos. I giuristi non possono operare perchè attendono tutto dalla volontà legislativa, ed è certo che non possono improvvisare un riassetto giuridico ; l' Imperatore emana qua e là qualche disposizione, prov vedendo alle necessità più urgenti, ma non osa porre mano al ba gaglio giuridico precedente , che pur doveva formare gran parte del diritto vigente . Si perviene cosi a quello stato di disordine e di confusione, lamentato dagli storici e dallo stesso Giustiniano, il quale ricorda con raccapriccio la situazione precedente , non tanto per far risal tare la importanza dell' opera propria , ma con la precisa coscienza di rispecchiare il vero stato delle cose. 178 Biondo Biondi La ragione precipua di tutto ciò non può essere che una sola , giacchè le altre sono concomitanti: cioè la caduta delle formule accanto alla sopravvivenza del diritto da esse rispecchiato . Non è questione cronologica , ma di constatazione del fenomeno. La massa del diritto romano diventa non intelligibile lo stesso istante in cui si vuole attuare non per mezzo della formula ; come graduale fu la scomparsa delle formule, così graduale fu l' oscurità nel campo del diritto ; e quando la scomparsa è generale, il caos ó completo . 8 . Questa situazione permette di cogliere esattamente il valore e il significato dell'opera di Giustiniano. Di solito tale valore si rimpicciolisce quando si dice che il le gislatore volle eliminare dubbi e discussioni fra i giuristi nonchè mettere il diritto al corrente con i nuovi tempi; dovremmo infatti supporre che la legislazione imperiale sia stata inerte od incapace, quando invece essa appare assai larga ed importante in tutti quei campi che restavano estranei al bagaglio legislativo classico, o che abbia tollerato che avesse vigore un diritto non rispondente ai nuovi tempi. Giustiniano ha certo trasformato e modificato, ha tolto « il troppo ed il vano » , ma il fine ultimo della compilazione fu quello di corrispondere a quella necessità che si era delineata al cadere delle forinule , onde eliminare la causa prima di tanta confusione ; dare cioè a quella massa giuridica classica, che poteva essere an cora in vigore, una nuova impostazione, e cosi fornire agli inter preti basi solide e sufficienti per una integrale rielaborazione di tutto il diritto di Roma. Il bagaglio giuridico classico, opportunamente selezionato ed anche modificato, riceve ora una base precisa e sicura, che è data dalla volontà del Principe. La base dell'ordinamento giuridico si sposta dalla formula alla volontà del legislatore. E una nuova base su cui il diritto di Roma può avere rielaborazione e sviluppi. Ogni incertezza sparisce, e la confusione è domata. Scompaiono editti e leggi, formule e senatoconsulti, responsi e costituzioni imperiali . Tutto è unificato sotto il profilo della volontà legislativa, la quale parla anche per bocca di giuristi, di editti e mezzi pretori, a cui Giustiniano imprime suggello legislativo. Il diritto oramai è uno e proviene dalla stessa fonte . Giustiniano segna la fine di un mondo, ed il sorgere di uno nuovo. È una tappa di capitale importanza nella evoluzione del diritto ; ed in ciò sta la gloria di Giustiniano , e la ragione della fortuna della compilazione. Il processo civile giustinianeo 179 Ma con quali mezzi Giustiniano potè raggiungere lo scopo ? Ad una codificazione, così come la intendiamo noi moderni, cioè enunciazione astratta di principi giuridici, non era possibile pen sare : mancavano i precedenti e peraltro non era tanto facile rica vare una codificazione dalla immensa e contraddittoria casistica clas sica. L 'unica cosa che poteva fare Giustiniano era di seguire la tradizione, la quale ammaestrava essere ben possibile adattare il vecchio ai nuovi tempi. Si affronta così la compilazione dei Digesti, dove l' intento generale di Giustiniano risulta chiaro , qualora non ci arrestiamo ad osservazioni puramente esteriori. Chi dà uno sguardo ai Digesti riceve l' impressione che il le gislatore abbia voluto fare un passo indietro. Rivive la parola del Pretore e delle antiche leggi, e tutto il bagaglio classico delle actiones appare nel suo pieno vigore. Che vale se le formule si vollero soppresse, qualificandole come aucupium sillabarum , quando è tutta la impostazione processuale del diritto che appare rivivere ad ogni piè sospinto ? Ed ecco perchè i moderni storici hanno cre duto di raffigurare Giustiniano come amante di arcaismi, se non addirittura come un romantico restauratore dell' antico. Ma intorno agli arcaismi di Giustiniano ha già pronunziato una parola defini tiva il Riccobono. Infatti se noi andiamo oltre ogni elemento este riore, se consideriamo il Digesto non come accozzaglia di ruderi del passato, ma come opera legislativa animata da uno spirito e da una volontà , se vogliamo penetrare nell'intimo di esso, il nostro giudizio sarà diverso, e la ricostruzione del diritto giustinianeo dovrà farsi con altri metodi ed altre direttive. La grande impor tanza ed originalità del Digesto sta, a mio parere , non tanto nel l'avere tramandato reliquie della giurisprudenza classica o nell’ a vere modificato opportunamente il diritto classico , ma nell'avere compiuto un ' opera assolutamente nuova con materiali vecchi. Questa grande verità, inconsciamente percepita dalla Glossa, la quale, forte di una santa ignoranza della storia , riuscì a percepire il pensiero legislativo di Giustiniano, è stata però disconosciuta dagli umanisti, antichi e moderni, i quali, perfettissimi conoscitori della storia, hanno finito con il fraintendere quello che era lo scopo e la vo lontà del legislatore. 9 . Queste premesse generali mi sembrano indispensabili per comprendere lo spirito e le direttive giustinianee in tema di pro cesso civile . 180 Biondo Biondi Giustiniano ha voluto scardinare il diritto dal processo , onde eliminare la causa precipua di confusione nel diritto del suo tempo. Scompare quella eterogenea varietà di fonti giuridiche classiche : oramai leggi, responsi dei giuristi, editti dei Pretori ricevono effi cacia solo dalla volontà legislativa di Giustiniano. Quello che parla non è la formula od il pretore, ma lo stesso legislatore. Pertanto il diritto si fonda sulla volontà del legislatore, ed è reso del tutto indipendente dal sistema processuale. Ed è così che la vecchia so stanza del diritto si può attuare per mezzo di un nuovo e diverso processo. Il processo giustinianeo rappresenta la consolidazione legisla tiva di quella cognitio extraordinem , che si è organizzata nella prassi giudiziaria dell' epoca precedente. Questo è il precedente storico del processo giustinianeo, non il regime formulare, che è morto senza lasciare traccia. Sopravvivono , come si vedrà , talune denominazioni (actio, iudicium , litis contestatio, sententia , ecc. ecc.) ma il loro valore è ben diverso , in quanto tali istituti si assumono in funzione del nuovo assetto processuale. Mentre intorno alla so stanza del diritto si può riscontrare una perenne continuità nella tradizione latina, in ordine al processo , Giustiniano consolida legi slativamente non il processo latino, ma la cognitio . Pertanto il processo giustinianeo si delinea nettamente, e senza compromessi, con caratteri pubblicistici: è lo Stato che, per mezzo dei suoi organi provvede, come suo compito essenziale, alla tutela ed attuazione del diritto. Il iudex o competens iudex giustinianeo si trova ad una distanza astronomica dal iudex formulare, di cui si parla ancora nelle Pandette . Statale è il diritto , come statale è il processo. Così ora spunta un personaggio , ignoto al processo for mulare, l'executor, che, con varie funzioni, interviene sempre in tutto il processo, dall' inizio alla esecuzione. Non si tratta di dettagli ma della stessa impostazione del pro cesso . Il regime formulare, imperniato tutto sulla litis contestatio, concepita come arbitrato obbligatorio, sullo iussus iudicandi, confe rito al iudex dal pretore, e sul iudex privatus, nulla ha di comune con il processo giustinianeo in cui il iudex è un organo che deriva la potestas iudicandi direttamente dalla legge, in virtù della sua stessa qualità di giudice, e quindi senza che alcun organo od atto particolare gli attribuisca tale potere , e la cui attribuzione è segnata non da uno schema di arbitrato ma piuttosto dalla legge. Nessuna Il processo civile giustinianeo 181 derivazione storica, nessuna estensione di principi dall' uno all'altro sistema. Il processo giustinianeo è cosi fondamentalmente diverso dalle formule, che taluni istituti, così rispondenti ad ovvie necessità pra tiche, solo in esso possono affacciarsi, mentre erano del tutto ripu gnanti al processo formulare : cosi diventa ora ben possibile un processo contumaciale, è ammissibile l' istituto dell' appello, vere assurdità di fronte al sistema della litis contestatio . Eppure di fronte a tanta disparità di regime, mentre nelle co stituzioni postclassiche e giustinianee accolte nel Codice manca un organico regolamento processuale , i passi delle Pandette e delle Istituzioni rispecchiano gli istituti del processo per formulas. Che vale dunque la caccia alle formule, quando ancora le Pan dette ne riproducono gli istituti ? Giustiniano ha voluto forse ri suscitare l' ordinamento formulare nella sua sostanza ? È forse, come sostengono i moderni storici, un romantico restauratore delle ac tiones ? La verità è ben altra. I materiali legislativi, di cui si servi Giustiniano, contengono una compenetrazione di elementi vivi e morti, la cui separazione, se era nell' intento del legislatore, non si potè attuare, come confessa Giustiniano nella c. Tanta ( $ 13) : « cum fuerat aliis diversis permixta impossibile erat eam per partes detrahi, ne totum confundatur... hoc dividere et separare penitus erat incivile, ne tam sensus quam aures legentium ex hoc pertubarentur » . Questa preziosa dichiarazione si deve tenere sempre presente, se si vuole ben comprendere lo spirito e la volontà del legislatore. Infatti non è possibile considerare sullo stesso piano e con lo stesso metro tutte le attestazioni che troviamo nelle fonti, dal mo mento che, come ammonisce Giustiniano, nella compilazione c' è una mescolanza di vivo e di morto , e solo al primo il legislatore ha inteso attribuire efficacia. Ed ecco perchè io penso che il metodo puramente esegetico descrittivo non basti, giacchè la efficienza giuridica dei passi con tenuti nella compilazione non può essere uguale ; vi sono infatti dichiarazioni che devono mettersi nell'ombra, altre in pieno risalto ; e sopratutto bisogna intendere i testi in quel significato che ora possono avere nel sistema della compilazione. Ma come è possibile orientarsi ? 182 Biondo Biondi Bisogna tener presente il carattere pubblicistico che ha ora il processo, ed alla stregua di tale caposaldo occorre intendere e ri costruire i singoli istituti processuali. È necessario inoltre racco gliere quei nuovi elementi che affiorano qua e là nella compila zione, sia nelle costituzioni giustinianee e postclassiche, sia in talune tipiche e sicure interpolazioni. Questi nuovi elementi, non importa se siano proprio di Giustiniano o classici o postclassici, ma sempre della cognitio, costituiscono le linee direttive, la luce che serve ad intendere ed a riplasmare tutti gli istituti processuali classici, di cui in larga misura si parla ancora nella compilazione. Sono i fer menti attivi che determinano la trasformazione integrale del si stema classico . Ed è appunto alla stregua di tali precetti che bisogna rico struire il processo giustinianeo. Come risulta errato prendere in considerazione tutti gli elementi del Corpus luris ed attribuire ad essi lo stesso valore, così non meno errato sarebbe abbandonare le Pandette e limitarsi alle poche costituzioni ed interpolazioni giu stinianee. L ' uno e l' altro criterio vanno contro la volontà del legi slatore. Occorre piuttosto procedere dalla struttura generale del processo giustinianeo nonchè dai nuovi elementi che sporadicamente affiorano qua e là ; ed è appunto in funzione di queste direttive che bisogna intendere gli istituti formulari di cui si parla nelle Pandette. Tali istituti non hanno quel contenuto che avevano in epoca classica, è assurdo pensarlo, ma quello che possono avere in rapporto al nuovo sistema processuale . Molte volte è soltanto il nome che è trapassato , mentre la sostanza è ben diversa. 10 . Meglio di qualsiasi enunciazione generale, gioverà qualche saggio di ricostruzione secondo tali criteri. Actiones. Il Digesto e le Istituzioni ripullulano ancora di innumerevoli actiones. Abbiamo tutto il bagaglio formulare : actio civilis ed in factum , actio directa ed utilis , restitutiones in integrum , interdicta , stipulationes ; Giustiniano arriva financo ad introdurre nuove azioni. Diremo forse che Giustiniano abbia voluto perpetuare il re gime classico delle actiones ? La verità invece balza da talune di chiarazioni di Giustiniano che illuminano tutto il sistema. Giusti niano dice che oramai non c ' è differenza tra actio directa ed utilis (fr. 46, 1 D . 3, 5 ) ; l'interprete è dunque avvertito , e quindi non Il processo civile giustinianeo 183 era necessario modificare quei passi in cui la distirzione compare . Superata l' antitesi tra ius civile ed honorarium , nessuna differenza esiste più tra actio civilis ed in factum ; non lo dice esplicitamente Giustiniano ; ma quando il legislatore non esita a chiamare la stessa azione civilis ed anche in factum , adopera indifferentemente le due qualifiche, e dice che si applica l' actio in factum qualora l' a zione non abbia una speciale denominazione (fr. 1 pr. D . 19, 5 ), dobbiamo riconoscere che la distinzione è scomparsa ; e quindi non ha importanza che essa si presenti ancora in numerosi passi della compilazione. Abbiamo ancora tutta la serie degli interdetti con il relativo comando restituas, exhibeas, vim fieri veto. Ma esiste forse alcuna autorità che emani ordini di tal fatta ? In realtà Giustiniano avverte in principio che gli interdetti non sono altro che le ac tiones quae pro his competunt (D . 43 , 1) ; ad essi si applica tutto il regime delle actiones; talvolta si parla di agere (fr. 1 pr. D . 43, 17), di iudicium (fr. 1, 1 D . 43, 1), e Teofilo (4 , 15, 8) parla di utilis actio tamquam ex interdicto. Tutto ciò bastaya ; non occor reva dunque una sistematica eliminazione degli interdetti e dei ri spettivi formulari. Bisogna dire allora che quei comandi contenuti nei vari interdetti sono pronunciati non più caso per caso dal Pre tore, nonostante l'ait Praetor conservato costantemente nelle Pan dette, ma piuttosto in generale dalla legge ; ed essi sono fatti va lere per mezzo di azioni, come tutti i comandi legislativi. La re stitutio in integrum si inquadra nelle azioni, e diventa una mera azione di nullità , come hanno riconosciuto gli interpreti. Altrettanto dicasi per le stipulationes praetoriae, le quali sono diventate addi rittura delle actiones, tanto che Giustiniano talvolta parla di actio piuttosto che di cautio. Giustiniano introduce nuove azioni. Ma ciò anzichè dimostrare la simpatia del legislatore per le actiones, importa il crollo delle classiche actiones. Le nuove azioni hanno infatti carattere generale e demolitivo. La condictio ex lege si applica qualora sia riconosciuta dalla legge una obligatio senza enunciare il tipo dell'azione ; in tal caso « ex lege agendum est » (fr. 1 D . 13, 2 ). La dichiarazione è assai significativa : quello che oramai interessa è il riconoscimento del rapporto ; se c' è tale riconoscimento, ci sarà anche l'azione, e si agisce appunto in base alla legge. Altrettanto si può ripetere per l'actio in factum (fr. 1 pr. D . 19, 5 ), per l'actio praescriptis verbis ( fr. 1 pr. D . 19, 3). Queste azioni generali determinarono il 184 Biondo Biondi fenomeno di una imponente inflazione con la conseguente svaluta zione delle azioni. Sono lampi di luce che illuminano tutto il sistema, e che per mettono di compiere quella separazione tra il morto ed il vivo che era nell' intento di Giustiniano. Quello che è morto sono proprio le actiones classiche. Queste perdono ogni individualità , diventano entità fungibili. Ricordo la dichiarazione, veramente tipica , della c . 21, 1 C . 1, 2, in cui Giustiniano ammette la persecuzione degli arredi sacri « sive per in rem sive per condictionem sive per in fac tum actionem » . Al legatario poi si accorda indifferentemente actio in rem ed actio in personam ; quest' ultima dichiarazione può avere dei precedenti classici; con ciò Giustiniano intende annullare non la differenza tra actio in rem ed in personam , ma piuttosto la di versità di azioni che discendeva dalla diversa specie di legati clas sici ; l'azione è una sola : può essere sia in rem che in personam . Oramai non ci sono più le actiones, ma l'actio , cioè un mezzo generale di tutela giuridica . Il centro di gravità dell'ordi namento giuridico si sposta dall' actio alla sostanza del diritto . L ' ordinamento giuridico si profila ora come un sistema di diritti, e l' actio è un mezzo generico di attuazione della legge. Anche il domma della natura actionis, con cui Giustiniano cerca di giustifi care talune decisioni classiche che bene spesso discendevano dalla struttura della formula, rappresenta lo sforzo del legislatore di li berare il diritto dall' involucro processuale, giacchè la natura ac tionis deve intendersi nel senso di natura del rapporto, nella stessa guisa che altrove si parla di natura contractus e simili. L 'actio non è più anche portatrice, ma solo tutelatrice del di ritto . Da ciò deriva che il processo nessuna trasformazione può operare nella sostanza del diritto ; della classica consumazione pro cessuale non c' è più ricordo. Il diritto si concepisce come un prius rispetto all'actio, tanto che Teofilo può ben considerare l' obligatio come madre dell' azione. Certo ius ed actio , come in ogni ordina mento giuridico, sono in certo senso entità inseparabili, ma quella compenetrazione caratteristica del processo formulare è scomparsa ; si tratta oramai di due entità , connesse sempre, ma distinte . Pertanto l’actio giustinianea nulla ha di comune con l' agere classico, tutto privatistico . È un nuovo concetto che sorge, pur restando invariato il nome. Mentre l'agere per formulas è qualche cosa di caratteristico, come Il processo civile giustinianeo 185 tutto il processo formulare, l'actio giustinianea non è che quella generica azione giudiziaria, quale si può concepire in qualunque ordinamento processuale su base pubblicistica . Ed è così che spunta la celebre definizione di actio , che ritengo impossibile in bocca ad un giurista classico, come « ius iudicio persequendi quod sibi debetur » ( fr. 51 D . 44, 7). Nonostante ogni contraria apparenza, il diritto giustinianeo è un sistema di diritti, non di azioni. Ciò simanifesta in tantimodi. La consumazione processuale è sparita . In fondo non esistono le actiones, ma l'actio , che si adatta a tutti i rapporti riconosciuti dalla legge. Le disparità di trattamento che risultavano dalla diversa re dazione formulare sono in vario modo superate. Assai istruttivo è il regime circa il concorso delle azioni ; anche qui il Corpus Iuris sembra riattaccarsi alla impostazione classica del problema, in quanto si parla sempre di concorso di azioni. Ma in realtà così non è . Nel sistema formulare sono effettivamente le azioni che concorrono, tanto vero che si tratta di vedere se, indipendentemente dal sodi sfacimento dell' attore, esercitata un ' azione, resti o no esperibile l' altra concorrente , nel caso negativo è la stessa azione che è con sumata . Con Giustiniano invece il punto di vista è sostanziale : si tratta di vedere se più diritti possano cumularsi; ed ecco perchè non è l'azione che consuma il diritto ma lo effettivo sodisfacimento. La questione dunque si sposta dal processo alla sostanza del di ritto : ciò che si consuma non è l' azione ma il diritto , tanto vero che qualora questo non sia sodisfatto, l'azione sussiste sempre. Che ancora si parli di azioni non reca alcuna meraviglia , ove si consi deri che, ancor oggi, appunto perchè, come nota il Chiovenda, non siamo completamente liberi da reminiscenze romanistiche, si suole parlare di concorso di azioni quando si dovrebbe parlare di con corso di norme che regolano lo stesso fatto . Tutto quello che si riferisce all' officium praetoris si riferisce ora al iudex ; quello che prima riguardava la concessione o meno dell' azione si riporta alla condanna o meno. Così ad es., fra i tanti casi, l' azione contro colui che in ius vocatus non ierit si accorda causa cognita ; la causae cognitio del pretore è ricordata ancora nel fr. 2, 1 D . 2 , 5 ; ma nello stesso testo si dice invece che « a com petenti iudice pro iurisdictione iudicis damnabitur ». E questa sosti tuzione deve ammettersi anche in tutti gli altri casi in cui non sia esplicitamente affermata . Roma · II 186 Biondo Biondi Giustiniano non ha abolito formalmente le classiche actiones, ma ba manifestato in modo preciso il suo pensiero in proposito , ha fornito le linee direttive agli interpreti, i quali hanno finito lentamente col costruire il sistema come qualche cosa di separato dal processo , non senza però qualche ricordo dell'antico. Cosi per sistono talune antiche denominazioni delle azioni, e non solo presso i più tardi interpreti bizantini, ma anche nel linguaggio moderno : ancor oggi si parla di Pauliana , di rivendica, di confessoria . Si tratta di semplici denominazioni, che si sono perpetuate nei secoli per forza di tradizione, ma in realtà quello che conta e presenta diversità di contenuto è la sostanza del diritto . Infatti Doroteo (Bas. 60, 19 , sch . 6 ; Hb. 5 , 609 ) osserva giustamente che non è importante l' indicazione del nome dell' interdetto, giacchè il giu dice, anche senza di essa , comprende benissimo di che cosa si tratti. Pertanto ritengo oziosa la questione che discutono i moderni storici se nel libellus conventionis fosse necessaria la indicazione del nome dell'azione. Che praticamente questa indicazione si facesse allo scopo di individuare meglio la pretesa, è ben probabile , come nulla esclude che in pratica si usasse financo redigere una formula , a guisa di programma della lite ; ma tutto ciò nulla ha a che fare con le classiche actiones e la conceptio formularum . Quello che invece ora incomincia ad avere importanza giuri dica è la causa actionis , cioè la ragione ed il fondamento del l'azione. Mentre nel regime formulare, dove ogni formula ha un proprio contenuto, la questione della causa non sorge, quando in vece l'actio diventa un mezzo generale di protezione, che può avere il contenuto più vario , come vari sono i diritti che tutela , è la causa dell'azione, che viene ad acquistare importanza. In pratica poteva servire il nome dell'azione ; ma si trapassa insensibilmente dal nome alla causa, cioè alla sostanza del rapporto, la cui tutela si invoca dall'autorità pubblica. Iurisdictio . La iurisdictio latina è la manifestazione del l' imperium del magistrato nell'orbita del diritto ; essa si esplica. praticamente nella organizzazione del giudizio o nella attuazione di quei provvedimenti che nella organizzazione di un giudizio vanno a sboccare. Il Pretore ius dicit nel senso che rilascia per il caso concreto quella formula fissata schematicamente dal ius civile : la formula proposta nell'albo è sempre qualche cosa di inerte , che Il processo civile giustinianeo 187 diventa però viva quando il pretore la rilascia in concreto tra sin gole persone ; solo in tal modo è produttiva di effetti giuridici e si può dire qualche cosa di vivo ; ed è proprio in questo senso che il pretore si qualifica come viva cox iuris civilis, cioè in quanto, per mezzo della iuris dictio, dà vita a qualche cosa che prima era inerte. Orbene si può dire che questo concetto sia mantenuto da Giu stiniano ? La risposta non può essere che negativa, perché non si tratta oramai di organizzare un processo, nė di rilasciare una for mula che contenga le pretese delle parti, ma piuttosto di applicare il diritto al caso concreto. Eppure i Digesti sono disseminati di passi classici in cui si parla di iurisdictio , e troviamo addirittura un titolo de iuris dictione (2 , 1). Ma la iuris dictio giustinianea nulla ha di comune con la iuris dictio classica , ed i relativi passi sono suscettibili di duplex interpretatio. La iurisdictio giustinianea è quella che si può concepire in un ordinamento processuale pub blicistico ; essa importa dunque attuazione della legge al caso con creto . Ed alla stregua di questo concetto bisogna intendere i passi delle Pandette. Così ad es. si parla di mandare iurisdictionem e di iurisdictio mandata ; ma non è il pretore o il proconsole che manda, ma piuttosto la legge che conferisce la giurisdizione ; infatti nel fr. 6 D . eod. la lex , di cui si parla , non è la lex Iulia , come bene os serva il Lenel, ma bensì la legge in generale , la quale conferisce a ciascun giudice la facoltà di giudicare, cioè di applicare la legge al caso concreto. Significativa è poi la degenerazione della portata dell'editto de albo corrupto. Oramai non ci sono più editti, ed una corruzione del testo della legge è ipotesi piuttosto inverosimile. Pertanto l' a zione de albo corrupto assume una portata molto più generale, in quanto riguarda la corruzione di qualsiasi documento processuale ; così mentre l' editto contemplava il caso di colui che « in albo .. . corruperit » , Giustiniano, come ha rilevato da tempo il Lenel, sog giunge « vel in charta vel in alia materia » (fr. 7 pr. D . eod.). In realtà Giustiniano intende riferirsi nè all'albo nè alla legge, ma piuttosto vuole reprimere qualsiasi falsificazione di atti e documenti relativi alla iurisdictio , intesa nel senso più ampio di amministra zione della giustizia . Quello che ora importa nell'ambito della iurisdictio è la precisa e legale fissazione della competenza. Nello stesso titolo delle Pan Biondo Biondi 188 dette la questione ed i limiti della competenza affiorano più volte per mezzo di talune interpolazioni, finchè nel Codice troviamo un titolo apposito , sotto la rubrica assai significativa « de iurisdictione omnium iudicum et de foro competenti » (3 , 13 ). Oramai la iurisdictio è del iudex , o competens iudex, come si dice talvolta ; e nel senso di iudex si deve intendere il Pretore, a meno che la parola del pretore, come negli editti, non si debba intendere come parola della legge. È caduto il pretore e la sua iurisdictio. Oramai c' è solo un giudice, che, entro l'orbita dei po teri conferitigli dalla legge, applica ed attua il diritto al caso con creto . Pertanto gli istituti ed i principi che nei Digesti troviamo in tema di iurisdictio si devono intendere alla stregua di questo concetto . Turisdictio e iudex formulare si trovano dunque a grandissima distanza rispetto alla iurisdictio ed al iudex giustinianeo . In ius vocatio . Le Pandette ed il Codice contengono sotto la Rubrica de in ius vocando ( D . 2 , 4 ; C . 2, 2 ) numerosi passi che si riferivano alla classica in ius vocatio. Ma che cosa può es sere ora la in ius vocatio? E che cosa vuol dire vocare in ius nel processo extra ordinem ? La dottrina tradizionale taglia corto , di cendo che non esiste più alcuna vocatio in ius. Scrittori più recenti come il Wenger ed il Collinet, si richiamano anche qui al roman ticismo della giurisprudenza bizantina. Ma in realtà la vocatio , a cui allude il legislatore, non è più l'atto di parte per cui nel processo formulare l' attore conduce l'avversario in ius dinanzi il pretore, ma è piuttosto la citazione a comparire in giudizio . Essa non è altro che la conventio o commonitio, contemplata in talune costitu zioni dello stesso Giustiniano (c. 1 , 3 C . 7 , 17 ; c. 4 C . 2, 2) , il quale parla qui propriamente di « in iudicium clamare » (c. 3 , 3 C . 7 , 40). L ' equivalenza di in ius vocatio a conventio e admonitio è perfetta, come risulta dalla c. 4 C . 2 , 2. E in fondo l'atto intro duttivo del giudizio . È passata la denominazione, ma la sostanza è diversa. Le innovazioni di Giustiniano si ispirano appunto a questo nuovo concetto di in ius vocatio. Scompare il vindex perchè oramai la in ius vocatio non è più un affare privato ; la cautio iudicio sis tendi causa è altra cosa . Scompaiono le speciali disposizioni intorno alla in ius vocatio presso i magistrati provinciali (D . 2, 6 ), giacchè oramai la giurisdizione ha carattere unitario ; anche qui la figura che Giustiniano mette in risalto è il competens iudex (fr . 2 , 1 Il processo civile giustinianeo 189 D . 2 , 5 ), ille ad quem vocatur (fr. 1 D . eod .), e null' altro che il giudice competente è colui rispetto al quale si dice che « in ius sine permissu meo ne quis vocet » (fr. 11, 12 D . 2, 4 ). Si può dire in una parola che i materiali legislativi, e la terminologia sono quasi immutati, ma lo spirito e la concezione dell'istituto risultano del tutto diversi. Iversi , · Editio e postulatio actionis. Molti dubbi ed incertezze regnano ancora intorno a questo argomento ; ma, se trascuriamo questioni di dettaglio e ci fermiamo ai punti più essenziali, la con clusione è precisa. Edere actionem nel processo formulare vuol dire indicare all'avversario la formula con cui si intende agire ; di questa nozione si ha traccia chiara nel fr. 1, 1 D . 2 , 13, dove si parla di colui che « producat adversarium suum ad album et demonstret quod dictaturus est » ; non è improbabile anzi che in questa materia actio sia stata sostituita a formula , come di sicuro nel fr. 1, pr. D . eod. E la postulatio non è altro che la richiesta al magistrato di rila sciare la formula che si è indicata. Quale può essere ora il valore della editio e della postulatio , quando non ci sono più le formule e non esiste più alcuna autorità che le rilasci ? Eppure le Pandette e il Codice contengono dei ti toli con apposite rubriche relative al nostro argomento. Parleremo ancora di romanticismo ed arcaismo? Ma in realtà tali istituti nel diritto giustinianeo vengono as sunti con quel carattere che risulta dal nuovo assetto processuale , e quindi hanno di comune con quelli classici solo il nome. La editio actionis non è altro che la enunciazione della pretesa accam pata dall'attore, e può farsi anche nello stesso libello , come risulta da talune significative interpolazioni concordemente ammesse ; fr. 1 pr. D . eod .: « proinde sciat reus... veniat instructus ad agendum » ; fr. 1, 2 D . eod . : « edere est etiam copiam describendi facere vel in libello complecti » ; fr. 6 , 7 D . eod. : « edi autem est vel dictare, vel tradere libellum ». Queste interpolazioni danno una nuova fisonomia all' istituto , nonostante la conservazione della antica terminologia e di molti passi che all' antico istituto si riferiscono. Non si tratta pii della indicazione della formula che servirà come base del giu dizio , ma piuttosto della comunicazione all' avversario della pretesa che si accampa in giudizio . E poichè il diritto ancora nella com pilazione appare formalmente racchiuso nelle actiones, nulla di strano che fin dall' epoca postclassica si facciano degli elenchi di actiones 190 Biondo Biondi onde facilitare la editio. Ma Doroteo avverte, come si è detto , che anche senza l' indicazione dell' azione, qualora l' attore accampi la sua pretesa , il giudice sa di che si tratti. Quello che ora interessa nella editio actionis è che l'avversario abbia conoscenza della pretesa ; cosi Giustiniano non trova difficoltà che l'attore faccia la editio di due azioni, salvo a concentrare in una sola il giudizio ; fr. 1, 4 D . 43, 3 : « nam duas dictamus pro testati ex altera nos velle consequi quod nos contingit ». La postulatio, di cui parlano ancora le Pandette , non è la ri chiesta che si fa al magistrato del rilascio della formula indicata nella editio ; tutto cioè è esplicitamente abolito , come dice la R . Cod. 2 , 57 (58): « de formulis et impetratione actionum sublatis » . Si tratta piuttosto di ben altro, cioè della richiesta che si fa al giu dice di accogliere la pretesa accampata . È sempre lo stesso spo stamento dal processo alla sostanza, considerando il processo come solo mezzo di attuazione del diritto . Esplicito è il fr. 1, 2 D . 3, 1 : « postulare autem est desiderium suum vel amici sui in iure apud eum , qui iurisdictioni praeest, exponere: vel alterius desiderio contra dicere » . Si dice anche che « postulare... dicimus pro tribunali petere » . Non c ' è più alcuna impetratio actionis ; ma occorre che la richiesta « aptam rei et proposito negotio competentem eam constiterit » (c . 2 C . 2 , 57). Litis contestatio. Questo è il punto più sicuro e clamoroso, rispetto al quale possiamo saggiare la bontà dei metodi ricostrut tivi che propongo. Di litis contestatio si parla ad ogni piè sospinto nel Corpus Turis. È certo però che la I. c. classica è caduta insieme alle for mule. Ma era forse necessario dare la caccia all' istituto ed alla pa rola ? Ciò non era praticamente possibile , e peraltro ogni ordina mento giudiziario ha necessità di fissare, da vari punti di vista e con vari effetti, un determinato momento del processo. Orbene al l'uopo poteva ben servire la vecchia denominazione di litis conte statio , alla quale se ne aggiungono ora di nuove, ricavate dalla co gnitio , com lis inchoata , controversia mota ecc. Tutto l'apparato dei testi che parlavano della litis contestatio poteva mantenersi ancora, giacchè Giustiniano con la celebre interpolazione della c . 1 C . 3, 9, ammonisce l' interprete che « lis enim videtur contestata , cum iudex per narrationem negotii causam audire coeperit » (cfr. Bas. 7, 1, 3 ; Hb. I, pag. 242). Non mi nascondo le difficoltà che ha suscitato Il processo civile giustinianeo 191 questa dichiarazione, ma è certo che la I. c. del processo giusti nianeo non è quell' atto su cui si imperniava al tempo delle for mule la lite, ma è piuttosto un momento del processo , per quanto sia dubbio precisarlo . Pertanto nel sistema giustinianeo la celebre enunciazione che « iudicio contrahi » ( fr. 3 , 11 D . 15 , 1), nonchè tutti gli effetti clas sici, che discendevano dalla litis contestatio , concepita come atto che devolve la decisione della controversia all'arbitro, sono travolti, nonostante che eventualmente siano ancora attestati nel Corpus Iuris. Oramai sussistono solo quegli effetti compatibili col nuovo concetto di l. c., considerata come momento del processo, ed i passi della compilazione, come sempre, sono dunque suscettibili di una duplex interpretatio . Intentio ed exceptio . Di intentio ed exceptio, di intendere ed excipere si parla nel Corpus Iuris ad ogni piè sospinto . No poteva essere diversamente , giacchè di tale terminologia erano disseminati i testi classici che servirono a Giustiniano. Ma tali termini pas sarono con quel significato compatibile con il nuovo processo . In tentio non è altro che la pretesa dell'attore, come intendere vuol dire affermare in giudizio una pretesa. E la exceptio non è più una clausola formulare, ma piuttosto una allegazione difensiva del con venuto . Giustiniano dice che serve « ad impugnandum actionem » ( Inst . 4 , 13, 1). La caduta delle formule rende certo difficile la individuazione della exceptio nonchè il valore dell' antitesi tra ipsum ius ed exceptio. Questa antitesi nel sistema formulare si riconduceva al contrap posto tra ius civile e praetor , e la exceptio, trattandosi di clausola formulare , era nettamente individuata da tutte le allegazioni ac campate dal convenuto neganti il ius dedotto nella intentio. Ma oramai quando la exceptio non è pars formulae, che può essere in serita o meno nella formula , ma deriva direttamente dalla legge, sorge il problema assai grave della separazione della exceptio da tutte le negazioni del diritto dedotto dall'attore. È un problema che soltanto nel sistema giustinianeo si può profilare, e dà luogo ad infiniti sforzi costruttivi degli interpreti, i quali conducono solo a negare la nozione formulare della exceptio . 11. L ' indagine potrebbe ancora spingersi ad altri istituti pro cessuali, come ad es. le prove, la sentenza , la res iudicata , 192 Biondo Biondi l'esecuzione. Ma le esperienze raccolte sono già sufficienti per autorizzare una conclusione. Il processo giustinianeo segue e conclude la evoluzione della cognitio extra ordinem . Nulla attinge al sistema formulare , ma ad esso si contrappone nettamente . E se gran parte degli istituti pro cessuali classici sono passati nel Corpus Iuris, quello che è passato non è la sostanza , ma la semplice denominazione, giacchè essi sono intesi non più nel significato che avevano in epoca classica , ma in quello che possono avere sal nuovo sistema processuale , ed è in funzione di questo che bisogna intenderli, se non si vuole falsare lo spirito e la volontà del legislatore . I materiali classici, come conferma Giustiniano, tramandavano elementi vivi e morti così compenetrati che una separazione legi slativa risultava impossibile. Però Giustiniano, riattaccandosi alla tradizione della cognitio , ha fornito le linee direttive per operare tale separazione. Può darsi che Giustiniano ben poco abbia innovato rispetto alla tradizione della cognitio ; ma è certo che ha dato un assetto legislativo preciso e definitivo alla tradizione precedente. Il caos e la confusione, che tormentavano l'epoca postclassica sono superati, non tanto perchè Giustiniano ha cercato di eliminare contrasti, ma sopratutto perchè ha fornito quelle linee direttive e la certezza legislativa, che da secoli invano si attendevano, alla stregua delle quali fu possibile riplasmare tutto il bagaglio giuri dico che tramandava la tradizione latina . La compilazione giustinianea presenta sia la materia giuridica che i fermenti attivi, i quali, attraverso l'opera paziente degli in terpreti, dovevano operare quel processo didissoluzione e riduzione del diritto romano, che era assolutamente indispensabile affinchè il diritto di Roma potesse diventare un'altra volta il diritto di tutte le genti. Ed è appunto perciò che, mentre il processo per formulas ap pare assai remoto alla nostra mentalità, il processo giustinianeo , ricostruito secondo le direttive del legislatore, appare tanto vicino al processo moderno, che rispetto ad esso sorgono quei problemi, si possono affacciare quelle costruzioni giuridiche che si pongono rispetto al processo moderno. In tal modo cerchiamo di dare delle precise concezioni laddove Giustiniano ebbe delle vaghe e talvolta confuse intuizioni. Il processo civile giustinianeo 193 L ' opera di Giustiniano segna una tappa decisiva nella evolu zione del processo , non perchè abbia innovato o trasformato, ma perchè, concludendo legislativamente la evoluzione della cognitio, ha gettato le basi del processo moderno, il quale appare dunque non latino, se con questa qualifica si voglia alludere al tipico processo privato dei Romani, ma giustinianeo. Si è detto da qualche insigne scrittore che con la morte di Giustiniano sia finito il suo Impero ed il suo diritto . Ma a questa conclusione si può arrivare solo considerando il Corpus Iuris come una accozzaglia di materiali legislativi eterogenei e contrastanti. Ma in realtà così non è. Nella immensa mole della compilazione c' è uno spirito ed una volontà legislativa. Il Digesto , come notava opportunamente or non è molto De Zulueta , presenta non solo le soluzioni giuridiche volute da Giustiniano,ma tutto un nuovo pen siero giuridico. Questo pensiero talvolta è nascosto, occorre una più profonda penetrazione per raccoglierlo ed isolarlo ; ma c' è sempre. Nè può essere diversamente, giacchè il Corpus Iuris è compilazione solo materialmente ; formalmente non è che sistema legislativo il quale apre tutto un nuovo orizzonte, dà inizio ad una nuova fase, segna nuovi destini al diritto di Roma. E quando riu sciamo a rintracciare il pensiero di Giustiniano, nella maggior parte dei casi, potremo accertare che la evoluzione successiva del diritto , guidata dall'opera degli interpreti, si è svolta , in linea di massima, secondo la volontà di Giustiniano . LEOPOLD WENGER ORD , PROFESSOR DER RECHTE AN DER UNIVERSITÄT MÜNCHEN EINIGE BEMERKUNGEN ZUR HISTORISCHEN BEHANDLUNG DES ROMISCHEN UND JUSTINIANISCHEN ZIVILPROZESSRECHTS SUMMARIUM Historicum magis quam dogmaticum genus scribendi in studiis nostrae aetatis , quae ad processum civilem Romanum pertinent, eo modo explicare velim , quod magnae partes huius studii magis ad ius publicum Romanum quam ad privatum , quod nobis propius est, spectant. Imperium magistratuum iurisdictionem in se continens et imprimis in provinciis quasi ab omnibus vinculis liberum historico iuris Romani unicam imaginem praebet. In explicanda enim « cognitione » conti nuam lineam videmus a temporibus regiis usque ad Iustinianum Imperatorem . Et ipsum « iudicium privatum » universali huic et uniformi contemplationi non omnino, ut puto, obstare videtur. Quam observationem tantummodo historicam propono. Wenn ich nach so vielen gelegentlichen Hinweisen und nach so gehaltvollen prinzipiellen Ausführungen zum justinianischen und zum römischen Zivilprozess überhaupt als letzer Sprecher zu diesem Thema noch in gebotener Kürze ein paar Worte sagen darf, so möchte ich die auch auf diesem Krongresse in Bologna und in Rom wieder in Erscheinung getretene Beobachtung vorausstellen , dass bei der wissenschaftlichen Behandlung des Zivilprozessrechtes, wenn nicht ausschliesslich so doch sehr stark, die historische Betrachtung im Vordergrunde steht. Gewiss hat auch heute noch die dogmatische Behandlung mancher Probleme des römischen Zivilprozessrechts ihre Bedeutung als Grundlage oder doch Ausgangspunkt für die entsprechende modernrechtliche Dogmatik, (1 ) aber wenn wir die Literatur der letzten und vorletzten Zeit zum römischen und justi nianischen Zivilprozessrecht auch nur flüchtig zu überschauen ver suchen , so stossen wir teils auf Arbeiten, die vom justinianischen Recht ans ins Recht des Mittelalters vorzudringen suchen und zunächst dogmengeschichtlichen Charakter tragen , teils aber - und das ist in der Romanistik aller Länder wohl der überwiegende Teil aller Zivilprozessliteratur - rein historisch die Geheimnisse des Pro zessrechts von den ältesten Zeiten her zu ergründen suchen , wobei (1) Ich nenne etwa das Buch von JAMES GOLDSCHMIDT, Der Prozess als Rechtslage ( 1925 ). Meine Stellungnahme zu den romanistischen Partien habe ich in der Zeitschr. d . Sav. St. 46 (1926 ) 438-458 niedergelegt. 198 Leopold Wenger sie selbst dem justinianischen Recht oft nur einen Ausblick gönnen . Und dieses Verhältnis dürfte sich wohl auch in naher Zukunft wenig ändern. Wie viel verspricht da die wissenschaftliche Ausbente aus den neuentdeckten Fragmenten des Gaius, von denen Albertario dem Kongresse einen vorläufigen Bericht erstatten durfte , den Arangio - Ruiz zu diesem Zweck übersendet hatte. Sollen wir doch da Unbekanntes über die legis actio per judicis postulationem und per condictionem erfahren . Mit Spannung sieht die Romanistik der Entschleierung mancher Geheimnisse des Legisaktionenprozesses entgegen ( 2) Was darf sich da die geschichtliche Prozessforschung wieder für Förderung erwarten ! Aber es ist wieder reine Rechts geschichte ohne Gegenwartsbezogenheit. Indes wir brauchen gar nicht in ferne römische Vergangenheit zurückzugehen, ungleich mehr als das Privatrecht erscheint auch der Zivilprozess des Corpus Juris als zeitgebunden . Ist er doch der Prozess des 5 und 6 Jhd. n . C ., der Prozess des ausgehenden Rö merreichs. Und wenn auch ein wesentlicher Einfluss auf das mittel alterliche weltliche und geistliche Prozessrecht des romanisch - ger manischen Westens nicht anders als des byzantinisch - griechischen Ostens führt, so ist es doch wieder eine vornehmlich rechtshisto rische Aufgabe, solchen Einfluss festzustellen . Und erst, je weiter der Forscher der Gegenwart zu vordringt, kann sich sogar unver sehens die historische und dogmengeschichtliche zur dogmatischen Darstellung von selber wandeln . Dabei macht gerade für Abhängigkeits - und Einflussforschungen auf zivilprozessualem Gebiete die grosse Bedeutung des Formele ments besondere Schwierigkeiten . Beim Konservativismus, der sich wie im römischen Rechte überhaupt, so ganz besonders im For menwesen des Prozesses ausprägt, kann aus gleichen juristisch technischen Bezeichnungen prozessualer Vorgänge nicht ohne wei teres ein Schluss auf gleiche sachliche Bewertung der entsprechenden Vorgänge gezogen werden. Für das klassische und nachklassische römische Prozessrecht im eigentlichen Sinne, d . i. für die Zeit bis Justinian , ist das bekannt genug, weshalb wir bei unserem Ver such , eine grosse einheitliche Entwicklungslinie des römischen Prozessrechts bis Justinian aufzuzeigen, von Schlüssen aus Form -und Formelgleichheiten absehen und auf sach (2 ) Ich verweise einstweilen auf ALBERTARIO, Gnomon 1933, 326-328 ; hier 327 . Einige Bemerkungen zur historischen Behandlung etc. 199 liche Momente das alleinige Gewicht legen müssen . Wie sehr diese Vorsicht bei Schlüssen aus Formerscheinungen aber auch für die Beurteilung der Abhängigkeit des mittelalterlichen vom römi schen Zivilprozessrechte zutrifft, dazu möchte ich hier nur mit einem Hinweis an die Geschichte der litis contestatio erinnern, wie sie Rudolf Sohm d . J . gezeichnet hat ( 3 ). Hier zeigt sich ein Bruch der vielleicht nach dem Namen zu vermutenden Rechtskontinuität. Der nachklassische Begriff ist im Laufe des frühen Mittelalters un tergegangen ; die litis contestatio der spätmittelalterliche Theorie und Praxis ermangelt des unmittelbaren geschichlichen Zusammenhangs mit der spätrömischen , geschweige denn klassischen Litiskontestation ; sie ist romantische Theorie der Renaissance (4). Erst eine im klas sisch - römischen , im justinianischen und im mittelalterlichen Recht erfahrene Zusammenschau konnte hier über nomineller Zusammen gehörigkeit grundsätzliche Verschiedenheiten erfassen . Wenn ich hier aus älterer Zeit noch bekannte Arbeiten von Gustav Demelius zitiere, welche die confessio (5 ) und den Eid (6) untersuchen, und, indem sie diese hervorragend wichtigen Prozessinstitute für das klas sische und justinianische Rechtbehandeln , wiederum den Zusammen hang mit entsprechenden modernrechtlichen Einrichtungen dartun , so mag dieser Rückgriff auf ältere literarische Werke zunächst zeigen , dass für Anführung neuerer Beispiele monographischer Natur einigermassen Verlegenheit besteht. Natürlich vergesse ich nicht grosser systematischer Werke – ich nenne nur Bethmann Hollweg , die den Gang des Zivilprozessrechts von der römischen Frühzeit bis ins späte gemeine Recht verfolgen, die also im Ver laufe ihrer grossen Gesamtdarstellung wirkliche und scheinbare Rezeption, Abhängigkeit und Unabhängigkeit, Zustimmung und Widerspruch zwischen gemeinrechtlicher, mittelalterlicher, justinia nischer und vorjustinianischer Prozessgestaltung aufzeigen . Auch muss ich ja bekenneu , dass ich die neugriechisch byzantinisch -recht ( 3 ) Die litis contestatio in ihrer Entwicklung vom frühen Mittelalter bis zur Gegenwart (1914 ). Dazu MITTEIS , Zeitschr. d . Sav.-St. 35 (1914 ) 350- 352. STEIN WENTER, Krit. Viertelj. LIV (XVIII), 89-96 . Vgl. WLASSAK , Anklage und Streit befestigung (1917 ), 1433. (4 ) Somm, a. a. o. 1. (5 ) Die Confessio im römischen Civilprocess und das gerichtliche Geständnis der neuesten Processgesetzgebung (1880). (6) Schiedseid und Beweiseid im römischen Civilprozesse (1887). 200 Leopold Wenger liche Literatur nicht hinreichend zu überblicken vermag, und dass auch die italienische, französische und englische Prozessrechtsge schichte ausserhalb meines engeren Arbeitsgebietes liegen, aber Ar beiten wie die Sohms dringen doch gemeinhin auch in den Bereich des antiken Rechtshistorikers . Und so darf vielleicht mit der durch all' diese Einschränkungen gebotenen Vorsicht doch der Wunsch nach mehr Arbeiten auf mittelalterlich - dogmengeschicht lichem Gebiete im Zivilprozessrechte geäussert sein , ehe man eine ganz sichere Antwort auf die Frage nach der Teilhaberschaft auch des justinianischen Prozessrechts an der modernen Zivilpro zessproblematik wird geben wollen. Wie schwierig solche generelle Stellungnahmen sind, dafür darf ich noch mit einem einer in Bologna verhandelten und abgelehnten Seitenblick These gedenken , die den kirchlichen Prozess des Altertums eher auf jüdische als auf spätkaiserlich -römische Basis stellen wollte (7 ). Kommt nun freilich das jüdisch - talmudische Recht für die Gestaltnng sei es des italienischen, sei es des bysantinischen Prozesses als auch nur kleinstes Quellenbächlein nicht in Betracht, so bleibt doch für den Westen und Osten nationale Bildung germanischer und griechi scher Herkunft a priori zu untersuchen . Eine einheitliche Linien führung in der Entwicklung des römischen Zivilprozessrechts von Justinian ins Mittelalter und in unsere Zeit herauf, wie wir sie in der Hauptsache von Justinian rückwärts zu finden versuchen werden , scheint aber schon nach diesen Andeutungen nicht gegeben zu sein . Mögen diese paar Worte auch eher nach Bologna und in den ersten Teil dieses Kongresses , wo die Zeit von Justinian vorwärts zur Debatte stand , gehört haben , als in diesen römischen Teil, der die Gesetzgebung des Kaisers als Ergebnis der ganzen römischen Vergangenheit zu würdigen bestimmt ist, so schien mir doch gerade für die programmatische Einstellung unserer Romanistik zum justinianischen Zivilprozessrecht die Betonung der Tatsache erforderlich , dass auch wenn wir von Justinian vorwärts blicken , (7) B . WILANOWSKI, Der kirchliche Prozess im christlichen Altertum . (Wilna 1929). Vgl. STEINWENTER, Zeitschr. d . Sav.- St. 51 (1931) 464, woher ich von der Frage Kenntnis erhielt. Nunmehr ist sie wohl im ganz verneinenden – und zugleich für das römische Erbe im positiven – Sinne durch STEINWENTER ' s, Vortrag auf diesem Kongresse in Bologna : « Der Einfluss des römischen Rechtes auf den antiken kanonischen Prozess » erledigt. Einige Bemerkungen zur historischen Behandlung etc. 201 zivilprozessualen Untersuchungen fast nur ein historischer Cha rakter innewohnt. Diese Feststellung mag aber auch darum nicht ohne Interesse sein , weil sie literargeschichtlich die zivilprozessualen For schungen mehr den öffentlichrechtlichen als den pri vatrechtlichen romanistischen Studien anzunähern scheint. Auf öffentlichrechlichem Gebiet überwiegt ja überhaupt entschieden die historische gegenüber der juristischen Darstellungsweise. Auch ein Mommsen hätte nur als Jurist sein Staatsrecht niemals schreiben können. Das Staatsrecht von heute hat sich nun ja ganz anders von römischer Vergangenheit frei gemacht und diese von seiner modernen Forschung ausgeschaltet als das Privatrecht. Freilich mag auch hier eine Notiz pro praeterito angefügt sein. Tauchen nicht auch im öffentlichen Rechte im Wandel der Zeiten staatsrechtliche Kon struktionen und Theorien wieder auf, die dem Historiker geläufig sind und die manchem modernjuristischen Konstrukteur längst er ledigt schienen ? Ich brauche nur gerade heute wieder die gewaltige Idee der einheitlichen und ungeteilten Staatsgewalt zu zitiereu, des Imperiums, auf dem die Grösse Roms durch alle Wandlungen der Verfassungen hin geruht hat und dessen dauernde Auswirkung in der Zivilgerichtsbarkeit ich mit wenigen Strichen zu zeichnen noch beabsichtige. Aber freilich die fürs Privatrecht vielfach noch in Anspruch genommene Kontinuität solcher Erscheinungen mit unseren Rechtseinrichtungen , die eine stärkere dogmatische Behand lung auch des römischen Rechtes veranlasste, ist gerade im öffent lichen Recht nicht gegeben . Hier hat ja die Rezeption der abso lutistischen Staatsidee, so sehr sie das mittelalterliche Kaisertum wünschen mochte , versagt. Und weiter: während im Privatrecht zwar auch genug neue Probleme vor allem mit der neuen Technik her vorkommen, so hat doch die gemeinrechtliche Dogmatik manch eines dieser neuen Probleme mit Hilfe der Jurisprudenz des Un bewussten einer Digestenstelle zu meistern verstanden . In ganz anderem Ausmasse ist da die moderne Psoblematik des öffentlichen Rechts über die staatsrechtliche Kunst und geniale Einfalt der Römer hinausgewachsen . Ob ein Vergleich freilich immer zu Gun sten der Modernen ausfällt, steht hier nicht zur Debatte . Und spie gelt sich nicht auch dieses verschiedene Verhältnis von Einst und Jetzt, in welchem Privatrecht und öffentliches Recht des Altertums und der Jetztzeit zu einander stehen , in der wissenschaftlichen Li Roma · II 202 Leopold Wenger teratur ? Ich habe darauf schon hingedeutet : Ist nicht das Privat recht die Domäne der Juristen geblieben , die es bald historisch, bald dogmatisch gegenwartsbezogen, erläutern, während das Staats recht der Römer auch unter den Juristen denjenigen überlassen blieb, die sich mehr nur in die Vergangenheit zu versenken liebten ? Und wenn , um zum Zivilprozess zurückzukommen , seine hi storische Betrachtung nun einmal vorherrscht, so drängt jeden Historiker das wissenschaftliche Streben nach festem Grund, das Streben , gleichsam bis zum gewachsenen Boden vorzudringen , immer weiter zurück in die Vergangenheit. Das allein , nicht etwa bloss grössere teclinische Schwierigkeiten von Untersuchungen in der weniger vorbereiteten glossatorischen und der späteren mittelalter lichen Zeit, nag das Ueberwiegen von Prozessrechtsstudien der klassischen , ja der noch früheren Zeit, von tastenden Versuchen der Ergründung archaischer Rechtszustände, kurz römisch -recht licher Prozessrechtsstudien zu erklären , die nur « bis Ju stinian abwärts » reichen . Und selbst das justinianische Prozess recht war, wie schon angedeutet, längere Zeit etwas stiefmütterlich behandelt worden , bis Forscher von heute, die wir in unserer Mitte sehen dürfen , sich seiner wieder lebhaft annahmen. Und wer von uns ist nicht überzeugt, dass die merkwürdig fliessende ägyptische Rechtsquelle hier fruchtbar Neuland erschlossen hat und täglich neu erschliesst ? Wer aber wollte für die in den Mittelpunkt gestellte römische Prozessrechtsgeschichte der klassischen Zeit und ihre Ausstrahlungen nach früher und später, eine ganz andere geistige Quelle übergehen , wer wollte übersehen , was die viva vox der Alt meister des römischen Zivilprozessrechts anregend, aneifernd , an feuernd, auch Widerspruch erregend , bedeutet, die ein Girard , ein Costa lehrend hören liessen , die nicht nur wir Deutsche aus dem Munde eines Lenel und Wlassak in jugendfrischer Klarheit zu vernehmen das Glück haben ? Auch hier wieder sind ja nen mehr als measures. Jedes positive Recht ist ein Kind seiner Zeit. Nur die Satzungen des im Glauben an die übernatürliche Ordnung fundierten Natur rechts erheben sich zu überzeitlicher Höhe. Der Glaube an die Geltung eines solchen Rechtes wurzelt in der Weltanschauung , in jenem unfassbaren Etwas, das eine liberalistische Zeit lange aus der Erkenntnis verbannen wollte, das aber grösser ist, als ihr spe kulierender Verstand . Es wäre möglich , in der Geschichte des Zi Einige Bemerkungen zur historischen Behandlung etc. 203 vilprozesses nach solchen überzeitlichen Grundsätzen , nach einem Recht, wie es sein sollte, zu suchen und da – etwa im Prinzip beiderseitigen Gehörs – einen Ausfluss des Gerechtigkeitsprinzips zu sehen. Aber solche geschichtsphilosophische Fragen erheischten vor ihres Beantwortung ganz andere Vorarbeit, als sie hier vorliegt. Wir haben bei der Frage nach Zusammenhängen oder Gegensätzen , nach einer ungebrochenen oder gebrochenen Entwicklungslinie nur das positive römische Prozessrecht im Auge, wenn wir dessen Wandlungen im Laufe der römischen Rechtsentwicklung bis auf Justinian überblicken und in den immer wieder von neuen Schichten überlagerten Entwicklungssstadien dieses Prozess rechts nach einer Einheitlichkeit suchen . Ich greife auf Gesagtes nochmals zurück. Das jeweilige öffent liche Recht, oder, genauer gesagt, in erster Linie derjenige Teil des Ius publicum , den wir als Verfassungsrecht bezeichnen, trägt meist das Siegel einer Umwandlung, einer Neuheit der ethi schen, politischen ,wirtschaftlichen Dinge auf der Stirne. Wir setzen ein bestimmtes Jahresdatum 'an für den Sturz der Könige, wir suchen – wennglelch nicht über den Tag, so doch über die Frage einig – nach dem Datum , von dem ab wir die Monarchie in ihrer Prinzipatsgestaltung, und das spätere Datum , von dem ab wir sie in ihrer absoluten Form rechnen wollen . Mit annähernd gleicher Präzision lassen sich Fragen nach zivilprozessualen Wandlungen nun allerdings nicht beantworten. Wissen wir ja doch z . B . alle , dass zunächst neben die legis actio das Formularverfahren , dass neben den ordo iudiciorum die cognitio extra ordinem getreten ist. Aber wir sehen doch wiederum die , wenngleich sich überschnei denden , so doch deutlich als Phasen der Entwicklung erkennbaren und sich von einander abhebenden Schichten des Zivilpro zesses im Grossen und Ganzen deutlicher als etwa beim Privat recht, sodass sich auch in diesem Punkte das Zivilprozessrecht mehr dem öffentlichen Recht nähert. Gewiss : Die Interpolationenforschung ist mit Eifer daran , auch die privatrechtlichen Phasen aufzuklären , aber die Ar beit ist hier noch unverhältnismässig schwieriger. Sie verliert sich noch in viel Detail. Dort, wo man schon sichere grosse Linien, etwa für den neuernden Einfluss der Schule von Berytos gefunden zu haben glaubte , ist vieles wieder ganz zweifelhaft geworden . Wann ist der geistesgeschichtlich so unzweifelhaft bedeutsame grie 204 Leopold Wenger chische Einfluss entscheidend gewesen ? Wie steht es, um nur eines hervorzuheben, mit der Voluntaslehre ? Auch unser Kongress hat die Problematik so vieler Grundfragen, die verschiedene Einstellung zu ihnen , aufgezeigt. Ergebnisse, die knapp gefasste präzise Ant worten etwa auf allgemein gehaltene Beeinflussungsfragen er möglichten, werden heutzutage kaum eindeutig gegeben werden können . Aber vor dem Versuch allzu scharfer zeitlicher Schichten abgrenzuug wird heute schon gewarnt werden dürfen . Wo nicht etwa ein radikaler, revolutionärer wirtschaftlicher Umsturz mit der Eigentumsordnung, um nur diese hervorzuheben , bricht, pflegt das Privatrecht auch gewaltigen politischen Neuordnungen recht langsam zu folgen. Ohne äusserliche, weithin sichtbare Wandlung vollzieht sich, um an diesem Beispiele zu zeigen , woran ich denke, die Um gestaltung des individualistischen Eigentumsbegriffes, der immer dem römischen Recht als solchem vorgehalten wird , zum sozialen Begriff des der Gemeinschaft dienenden Eigentums, von dem Ju stinian schliesslich sagt, dass es der res publica fromme, ne quis re sua male utatur (8 ). Schönbau er hat in hoch interessanten, zunächst dem Berg rechte dienenden Monographien (9) gezeigt, wie verschieden die Eigentumstheorie im Rom selber und in der Provinz geartet war. Wenn ich hier dieser verschiedenartigen Gestaltung nachgehend einen kurzen Exkurs einschalte , so wird die Einordnung desselben ins zivilprozessuale Gebiet damit gerechtfertigt werden dürfen , dass auch im Prozess grundsätzliche Gegensätze zwischen der Hauptstadt mit ihrem Bürgertum und der Provinz mit ihrem Untertanenbegriff sich zeigen und auch im Prozess die Provinz Siegerin geblieben ist. Rom ist Handelsstadt, Handelszentrum und Kapitalsmetropole geworden . Dort ist die Wirtschaftsordnung kapitalistisch . Sehe jeder, wie er' s treibe. Die Eigentumsordnung schützt den Eigen tümer, das Schuldrecht den Gläubiger. Der Staat mischt sich nicht mit ausgleichenden sozialen , den Schuldner schützenden Massnahmen ein . Anders aber ist die Wirtschaftsordnung der Provinzen , der (8 ) Inst. I, 8 , 2 . Dort sehen wir an einem typischen Beispiel das echt römisch konservative Werden eines solchen Satzes. (9 ) Zur Erklärung der lex metalli lipascensis, Zeitschr. d . Sav.- St. f. Rechtsy. 45 (1925 ) 352-390 ; 46 (1926 ) 181-215 ; Beiträge zur Geschichte des Bergrechts (1929 ). Vgl. auch meine Bemerkungen, Arch . f. Papyrusforsch. X , 170. Einige Bemerkungen zur historischen Behandlung etc. 205 hellenistisch gestalteten Welt, woher wir Näheres wissen , und, wenn Vipasca ein Beispiel sein darf, auch westlicher Gebiete. Dort steht freilich immer voran die Fürsorge für die staatlichen Finanzen, aber gleich daneben die wirtschaftspolitische Fürsorge für den Un tertanen. Wohl und Wehe des Staates ist mit dem des Einzelnen , Wohl und Wehe des Einzelnen mit dem des Staates untrennbar verbunden . Aus der Provinz sind die anderen Ideen gekommen , die schliesslich über das liberal-kapitalistische System als solches den Sieg davongetragen haben : ne quis re sua male utatur. Freilich in unserer modernen Rechtsliteratur ist ungleich mehr von der Haupt stadt als von der Provinz die Rede, wird die wirtschaftliche Freiheit als Selbstverständlickeit behandelt und werden leicht die sozialen Bestrebungen der Monarchie kurz abgetan , wenn nicht ignoriert, oder als Schritte ins « dunkle » Mittelalter bei gar manchem rasch diskreditiert. Und doch sind alle diese sozialen Massnahmen von einer altrömischen Einrichtung getragen , die soweit wir sehen können, immer über der Libertas des Civis stand, nämlich vom auch schon genannten Imperium des Magistrates. Es fragt sich nur, wo das Imperium eingreift. Lange Zeit hat es sich wohl jeden Eingriffs in die private Sphäre des Bürgers enthalten. Lange Zeit hindurch ist zwischen der potestas des Beamten und der patria potestas des Civis kein Kovflikt gegeben . Denn beide Gewalten gehören vom soziologischen Standpunkt aus besehen ja einer einheitlichen Sphäre an . Aus dem Kreis der Bürger , die zuhause ihre Macht wie Impe rienträger ausüben , kommen die Imperienträger des öffentlichen Rechtes. In öffentlichen Dingen muss der Bürger dem Imperien träger gehorchen . Familiengewalt und Eigentum , ja die so unso ziale Uebermacht des Gläubigers gegen den Schuldner ist dafür dem Bürger vom Rechte gewährleistet. Die Satzungen der Zwölf tafeln sind aristokratischer und plutokratischer Natur. Und wir werden nicht irren, wenn wir ihnen manche Verschlechterung der sozialen Position des kleinen Mannes, des proletarius, gegenüber der Königszeit zuschreiben . Freilich das imperium war da, aber warum sollte es in eine Privatrechtsordnung eingreifen , die dieje nigen so schön finden mussten , aus welchen der Kreis der Impe rienträger tatsächlich hervorgieng ? Und waren die Beschränkungen , denen sich das dauernde und alleinige Imperium des Königs unter werfen musste, nicht eher Festigungen der Macht der herrschenden Kreise ? Und war die lex, die den Bürger schützte und band, nicht 206 Leopold Wenger eher eine aristokratisch - republikanische, denn eine « demokratische » Einrichtung ? Ich brauche nicht auszuführen , dass auch die Plebe jeremanzipation in erster Linie den homines novi zugute kam . Ich muss mich hier mit diesen Andeutungen begnügen. Eine auch nur flüchtige Betrachtung der sozialen Revolution des letzten Jahrhun derts der Republick mit ihren politischen Folgen könnte diese An deutungen nur bestätigen. Ist nicht demgengenüber die Provinz überhaupt die Bringerin des Neuen , des Sozialen , ist sie nicht die Ueberwinderin jenes stadtrömischen Individualismus? Politisch und verfassungsrechtlich ist es ja doch so gewesen : aus der von den Schranken der Kollegialität und allmählich auch der Annuität be freiten Provinzialstatthalterschaft ist die Monarchie erwachsen . Und lehrt uns, um zum Prozessrecht zurückzulenken , dessen Entwicklung etwas anderes? Ist nicht die Provinz der Boden für die volle Beamtenkognition ? Für das durch stadtrechtliche Hemmungen , durch den ordo iudiciorum unbetroffene Gericht des königlich wirkenden Beamten ? Und, um endgiltig zu unserem en geren Thema zurückzukehren, ist nicht Justiniaus Prozessrecht der Abschluss einer Entwickung, in der das Beamtengericht sich end giltig von allen Schranken befreit hat, welche das iudicium priva tum ihm auferlegt ? Ich komme auf ein sehr umstrittenes Gebiet, wo ich Sie heute so wenig wie früher überzeugen zu können hoffen darf. Aber vielleicht werden sich doch bei wiederholter Erörterung die Meinungen klären und einander nähern . So darf ich bei ge nugsam bekannten Dingen doch noch etwas verweilen . Immer ist es die Gerichtsverfassung, die von der politi schen Gestaltung des Staatswesens in viel höherem Masse unmit telbar betroffen wird als das Gerichtsverfahren . Diese Verflechtung der Gerichtsverfassung mit der politischen Verfassung darf als all gemein anerkannt gelten. Ebenso soll die herrschende Lehre über die Natur des iudicium legitimum nicht neuerlich erörtert werden . Gleichwohl muss ich, wie angedeutet, die zweifelhaften Anfänge dieser eigenartigen gebotenen Zweiteilung des iudicium privatum darum berühren, weil meiner Ansicht nach auch die obligatorische Vorschrift privater Parteienlitiskontestation die Gesamtvorstel. lung von einer Einheit in der Entwicklung des römi schen Zivilprozessrechts und von dem Abschluss dieser Entwicklung im justinianischen Prozesse nicht widerlegt. Es ist bekannt, das die Ansichten darüber ausseinander. Einige Bemerkungen zur historischen Behandlung etc . 207 gehen, ob die Anfänge des iudicium privatum in einem Schiedsge richt zu suchen sind, das erst allmählich der Staat in seine Ob sorge nimmt, ohne es seines grundsätzlich privaten Charakters zu entkleiden, oder ob dass königliche Gericht in der republi kanischen Aera « demokratisiert » wurde, ohne doch zum rein pri vaten Schiedsgericht zu werden. Dass die Quellen , Cicero, vor allem Dionysius, aber auch noch in den Digesten der Jurist Pomponius die Einführung der sogenannten Geschworenengerichte dem Abbau der monarchischen Vollgewalt zuschreiben, ist auch bekannt, ebenso bekannt ist endlich aber, dass von unserer Literatur der Wert der Quellen für diese Behauptung bestritten wird . Ich halte sie immer noch für die wahrscheinliche, ohne natürlich leugnen zu wollen , dass kleinere Angelegenheiten wohl auch unter Nachbarn von einem Schiedsmann gelegentlich erledigt werden konnten ( 10 ). Ob solche ( 10 ) Ich darf dazu insbesondere auf Quellen und Literatur zur Frage verwei sen, die in meinem Aufsatze : Wandlungen im römischen Zivilprozessrecht in der Festschrift für Gustav Hanausek, Abhandlungen zur antiken Rechtsgeschichte (1925 ), 1 -22 genannt sind. Die Frage ist aber auch seither wiederholt aufgeworfen und verschieden beantwortet worden . Vgl. die Litaratur bei WENGER , Röm . Zivilpr . 22 f. N . 10 u . 13 ; 50 f. N . 72. Meiner Auffassung stimmt ausdrücklich zu ROBERT NEUNER, Krit. Viertelj. LVIII (XXII), 91. Gegen meine Auffassung vom zweige teilten Prozess als demokratischer Neuerung wendet sich KoscHAKER , Sav. Z . XLVII, 509 f. unter anderem auch mit der Erwägung, dass ja die Einführung der römischen Republik gar keine demokratische Tendenz habe. Das ist richtig , wenn man das Wort im heutigen staatsrechtlichen Sinne versteht. Aber « Demo kratie » ist ja auch ein relativer Begriff. Auch wenn Privatrichter nur der führenden Oberschicht entnommen wurden , so bedeutete das eine Entthronung königlicher eigener Rechtssprechung ! Soferne BESELER « archaische » Zeiten im Auge hat, vgl. seine Bemerkungen Sav. Z . L , 442 f. Ich will auch nicht bestreiten , dass demo kratische griechische Einflüsse viel später einmal einsetzten, damals als die Schwur gerichtshöfe in Strafsachen eingerichtet wurden . (KOSCHAKER, a . a. 0 . 510 ), aber sollen solche Einflüsse nicht öfter konstatierbar sein ? Und ist anderseits der Zi vilprozess wirklich politisch so neutral? F . VON WOESS hat in seiner nachgelas senen Abhandlung , Die prätorischen Stipulationen und der römische Rechtsschutz , Zeitschr. d . Sav.- St. f. Rechtsg . 53 (1933) 372 ff. wiederholt die Vertragsnatur des ordentlichen Prozesses betont und rechtsvergleichend gestützt (vgl. 390 f., 398 ff.). Aus seinen Ausführungen darf aber wohl auch gerade der Hinweis auf den Zwang hervorgehoben sein . Mag sein , dass die Vorstellung von der Selbstunter werfung des Verpflichteten , weiterhin vom Vertragsgedanken, weit hin wirkt-aber genügt da nicht die Gegenfrage : « Wie wenn der Verpflichtete sagt: ich danke ? » . Was ist denn entscheidender: die Vertragsidee oder die Zwangsidee im Pro zessrecht ? Kann jene ohne diese , wie diese sicher ohne jene bestehen ? 208 Leopold Wenger Schiedsgerichte damals sehr häufig waren , ist freilich eine Frage. Darf da nicht aus der Volkspsychologie von heute, etwa namentlich bäuerlicher und kleinbürgerlicher Kreise, die wir am ehesten jenen frührömischen Verhältnissen vergleichend zur Seite stellen dürfen , der unterstützende Schluss angeführt sein , wie selten heute in sol chen Kreisen , wo jeder an seinem Recht starrsinnig festhält, schieds richterliches Verfahren begegnet, wie wenig der eine geneigt sein wird , dem vom anderen Streitteil vorgeschlagenen Schiedsmanue sich zu unterwerfen, wie geradezu unverständlich es dem einfachen Manne scheinen würde, müsste er sich erst mit dem Gegner einen Schiedsmann suchen und gäbe es nicht ein Gericht, vor das er ihn zwingen könnte ? Ist solches Denken nicht primitiver ? Ist es erst anerzogen vom Autoritätsstaat ? Ist nicht vielmehr das zwangsweise demokratische Geschworenengericht mit dem angeblich reinen Schiedsgerichtscharakter, der aber doch ohne die Autorität des Prä tors nicht wirksam werden kann, eine Vorstellung, die erst dem ein fachen Manne anerzogen werden musste ? Die juristisch gewiss bewun dernswerte Gestaltung des iudicium privatum scheint mir, je mehr ich sie unbefangen betrachte, als ein durchaus nicht so begehrenswertes, auch nicht so praktisches Gebilde. Auch daran mag man zweifeln , ob wirklich allein das vereinbarte Schiedsgericht römischem Wesen entspräche, wie es vom Judex des ordo iudiciorum bei Cicero pro Cluent. 40, 120 heisst : Neminem voluerunt maiores nostri non modo de existimatione cuiusquam , sed ne pecuniaria quidem de re minima esse iudicem nisi qui inter adversarios convenisset. Ich möchte hier ausdrücklich und um kein Missverständnis aufkommen zu lassen hervorheben, dass mit diesen Zweifeln an einem so allgemein übli chen archaischen Schiedsgericht nicht auch die Vorstellung von der Güteidee im römischen Prozessrecht abgelehnt sein soll, wie sie D üll(11) unter Beifall von Schönbauer ( 12) dargetan hat. Denn hier ist es ja der König , dann der Jurisdiktionsmagistrat, also ein gegebenes staatliches Gerichtsorgan , vor dem in iure der Streit, wenn möglich, rasch gütlich abgetan werden soll. Ein solches Güteverfahren vor einem autoritären Richterkönig ist aber etwas ganz anderes als die Notwendigkeit einer Vereinbarung, vor einem (11) Rudolf Düll, Der Gütegedanke im römischen Zivilprozessrecht (1931), bes. 46 f., 124 ff. (12 ) Zeitschr. d . Sav.- St. f. Rechtsy . 52 (1932) 253 ff. Einige Bemerkungen zur historischen Behandlung etc. 209 zum Geschworenenamt geeigneten Mitbürger die Sache auszutragen ! Darum ist gegen Ciceros Bemerkung, pro Caecina 1, 1 , auf die Düll (13) und Schönbauer ( 14) sich mit besonderem Nachdruck beziehen, wiederum keine Unwahrscheinlichkeitsvermutung auszu sprechen : gewiss wird kein überlegter Mann, der in iure seinen Streit geschlichtet sehen könnte, diesen apud iudicem prozessual erledigt wissen wollen. Aber spricht dies anderseits sehr für Be liebtheit des Volks-und Schiedsrichters ? Indess sind dies nicht alte Dinge, die mit Justinians Prozess recht nichts mehr zu tun haben ? Nicht doch ! Ich meine, dass das jurisdiktionell -imperiale römische Beamtengericht uralt und dem römischen Imperium , jenem allbeherrschenden Grundprinzip des römischen Staatsrechtes (15 ) allzeit eigen sei. Wir kennen die – ich sagte es schon gewesen und geblieben . – juristisch bewun deruswerte Konstruktion des iudicium privatum , des von den Par teien vereinbarten Schiedsgerichtes. Aber wir haben auch schon wiederholt auf die autoritäre Stellung des die private Formel vereinbarung genehmigenden und autorisierenden Prätors verwie sen (16 ), und kommen gerade auf diese Tatsache voch zurück . Hierin aber liegt m . E . eben das Einheitlichkeitscharakteristikon der Linienführung . Das iudicium imperio continens ist von vornherein staatsrechtlich ganz imperial gestaltet. Und die cognitio extraordi - naria ist das typische Beamtengericht. In der von den demokra tischen Einwirkungen auf das hauptstädtische Recht freien provin zialen Luft ist das Beamtenrichtertum so gut wie Selbstverständ lichkeit. Wohl fehlt auch hier nicht die Möglichkeit, die Unter suchung, ja mit formelhaften Anweisungen auch die Entscheidung einem anderen anzuvertrauen . Aber dieser « andere » empfängt nicht bloss seine Weisungen sondern auch seine Bestellung vom staatlichen Richter, ist Staatsorgan. Brauchbare Förmlichkeiten mögen den provinziellen Prozess dem offiziellen Verfahren des ( 13 ) S . 127 , 131, 144. (14 ) S . 254. (15 ) Näher ausgeführt in meiner Abhandlung « Hausgewalt und Staatsgewalt im römischen Altertum » in Miscellanea Francesco Ehrle (1924 ) II, 40 ff. ( 16 ) Zuletzt näher erörtert in meiner Akademieschrift « Prätor und Formel», Sitz. Ber. Bayer. Akad. Wiss. 1926 , 3. Abh. 210 Leopold Wenger hauptstädtischen iudicium legitimum anpassen (17 ), aber das ist nur Gewand, der Kern ist ein anderer. Dort Lex, hier Imperium ! Und wie jederzeit das Land, die Provinz, stärker ist als die Stadt, die es zu sein glaubt, und wie von der Provinz aus Rom monarchisch geworden ist, so ist auch das iudicium legitimum , ist seine litis contestatio, ist der Volksrichter verschwunden : geblieben aber ist die iurisdictio als wesentlicher Bestandteil des Imperiums. Und so ist, mag manchen manches anders scheinen , doch alles Wesentliche in der Gerichtsverfassung altrömisch , altrömisch in dem Sinne, dass das Gericht eine königlich imperiale staatliche Funktion ist. Ueber die Republik hinweg hat sich diese Idee gehalten . Es brauchte nur der Augustus zu kommen , um als sichtbarer Träger die kaiserliche Gerichtsbarkeit zu beanspruchen. Die Abfolge der Rechtsentwicklung ist von da ab eigentlich selbstverständlich. Wir könnten sie ohne Quellenbelege erraten und unser Bild würde von der Wirklichkeit kaum in Kleinigkeiten verschieden sein . Die römischen Stadtprätoren und die anderen Gerichtsmagistrate, die noch Formeln autorisieren und geben, sind nicht auch sie Beamte, zwar mit republikanischen Namen , aber doch politisch von Kaisers Gnaden ? Und wo ist in der Provinz, nicht bloss natürlich in der kaiserlichen , sondern wie neuerdings die Augustus - Inschrift von Kyrene (18) gezeigt hat, auch in der Senatsprovinz der Richter höherer oder niederer Instanz , der nicht unmittelbar juristisch oder doch mittelbar politisch vom Kaiser abhienge ? « Eadem magistratuum vocabula » sagt in seiner unvergleichlichen Art Tacitus (Ann . 1, 2). Geradlinig läuft von da auch äusserlich sichtbar die Entwicklung fort bis Justinian. Es erübrigt sich , von der Schar seiner Gerichtsbeamten , von ihren Dignitates, von der bunten Mannigfaltigkeit der Gerichte hier mehr zu sagen . Alles ordnet sich der kaiserlichen Majestät in bestimmter Rang - u . Reihenfolge unter. Sein Gericht ist das höchste und strebt nach Gerechtigkeit, nach dem ius suum cuique tribuere. Freilich nicht alle Untergerichte sind so und nicht leicht ist es dem kleinen Manne, an des Kaisers Ohr seine klagende Stimme dringen zu lassen und im Appellations - oder Supplikationsverfahren oder im ( 17 ) Ich brauche nur an WLASSAKS Abh. « Zum römischen Provinzialprozess » , Sitz. Ber . Akad. Wien 190 , 4, Abh. ( 1919) zu erinnern. (18) Vgl. STROUX -WENGER, Die Augustus-Inschrift auf dem Marktplatz in Kyrene, Abh. Bay. Akad . d . Wiss. XXXIV , 2 (1928) 61 ff. Einige Bemerkungen zur historischen Behandlung etc. 211 Reskriptsprozess Gehör zu finden. Auch das Römerreich war gross und der Kaiser weit. Die Papyri bringen illustrative Bilder aus Justinians Zeit in der Geschichte des Dichters und Juristen Dios koros (19). Die justinianische Gerichtsverfassung ist die der abso luten Monarchie, die des alten königlichen Imperiums und der damit gegebenen königlichen Jurisdiktion in ihrer Ausdehnung über das Weltreich, das Imperium Romanum im räumlichen Sinne. Ich glaube nicht fehl zu gehen , wenn ich bildlich von einer ungebro chenen, wenn auch nicht durchwegs geraden Linie spreche, in der sich die römische iurisdictio bewegt, von den ersten Anfängen, die wir zu erschliessen wagen, bis zur Aufzählung aller Gerichte, vor denen irgend ein Rechtsstreit zur Austragung kommt, in der kai serlichen Konstitution vom Jahre 530 Cod. Just. 3 , 1 , 14, 1 : san cimus omnes iudices sive maiores sive minores , sive qui in admini strutionibus positi sunt vel in hac regia civitate vel in orbe terrarum , qui nostris gubernaculis regitur, sive eos, quibus nos audientiam com mittimus vel qui a maioribus iudicibus dantur vel qui ec iurisdic tione sua iudicandi habent facultatem vel qui ex recepto (id est com promisso, quod iudicium imitutur ) causas dirimendus suscipiunt vel qui arbitrium peragunt vel ex auctoritate sentientarum et partium consensu electi, et omnes generaliter omnino iudices Romani iuris disceptatores etc. Sehen wir einmal von der noch begegnenden kompromissarischen Rechtssprechung, die Justinian ja auch der staatlichen angenähert hat, dann von der kirchlichen Rechtssprechung ab , so ist alle Rechtssprechung staatlich . Wenn ich nun aber von der geraden Linie der Entwicklung sprach , die in Justinians Prozessrecht ihren gegebenen Endpunkt findet, ist diese Linie nicht eben doch unterbrochen durch die Ein richtung des Spruchrichtertums oder, um die bequemere und ge läufigere, wenn gleich ungenauere Bezeichnung zu wählen , des Ge schworeneninstitutes ? Zunächst träfe ein solcher Einwand ja doch nur das iudicium legitimum der Stadt Rom . Denn von den Ge schworeneneinrichtungen in Sizilien , Kilikien und Kyrene wissen wir gerade in dem entscheidenden Punkte der Einwirkungsmöglich keit des Statthalters zu wenig, als dass wir neben dem römischen (19) Vgl. darüber meinen Vortrag in Mailand : Conferenze pel XIV Centenario delle Pandette ( Pubbl. Univ . Cattol. 1931), 215 - 233. 212 Leopold Wenger Prozess auch diese provinziellen Fälle hier näher heranzuziehen brauchten (20). Dass wir aber auch für die zeit -und ortsgebundenen römischen iudicia privata die Linie der magistratischen Rechtspflege festhalten dürfen , dazu ist nur eine Verständigung darüber nötig , ob wir das Verfahren apud iudicem oder das in iure für das wesent lichere halten. Und darüber dürfte unter den Prozessualisten kein Streit sein . Ueber die Bedeutung des prätorischen Ermessens beim dare und denegare actionem ist in letzter Zeig genug gesagt worden . Ich darf darum nur aus schon älter gewordener Literatur Wlassaks Artikel « Cognitio » in Pauly -Wissowas Realenzyklopädie zitie ren . Seine neuerliche Lektüre hat mich in der Auffassung von der durchgreifenden Kraft der Rechtspflege durch den Prätor um so mehr bestärkt, als der Klassiker des klassischen Prozessrechts ein gewiss unvoreingenommener Beurteiler der cognitio der Beamten ist. Das Untersuchen führt naturgemäss zum Erkennen, dem eigentli chen cognoscere, sei es in der in integrum restitutio , sei es in Vor mundschaftssachen , bei Kautionen, in den Missionsbescheiden bei der bonorum possessio , sei es endlich – was uns am meisten hier berührt – im Vorverfahren des ordentlichen Prozesses. Wenn wir nun in die proponierte einheitliche Entwickelungs linie einer vom Imperium getragenen und von ihm hergeleiteten Jurisdiktion nur die Cognitio in iure einschalten, dann freilich ist der Einheitsbeweis geschlossen. Aber wer auf die Litis konte station der Parteien, ihren Prozessbegründungsvertrag, allesGe wicht legt, wer betont, dass ja die Parteien es sind, die den Judex bestellen , dass apud iudicem die Dispositionsmaxime herrscht, dass das Urteil zu sprechen nur dem Volksrichter und nicht dem Prätor oder einem seiner Hilfsbeamten zusteht – wer all dies in erster Linie betont und nicht die stets überragende Stellung des Gerichts herrn , – der wird gegen die Annahme der Einheitslinie lebhaft protestieren . Und es ist ihm jedenfalls zuzugeben , dass in all den genannten Punkten das iudicium privatum nicht in die Einheitslinie passt, dass dieses obligate Parteienschiedsgericht gegenüber allem beamteten Gericht eine Ausnahme macht. Aber überschätzen wir nicht -- ich meine natürlich nicht in der (ich wiederhole nochmals ) grandiosen Konzeption , wohl aber – in der praktischen Bedeutung gerade das hauptstädtische Gericht ? Geht (20 ) STROUX -WENGER , a . a . 0 . 74 ff., 94 ff. Einige Bemerkungen zur historischen Behandlung etc . 213 nicht, um beim Bilde zu bleiben , die gerade Entwickelungslinie um die Urbs herum ? Hat doch das, was man landläufig « Republik Rom » zu nennen beliebt, nur in Rom selbst, in der Stadt, etwas mit dem zu tun , was mit dem republikanischen Staatsbegriff die Theorie der griechischen und neuzeitlichen Demokraten verbunden hat. Vielleicht erscheint in einer politischen Atmosphäre, in der das staatliche Beamtengericht das gegebene zu sein scheint, die juri stische Konzeption des notwendigen Spruchrichtertums zur Entschei dung stadtrömischer Prozesse als eine noch grossartigere Konzession an die Hauptstadt, die einst die Könige verjagt hatte ! Ich kann nicht los von dem schon berührten grossen , auch geistesgeschicht lichen Gegensatz zwischen der Urbs und dem ihr untertanen Im perium Romanum , dem römischen Weltreich, und von der Vor stellung einer Konzession an die Libertas in dem auch in der Urbs massgebend und herrschend gebliebenen Imperium . Die Libertas ist dann gestorben , das Imperium ist aber in seinem Wesen unverän dert geblieben. Hochinteressant nicht bloss für die Geschichte des römischen Zivilprozessrechts ist dieses Verhältnis von Libertas und Imperium (21). Es ist der Gegensatz zwischen der Bürgerfreiheit , die nur dem Gesetze der Bürger, der Lex , der Bindung des civis an das von der Gesamtheit, der cives Beschlossene und von ihr dem Einzelnen Auferlegte untertan ist, und dem Imperium , das ein Machthaber handhabt, dem der Untertane einfach blindlings zu folgen hat, und das, soweit die Lex nicht reicht, den Bürger auch wie jeden Nichtbürger an den Befehl bindet. Autorität und Freiheit, der oft bezogene, aber nicht notwendige Gegensatz beider Begriffe, ist im iudicium privatum ausgeglichen . Aber freilich , wie es in der Geschichte bisher überall sich gezeigt hat, in dem Sinne nur ist die Synthese möglich , dass « im Zweifel » die Autorität das stär kere Element sein muss, soll der Staat leben . So ist das iudicium pricatum geradezu ein Idealbild dieser Synthese . Rein autoritär ist die Gerichtsordnung ausserhalb des iudicium privatum . Rein frei von staatlichem Einfluss ist das private Schieds gericht: aber der Staat gewährt auch von sich aus hier keinen Rechtsschutz. Und wenn Justinian dann angleichende Bestimmungen (21) Ich habe in anderem Zusammenhange diesen Gedanken schon in den Studi in onore di Bonfante II (1929) 474 angedeutet. 214 Leopold Wenger zum staatlichen Prozesse gemacht hat, so bedeutet das insoweit eine Herübernahme auch dieser Gerichte in die autoritärstaatliche Gruppe. Zu byzantinischen Schiedsverträgen haben die Papyri man cherlei lebendig wirkende Beispiele beigebracht (22), sie können der Vermeidung, aber auch der Erledigung von unentwirrbar langen Prozessen dienen und bedeuten parteiliche Vereinbarungen , die sich von gerichtlichem Austrag der Sache nicht viel versprechen. Es soll, wenn hier allgemein von schiedsrichterlicher Erledigung strei tiger Dinge die Rede ist , ein juristisch scharf erfassbarer Unterschied zwischen dem Kompromissverfahren und dem Dialysisverfahren nicht unerwähnt beiben . Während der arbiter immerhin einen End spruch fällt, dem die Streitteile sich zu unterwerfen durchs Kom promiss verpflichtet sind, machen die Schiedsleute beim Dialysis verfahren nur einen Vorschlag, dessen Annahme durch die Par teien eben dann die freiwillig eingegangene Dialysis ist. Das hat für die byzantinischen Dialyseis kürzlich Artur Steinwenter in der Gedenkgabe (23 ) an einen jungen italienischen Gelehrten dargetan, den nicht mehr in unserer Mitte zu wissen alle diejenigen schmerzt, welchen dass Recht des Corpus Iuris am Herzen liegt. Steinwenters Studie legt uns in aller formellen Selbstabgren zung freilich auch die Wertschätzung dar, die neben und ausser dem staatlichen Prozess auch die ohne staatliches Urteil erfolgende Streitbeendigung im byzantinischen Rechtsleben gefunden hat. Weder das Corpus Juris, das die transactio anerkennt, noch die stets un sichere Papyrusstatistik lassen aber ersehen , wie es etwa mit dem statistischen Verhältinis zwischen den Rechtssachen steht, die durch Prozess, und den anderen , die schiedlich - friedlich erledigt worden sind. In solche Statistik, wenn sie versucht werden könnte, wäre na türlich auch die Erwägung einzubeziehen, inwieweit das Christen tum , sei es Prozesse in christlich - friedlichem Vertragen ausge schaltet, oder aber im Bischofsgericht erledigt haben mochte . Doch dies nur eine Nebenbemerkung, mehr soziologisch - politischer als (22) Ich nenne aus den Münchner byzantinischen Papyri etwa Mon . 1, 19 f., wo es sich aber eben nicht notwendig um Anrufung eines staatlichen Militärge richts, wie ich p . 32 annahm , sondern eher mit PARTSCH , Gött. Gel. Anz. 1915 , 431, um ein Schiedsgericht handeln wird . (23) Das byzantinische Dialysis- Formular, in Studi in memoria di Aldo Al bertoni I (1932), 73 ff. - Vgl. Ennslin , Ein Prozessvergleich unter Klerikern vom Jahre 481, Rhein . Mus. f. Philologie N . F . LXXV, 442 ff. Einige Bemerkungen zur historischen Behandlung etc. 215 juristischer Art, die das Ergebnis von der reinen Staatlichkeit aller Gerichte im Corpus Juris nicht berührt. Es lag mir am Herzen , gerade diese eine Grundfrage des Pro zessrechts der Römer, das Verhältnis von Geschworenen -und Beam tengericht eingehender zu behandeln , als sich dies im Rahmen des erlaubten Ganzen vielleicht rechtfertigen lässt. Aber mir schien eben in dieser Frage die Aufzeigung einer schier geradlinigen Entwickelung nicht wertlos für die Gesamteinordnung des justinianischen Endergebnisses in das römische Pro zessrecht und für seine geschichtliche Beurteilung . Wenn ich nunmehr für das sogenannte Gerichtsverfahren nur mehr schlagwortartige Andeutungen bringen kann, so mag dies nicht nur mit dem Vortragszeitmangel, sondern auch mit einer allgemeinen Beobachtung einigermassen gerechtfertigt werden können . Denn bei den Fragen des Gerichtsverfahrens lässt sich die einheitliche Linienführung in der Entwickelung nicht überall aufzeigen. Immerhin möchte es gerade auch hier einmal interessant sein, Parteientätigkeit und Beamten herrlichkeit einander gegenüberzustellen und gegeneinander abzuwägen. Wir denken da zunächst an die anscheinend grundsätzlich verschieden gestaltete Prozesseinleitung , durch die archaisch einfache lega lisierte Selbsthilfe der in ius vocatio in den Zwölftafeln auf der einen, und durch die bürokratisch komplizierte Ladung im spätkai serlichen und justinianischen Libellprozess, wie ihn uns Paul Collinet (24 ) soeben wieder in grosszügiger Darstellung vor Augen geführt hat, auf der anderen Seite. Und doch konnte Justinian nicht bloss den leeren Namen der in ius vocatio in seinem Gesetzbuche verwenden, sondern auch Rechtssätze gebrauchen, die die Juristen in Fortbildung des alten Rechtes ersonnen hatten . Freilich ist hier die einheitlich bestimmende Linie der amtlichen Vorherrschaft nicht gegeben . Aber auch hier lässt sich der vom römischen Zivilprozess geschichtlich wenigstens nicht wegzudenkende, wenn auch erst ausserhalb des iudicium privatum eindeutig in Erscheinung tretende magistratische Einfluss nicht verkennen . Weit ist allerdings der Weg , der von der in ius vocatio der Zwölftafeln zur in ius vocatio der Digesten Justinians führt. Aber wollte man einmal nur von der ( 24 ) La Procédure par Libelle , 1932. 216 Leopold Wenger Idee der Zusammengehörigkeit her die Dinge betrachten, vielleicht würde manche Einzelheit noch in anderes Licht rücken ! Immer wieder erscheint es mir so z . B . überlegbar, ob meine (25 ) vor Jahrzehnten in der ersten Entdeckerfreude papyrologischer Rechts einrichtungen erwogenen Parallelen zum Vindex nicht doch jene erste Konstruktion dieser Rechtsfigur rechtfertigen , wie sie Lenel einmal versucht, dann aber aufgegeben hat ( 26 ). Indess ich kann nicht bei einer solchen Einzelheit verweilen. Auch nur andeutungs weise berührt kann die Frage der confessio werden . Seit uns Moriz Wlassak über die Rolle so eindringlich belehrt hat, die « der Ge richtsmagistrat im gesetzlichen Spruchverfahren » spielte (27), wissen wir diesen Jurisdiktionsherrn auch fürs Legisaktionenverfahren dort höher einzuschätzen , wo der Geständnisspruch der Parteien sonst wohl als das allein Entscheidende betrachtet werden mochte. Und wenn wir alle Zweifeld des klassischen Geständnisrechtes auch nicht entfernt aufrollen können , so muss doch auf die fürs Recht des Corpus Juris nicht unbestrittene Frage hingewiesen sein , ob es nach dem Anspruchsgeständnis noch eines Anerkenntnisurteiles be dürfe oder nicht (28 ). Aus einer prinzipiellen Prävalenz des richter lichen vor dem Parteienakt möchte man von vornherein sich im Sinne des Anerkenntnisurteiles entscheiden . Und der berühmte Satz des Paulus ad edictum : Confessus pro iudicato est, qui quodammodo sua sententia damnatur, den Justinian in die Digesten übernommen hat (Dig . 42, 2 , 2) muss nicht notwendig im Sinne des Fehlens des formalen Urteils gedeutet werden . Dass das alte iusiurandum in iure delatum in seiner so eigenartig erweiterten und dabei umge stalteten Form , wie es uns im Corpus Juris begegnet, nur Beweis grund ist und von einem Urteil unbedingt gefolgt sein muss, zeigt an diesem anderen Streitbeendigungsfalle die Notwendigkeit gericht lich -amtlicher Tätigkeit, wo im iudicium privatum blosser Partei enakt das Urteil überflüssig gemacht hatte. Wir stehen mit diesem Eid also bereits im Beweisrecht. Auch dazu einige Worte . Mit einer hier ob des Mangels von Quellen für das ältest erkennbare ( 25 ) Rechtshistorische Papyrusstudien (1902) 1 ff. ( 26 ) Edictum perpetuum , 3. Aufl., 67 f. (27 ) Zeitschr. d . Sav.-St. f. Rechtsg . 25 (1904 ) 81 ff.; 28 (1907) 1 ff.; WEN GER, Instit. d . röm . Zivilprozessrechts 106 f. (28) Zur zwiespältigen Literatur vgl. WENGER, a . a . 0 . 274 n . 7 . Einige Bemerkungen zur historischen Behandlung etc. 217 römische Recht besonders gebotenen Zurückhaltung dürfen wir wohl auch für die römische Prozessgeschichte mit anfänglich formaler Beweiswürdigung rechnen. Freilich wird man, wo der König in eigener Person Recht sprach , sich auch Fälle denken können , wo seine königliche Weisheit machtvoll sich über Ergebnisse solcher Regeln hinwegsetzen konnte. Aber solche Souveränität gilt ja für jede Kabinettsjustiz . Unter den Beweisgründen spielen Eid und Zeugnis die entscheidende Rolle . Das uns bekannte Beweisrecht entstammt der klassischen Zeit. Hier gilt die freie Würdigung jedes Beweisgrundes durch den hierin freien Volksrichter. Aber seine Bindung liegt im iudicium privatum in der Macht der Parteien. Beweisgründe können nicht inquisitorisch zur Klärung des Falles herangebracht werden . Und es wird auch diejenige Meinung Recht haben , welche dem Iudex die Befugnis abspricht, den Parteien ein beweisermessend zu würdigendes iusiurandum iudiciale im Ver fahren apud iudicem aufzuerlegen . Auch soweit der Iudex ein sei es unbegrenztes sei es mit Festsetzung einer bestimmten Höchst grenze fixiertes iusiurandum in litem auftrug, dürfte er an die innerhalb der Grenze gehaltene eidliche Versicherung der Ersatz summe wohl gebunden gewesen sein . All das ändert sich im kai serlichen Prozess . Anstelle der Disposttionsmaxime, die den Parteien die Prozessherrschaft zuerkennt, tritt die Inquisitions maxime der richterlichen Beweisaufnahme. Der Richter legt, wenn er will, der Partei den Eid auf und beurteilt das Ergebnis frei. Der Richter kann jedenfalls den in litem geschworenen Eid nach seinem Ermessen verwerten . Freilich kommt jetzt, da der richter liche Beamte sich ganz selbstherrlich über den Parteienbetrieb erhoben hat, wieder eine andere Hemmung seiner gehobenen Stel lung in der Aufstellung der Beweisregeln , die ihm die Bewertung des Zeugnisses, die Höherschätzung der Urkunde vor der Zeugenaus sage (29), der Schrift vor dem Worte vorschreiben . Aber das ist, von höherem Standpunkt aus besehen, ja doch wieder nur eine neue Steigerung des Richterkönigtums, wobei wir nur nicht vergessen dürfen , dass es nur einen Richterkönig mehr gibt, eben den Kaiser. Ist nun also , um nochmals die Kernfrage unserer Betrachtung zu stellen , der Gegensatz zwischen dem parteilichen iudicium pri (29) RICCOBONO, Zeitschr. d . Sav.- St. f. Rechtsg. 34 (1913 ) 236 -246 ; KASER in PaulY-WISSOWA, Realenzykl. Art. Testimonium II C. a. Einfluss des Ostens: RICCOBONO 244 . Roma · II 15 218 Leopold Wenger vatum und der amtlichen extraordinaria cognitio so gross, dass wir von einer einheitlichen Linie nicht mehr sprechen dürfen ? Ist das hervorgehobene Eigentümliche der klassischen Prozessge staltung entscheidend für unsere Beurteilung des Ganzen oder sind doch die Zusammenhänge so gross , dass die Linie auch hier unge brochen genannt werden darf? Ist, wie immer man die Anfänge des römischen Prozesses beurteilen mag, auch wenn man , wie wir es tun , an den Anfang nicht das Parteienschiedsgericht, sondern das königliche Hoheitsgericht setzen, durch das iudicium privatum die Linie unterbrochen, die von da zum kaiserlichen Hoheitsgericht führen könnte ? Noch einmal müssen wir fragen, worauf wir das Hauptgewicht des ordentlichen Prozesses legen , auf das ius oder auf das iudicium ? Ersteres ist ohne letzteres sinnvoll und möglich . Letzteres ohne ersteres nicht. In iure aber tritt auch im klassischen Prozess die Stellung des Beamten entscheidend hervor. Hier ist der Platz für seine cognitio. Und ich darf dazu noch einmal Wlassaks Artikel zitieren (30). Das ediktale Versprechen eines Iudiziums causa cognita soll nicht etwa die causae, cognitio dort ausschliessen , wo sie nicht ausdrücklich erwähnt ist. « Ein wesentliches Stück der Cognitio ist dass Einforden von Beweisen und deren Würdigung » . So dürfen wir doch auch für dass Hauptstück jedes Gerichtsver fahrens, für das Beweisrecht von einer geschlossenen Linie sprechen . Und wiederum scheint nur gerade das Verfahren apud iudicem pri vatum aus dieser sonst so einheitlichen Gestaltung heraus zu fallen . Ich darf wiederholen . Das stadtrömische iudicium privatum — rollen wir die Frage seiner Herkunft lieber nicht nochmals auf – ist in der klassischen römischen Prozessrechtstheorie und in deren Praxis, soweit unsere Ueberlieferung des rein römischen Prozess rechts eben reicht, das Rechtsinstitut des Prozessrechtes gewesen . Ein mächtiges formaljuristisches Bauwerk ist da aufgerichtet. In lo gischer Konsequenz, fast möchte man sagen , in reiner Rechtslehre bauen hier die hauptstädtischen Juristen. Alles materielle Recht tritt zurück gegen über dem Rechtsformalismus oder richtiger gesagt : alles materielle Recht ist nur durchführbar, soweit sich eine Formel für es findet. Es gibt kein allgemein an wendbares Rechtsmittel im Dienste des materiellen Rechts , es gibt (30 ) PAULY-WISSOWA, Realenz., bes. S. 206 -208 und 212-215. Spezielle Zitate aus S . 208 und 213. Einige Bemerkungen zur historischen Behandlung etc. 219 keine Klage schlechthin . Es gibt nur actiones. Schönbauer hat mich in einem Briefwachsel kürzlich auf den Gegensatz zum byzan tinisch - justinianischen Recht hingewiesen , wo die Juristen,wie wir das gewöhnt sind, schon den Vorrang des Privatrechts anerkennen , wo sie nicht mehr in erster Linie prozessualisch sondern materiell rechtlich denken . Aber selbst dieser Gegensatz schlägt, so scheint es mir , nicht prinzipiell durch . Denn er wird durch die Kunst der klassischen Jurisprudenz gemildert, die eben zu jedem akzeptablen praktischen Bedürfnis die Form , die Formel, die actio gefunden hat. An diesen Normen aber bildet sich noch heute das juristische Denken . Wohlist das Beamtengericht auf anderem Boden gross geworden , als das iudicium privatum , wohl führt nur das Beamtengericht und sein Prozess in ganz geradliniger Entwickelung zum justinianischen Prozessrecht, aber die Kombination beamtlicher Gerichtshoheit mit dem privaten Schiedsgericht hat die ganze Grösse des römischen Prozessrechts geschaffen . In dieser Konbination begegnet es uns aber im justinianischen Prozessrecht : in einer grandiosen Fusione, um mit einem der grossen Rechtslehrer des Rom sprechen . von heute zu CARLO ARNO PROFESSORE ORDINARIO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO NELLA R . UNIVERSITÀ DI TORINO ACTIO IN FACTUM ACCOMMODATA LEGI AQUILIAE SUMMARIUM Quintus Mucius eiusque scholae auctores, si damnum iniuria non corpore sed corpori illatum esset, dicebant actiones in factum desiderari ; diversae scholae auctores adfirmabant in hoc casu utiles actiones dandas. Una teoria generale di Mucio sulle actiones in factum deducesi in modo sicurissimo da quel frammento di Pomponio, 39 ad Quintum Mucium , D . 19 -5 - 11, ove è detto : “ quia actionum non plenus nu merus esset, ideo plerumque actiones in factum desiderantur , . Di questa sua teoria generale Mucio fece particolare applicazione in tema di lex Aquilia. In una determinata fattispecie Mucio , nel giu dicare l' atto lesivo del diritto altrui, poneva innanzi la distinzione tra chi quell'atto ha compiuto misericordia ductus e chi l'ha com piuto non misericordia ductus. Per il caso di chi ha sciolto lo schiavo altrui, ut fugeret, se questo fece misericordia ductus, Mucio accorda l' actio in factum accommodata legi Aquiliae. Con quest'actio in fac tum Mucio era pervenuto ad estendere l' actio legis Aquiliae a le sioni non compiute corpori, onde con Mucio venne ad esservi la dicotomia di actio directa, che solo poteva sperimentarsi nel caso di damnum iniuria datum corpore, e di actio in factum , che poteva sperimentarsi nel caso di danni arrecati non corpore. E a questa actio in factum si ricorre senza fare distinzione veruna tra il danno che affetta la cosa , e il danno che, senza lesione dell' integrità della cosa, solo reca pregiudizio ad altri. Cotesta, che fu la tesi di Mucio , costitui poi sempre la tesi di tutti i suoi seguaci, è in ispecie di Labeone, di Proculo, di Nerazio , di Celso , di Marcello e di Ulpiano . Incontriamo sempre in tutti questi giuristi lo stesso pensiero che guidava Mucio : Mucio , D . 4 - 3 -7 -7 : si non misericordia ductus fecisti, furti te neris : si misericordia in factum actionem dari debere. Labeone, D . 47 - 2 -50 - 4 : si quidem dolo malo fecit, furti actio est: sed et si non furti causa hoc fecit... in factum dandam actio nem . 224 Carlo Arno Ulpiano, D . 47 - 2 -52 -20 : furti ita demum teneri, si furandi animo id fecisti, si minus in factum agendum . II Di quest'actio in factum legi Aquiliae accommodata i serviani, e in ispecie Servio, Alfeno, Ofilio, Sabino, Cassio , Giuliano, Gaio e Paolo , nulla seppero o non vollero saperne ; tutta la loro tratta zione si svolge come se essa non esistesse affatto. Ad essi non venne in mente mai che vi potesse essere una tutela giuridica ad exemplum legis Aquiliae per il danneggiato dell'atto altrui, qualora la cosa non fosse stata materialmente lesa. Nell' orbita della legge Aquilia , non eravi per essi al riguardo alcuna responsabilità , chè per essi non era escogitabile un qualsiasi vano lontano riferimento alle espressioni della legge, trattandosi di danno non recato corpori, trattandosi di danno non derivante dalla lesione materiale della cosa . Quando invece il danno era non dato corpore, ma corpori, essi si appigliavano all' actio utilis, onde la dicotomia serviana era di actio directu se il danno era cagionato corpore, e di actio utilis se il danno era non cagionato corpore ma corpori. Tutta la dottrina serviana sta racchiusa in quel che ci dice Gaio (III-219) che cioè, se il danno non è recato corpore ma corpori, utiles actiones dantur. Nella corrente muciana dicevasi : actiones in factum desiderantur ; in quella serviana per contro : utiles actiones dantur. E il contrasto immane torna sempre. Si tratti ad esempio di chi alienum hominem incluserit et fame necaverit, per il muciano Nerazio : datur in factum actio (Ulpiano, D . 9 - 2 - 9 -2 ), per il serviano Gaio : utilis actio dat er . Si tratti ad esempio di chi consuma cose altrui, il muciano Uliano (D . 19- 5 - 14 - 3 ) ci dirà: in factum erit agendumı; mentre il serviano Paolo ci dirà : utilis danda est actio . Si tratti ad esempio i chi pannum rubrum ostendit fugavitque pecus, per il muciano Labeone ( D . 47 - 2 -50 - 4 ) eravi l'actio in factum , per il serviano Gaio non era neppur concepibile al riguardo un ' appli cazione della legge Aquilia (III - 202), a meno fossero precipitate o perite le pecore, e allora eravi l'actio utilis. III I giustinianei fusero insieme le due dicotomie , la muciana e la serviana, e sorse così la tricotomia : actio directa , actio utilis, actio in factum . Actio directa si quis corpore suo damnum dederit ; e tale Actio in factum accommodata legi Aquiliae 225 era pure il pensiero e dei muciani e dei serviani. Actio utilis si non corpore damnum fuerit datum sed corpus laesum fuerit ; e tale era il pensiero dei serviani, ma non affatto il sistema dei muciani, per i quali aveva luogo l'actio in factum legi Aquiliae accommodata. Actio in factum si non corpore damnum fuerit datum neque corpus laesum fuerit ; e tale non fu affatto il pensiero dei serviani, i quali in tal caso negavano qualsiasi responsabilità con riferimento alla legge Aquilia , ma era pensiero dei muciani, se non che questi ac cordavano l' actio in factum non solo in questi casi, in cui i gill stinianei si appigliano all’actio in factum , ma 'pur nei casi, in cui e i serviani ei giustinianei ricorrono all'actio utilis. Taluno tibi nummos excussit vel oves tuas fugacit ovvero taluno panno rubro fugavit armentum . Che è a dirsi si quid eorum per lasciviam et non data opera, ut furtum admitteretur, factum est ? Come avrebbe posta la questione un serviano ? è da vedersi : an utilis actio dari debeat. Come avrebbe postà la questione un muciano ? da vedersi: an in factum actio dari debeat. Il ser viano alla questione posta risponde che non è da darsi l'actio uti lis, chè manca quell'essenziale elemento obbiettivo che è dato dalla lesione corpori, e che di conseguenza non vi è tutela giuridica con riferimento alla lex Aquilia (Gaio , III- 202). Il muciano alla que stione posta risponde che è da darsi l' actio in factum : idcirco La beo scribit in factum dandam actionem (Ulpiano, D . 47 - 2 -50- 4 ). Su questo punto i giustinianei sono con i muciani, onde per essi in factum actio dari debeat (Inst . IV - 1 - 11) e di conseguenza trasfor mano il testo serviano in testo muciano : Gaio (III - 202): sed si quid per lasciviam et non data opera, ut furtum committeretur factum sit, videbimus an 9 utilis actio dari de . beat. Inst. IV -1 -11: sed si quid eorum per lasciviam et non data opera , ut furtum admitteretur factum est, in factum actio dari debeat. Se limpida è la teoria dei giustinianei nelle Istituzioni, non convien credere che, in omaggio ad essa , i compilatori abbiano sempre modificati i testi; alcuni di questi sono stati in realtà al l'uopo alterati, ma altri – o per svista , o per difficoltà di ricostruire giuridicamente i casi e memente alla tricotomia, o forse anche perchè lazione del Digesto non ancora in tutta la sua la fretta , o per le disciplinarli confor durante la compi precisione era av venuta nella mente dei compilatori la completa ricostruzione della 226 Carlo Arnò - Actio in factum accommodata legi Aquiliae loro teoria – non furono mutati. Dei testi alterati rimarrà sempre bellissimo l'esempio del frammento D . 9 - 2 - 27 -9 intestato a Ul piano ; in esso è detto : puto utilem competere actionem . : . Quando io lessi sotto questo nuovo profilo la prima volta questo testo , provai la sensazione che vacillava tutto il mio pensiero, e , in quella in cui stavo distruggendo le carte su cui il mio pensiero avevo impresso, apersi la Collatio (XII - 7 - 7) ed ebbi la soddisfazione di leggervi che non era vero che Ulpiano dicesse : puto utilem com petere actionem . Permettetemi che io consideri l'esempio , offertoci dal confronto della Collatio con il testo del Digesto, quale trionfo di quel che in questa mia comunicazione ho affermato e che parmi stia , eloquente, come ulteriore conferma di quell' esistenza delle due grandi cor renti della giurisprudenza romana, quale fu da me sostenuta nel 1921 in Trieste all'XI Riunione della Società per il Progresso delle Scienze, e nel 1926 in Bologna all' inaugurazione solenne del XV Congresso della Società stessa . BENEDIKT FRESE ORD . PROFESSOR DER RECHTE AN DER UNIVERSITÄT RIGA DER OBRIGKEITLICHE UND DER PROZESSUALE ZWANG IM RÖMISCHEN RECHT SUMMARIUM In iure Romano coercitio magistratuum , in primis praetorum , differt ab iure cogente , quod iudiciis inest. Praetor iubet, coercet, cogit. Modi coercitionis aut « compulsionis » sunt: pignoris capio, multae dictio, missio in bona, denegatio actionis etc. Casus, quibus praetor cogit, varii sunt, exempli gratia : ad iudicium accipiendum (non semper !), ad rationes edendas, ad tutelam gerendam , ad here ditatem adeundam ex senatus consulto Pegasiano, ad fideicommissa praestanda, ad alimenta praestanda, in stipulationibus praetoriis. Etiam iudex iussu praetoris iubet et cogit, praesertim in iudiciis arbitrariis . Quid actionis verbo continetur? Definitio actionis, quam optimus iuris peritus Celsus dedit, verissima mihi videtur. Celsus ait: Nihil aliud est actio quam ius quod sibi debeatur, iudicio persequendi. Ergo actio significationem nominis habet . Quid condictionis verbo continetur ? Viri docti, qui condictionibus tractandis operam dabant, arbitrantur, condictionem speciem actionis esse. Puto, eosdem errore lapsos esse. Ipse in hac opinione sum : condictio non est actio, sed formula in ius concepta, quae habet intentionem dari oportere, condictio appellatur. Gaius libro tertio institutionum scribit : condici potest, si paret eum dare oportere. In glossario medii aevi sequentem condictionis significationem invenimus : " condicticia formula '. Stephanus scholiasta Byzantinus condictionem triticariam priscae formulae comparavit. Alia argumenta extant. Postquam formulae in desuetudinem abierunt, condictio in genus actionis translata est. Actio tenet ' et actione teneri ' non sunt in usu apud iuris consultos, sed tantum · formula tenet' et ' formula teneri '. Pro formula etiam iudicium dicitur. Ius cogens non actionibus, sed iudiciis inest. •Condictione teneri' sermo veteri iuri proprius est, quoniam condictio appellatio formulae erat. Postquam formulae in desuetudinem abierunt, iam ius anteiustinianum ser mone actione teneri ' uti coepit . Vetus significatio actionis extinguitur, quia nunc actio formulae substituitur. Ius cogens actionibus inest. Ius actionum , quo Iusti niani uti solent, aliud est quam id , quod iuris consulti noverunt. Genera actionum haec sunt: actiones in rem – in personam , actiones directae — utiles , actiones directae - contrariae, actiones stricti iuris -- bonae fidei, actiones arbitrariae, actiones in factum ; in communi usu sunt: in rem actio pro vindicatione, actio pro interdicto , actio fideicommissi pro fideicommissi petitione. In extra ordinem cognitione iudex competens a magistratu non differt et iure directo cogit. Finis . Ohne Zwang kann kein Recht bestehen. In besonderem Masse gilt dieser Satz auch vom hochentwickelten römischen Recht. Das Recht, und vor allem das Gesetz, befiehlt nach römischer Auf fassung mit schlechthin bindender Kraft. Es will zwingen durch 230 Benedikt Frese die Wucht seines Gebotes, wenn nötig und möglich auch durch andere Machtmittel ( 1). Ausgeübt wird der Zwang von der Obrigkeit und auf Grund obrigkeitlicher Ermächtigung auch vom Richter. Man unterscheidet demnach im römischen Recht einen unmittelbar - obrigkeit lichen Zwang, der vom Magistrat ausgeht, und einen prozes sualen Zwang, der vom Richter ausgeht. Was nun die äussere Seite des Zwanges anlangt, so erhebt sich die Frage : in welcher Weise wurde der Zwang ausgeübt ? Hierauf müssen wir sagen, dass ein direkter Zwang, der auf die Erfüllung eines Anspruchs ge richtet wäre, im klassischen Recht wohl kaum zur Anwendung ge kommen ist. Am ehesten könnte noch der unmittelbar-obrigkeitliche Zwang, der meist durch einen Befehl des Magistrats eingeleitet wurde, als Erfüllungszwang angesehen werden. Der unmittelbar obrigkeitliche Zwang kann entweder unabhängig von der Jurisdik tion oder in Verbindung mit der Jurisdiktion erfolgen . Der juris diktionelle Zwang, der in erster Linie vom Prätor ausgeht, und der prozessuale Zwang, der vom Richter ausgeht, enthalten in der Regel nur eine mittelbare Nötigung zur Vornahme der gebotenen Hand lung . Im Grunde genommen geht im römischen Recht jeglicher Zwang auf die Obrigkeit zurück , denn der prozessuale Zwang, der vom Richter ausgeht, gründet sich auf das iussum iudicandi des Prätors, dem dieser durch ein cogere Nachdruck verleiht. Der prozessuale Zwang ist also ein abgeleiteter, insofern als er einen Akt des Prätors voraussetzt. Das officium praetoris erzeugt erst das officium iudicis. Wie nun der Prätor gegenüber dem Richter durch Befehl und Zwang wirkt, so auch der Richter gegenüber den Par teien. Daher werden in beiden Fällen die gleichen Ausdrücke ge braucht, nämlich iubere und cogere. Prozessualer und richterlicher Zwang fallen im Formularprozess zusammen. (1 ) Siehe lege teneri bei Cic. Cluent. passim und Dig . passim ; lex tenet bei Val. Max. 5 , 3 ext. § 3 (lege itaque legem , quae te iure iurando obstrictam tenet); wae te lira ex caus,2,28 Iul. D . 1, 3, 32, 1 (. .. nam cum ipsae leges nulla alia ex causa nos teneant, quam quod iudicio populi receptae sunt) ; lege obligari : Paul. D . 9, 2, 28 pr.; Mod . D . lege.com 48, 10 , 30 pr. ; C . 8, 35 (36 ), 1 ; lege astringi bei Cic. Cluent. 57, 155 ; lege cogi bei Cic. Cluent. 60, 164 (ea lex qua coacti huc convenistis) ; vgl. C . 7 , 62, 22 (legibus cogentibus). Der obrigkeitliche und der prozessuale etc. 231 Die in den Quellen begegnenden Fälle des unmittelbar obrigkeitlichen Zwanges sind zahlreich . Die hier zuständigen Magistrate sind vor allem die Konsuln, der praetor tutelaris, der praetor fideicommissarius und nicht zuletzt die beiden Jurisdiktions magistrate, der praetor urbanus und der praetor peregrinus. Der mehr oder weniger unabhängig von der Jurisdiktion sich auswirkende unmittelbar - obrigkeitliche Zwang lässt sich in einer ganzen Reihe von Fällen aufzeigen . Es wären hier zu unterscheiden : prätorischer Zwang zur Uebernahme des Richteramts ( 2) ; prätorischer Zwang zur Urteilsprechung beim receptum ar . bitri (3 ); prätorischer Zeugniszwang, insbesondere bei Eröffnung von Testamenten und im Strafverfahren (4) ; prätorischer Erbantretungszwang ex Sc. Pegasiano (5 ) ; prätorischer Zwang zur Erteilung der auctoritas tutoris bei der tutela mulierum (6) ; obrigkeitlicher Zwang in Fideikommisssachen ( 7) ; obrigkeitlicher Zwang zur Bestellung einer Mitgift ex lege Iulia de maritandis ordinibus (8 ) ; obrigkeitlicher Zwang zur Freilassung von Sklaven (9 ) und aus nahmsweise auch zur Emanzipation von Hauskindern (10); ( 2) Dieser Zwang geht zurück auf den Judikationsbefehl des Prätors ; vgl. hierzu WLASSAK , Der Judikationsbefehl der römischen Prozesse 1921 . (3 ) Der Prätor sagt: qui arbitrium pecunia compromissa receperit, eum sen tentiam dicere cogam (vgl. LENEL, Ed.3 131). Der Zwang wird durch multae dictio bewirkt; arg. Paul. D . 4, 8, 32, 12. (4 ) Ulp. D . 29, 3, 4 (praetoris id officium est, ut cogat signatores convenire et sigilla sua recognoscere); Ulp. D . 43, 5 , 3 , 9 i. f. (et si forte non optemperent testes , Labeo scribit coerceri eos a praetore debere); Paul. D . 22, 5 , 4 ; Gai. D . 22, 5, 5 ; Scaev. D . 22, 5 , 8 ; Ulp . D . 48, 18 , 1, 10 . (5 ) Epitome Ulp. 25 , 16 : Si heres damnosam hereditatem dicat, cogitur a praetore adire et restituere.... (6) Gai. 1, 190; 2, 122; vgl. dagegen Paul. D . 26, 8, 17 : Si tutor pupillo nolit auctor fieri, non debet eum praetor cogere. (7) Technisch ist fideicommissum praestare cogere. (8) Vgl. Costa, Storia del diritto romano privato 96 . (9 ) Technisch ist fideicommissam libertatem praestare cogere . (10) Marc. D . leg. I 114 , 8 ; Ulp . D . 35, 1, 92 ; Pap. D . 37, 12, 5 ; Pap. D . 38, 6 , 8 i. f. 232 Benedikt Frese obrigkeitlicher Zwang zur Uebernahme der Vormundschaft (11) ; obrigkeitlicher Zwang zur Alimentierung von nahen Angehö rigen , (12) und obrigkeitlicher Zwang zur Erfüllung einer pollicitatio (13). Der obrigkeitliche Zwang zur Erfüllung einer Auflage gehört wohl erst dem justinianischen Recht an (14). Soweit der obrigkeitliche Zwang aus Anlass der Jurisdiktion des praetor urbanus in die Erscheinung tritt, umfasst er in der Hauptsache folgende Fälle : die Einlassungspflicht des Beklagten gegenüber der actio in personam (15) ; die Defensionspflicht des Prokurators (16 ) , die Editionspflicht der Argentarier und gegenüber den Argen tariern (17) ; (11) I. 1, 25 pr.: nam et tutelam ... placuit publicum munus esse ; die Vor mundschaft ist zugleich ein onus : I. 1, 25 , 20 ; Ulp . D . 27, 1 , 3 ; Ulp . D . 27 , 1, 5 ; Mod. D . 27, 1, 15 , 16 ; Fr. Vat. 183. 189 ; Zwang zur Uebernahme der Vormund schaft : Ulp . D . 26 , 7, 1 pr.; Ulp . D. 26 , 7, 5, 1 (cessantque partes eorum sc. con sulum , qui solent cessantes cogere administrare); Mod . D . 27 , 1, 1, 17 i. f.; Cal list. D . 27 , 1, 17 pr.; Marc. D . 27 , 1, 21, 3 ; Paul. D . 27 , 1, 42; Fr. Vat. 147. 155. 224 . Zum iussum vgl. Pomp. D . 26 , 7 , 17 : Qui iussus est ab eo, qui ius iubendi habet, tutelam gerere, si cessasset.... ( 12) Ulp . D . 25 , 3, 5 , 10 i. f. (pignoris captis et distractis cogetur sententiae satisfacere). (13 ) Ulp . D . 50, 12, 8 : .... obbedire eum rei publicae ob hanc causam iubebunt ( sc . consules). ( 14 ) Pap. D . 5 , 3 , 50, 1 i. f. : itp. quamvis enim stricto iure nulla teneantur actione heredes ad monumentum faciendum , tamen principali vel pontificali aucto ritate compelluntur ad obsequium supremae voluntatis ; vgl. BESELER , Beitr . 4 , 43. Pomp. D . 33, 1 i. f.: itp . sed interventu iudicis - ad effectum perduci; vgl. EISELE SZ 13, 141. Mod . D . 40, 4 , 44 i. f.: itp . officio tamen iudicis esse compellendos testatricis iussioni parere; vgl. PERNICE, Labeo 3, 24 . ( 15 ) Vorausgesetzt wird dabei, dass jemand suo nomine, aus eigener Obli gation verklagt wird. Vgl. WLASSAK, SZ 25, 142. 146. 154. Die Weigerung des Beklagten, sich auf die actio in personam einzulassen , zieht für ihn ductio bzw . missio in bona nach sich (vgl. WLASSAK , Die klassische Prozessformel 205 ). ( 16 ) Ulp . D . 3, 3 , 33, 3 ; Fr. Vat. 330 : Papinianus respondit, si procurator absentis aliquam actionem absentis nomine inferre velit, cogendum eum adversus omnes absentem defendere; Paul. D . 3. 3 , 43, 4 ; C . 2 , 12 (13), 5 . Vgl. hierzu mei nen Aufsatz « Defensio , solutio, expromissio des unberufenen Dritten » , in Studi Bonfante 4 , 408 ff. (17) Ulp. D. 2, 13, 4 pr.; Ulp. D . 2, 13, 6, 8 ; Ulp. D. 2, 13, 8, 1 (Editions dekret). 233 Der obrigkeitliche und die prozessuale etc. die Antwortpflicht bei der interrogatio in iure, ob der Beklagte Vollerbe oder Teilerbe sei (18); das iusiurandum in iure delatum in Verbindung mit der Edikts rubrik « si certum petetur » (19) ; das agere cum compensatione bzw , deductione (20) ; das beneficium divisionis ex epistula Hadriani bei Vorhandensein mehrerer fideiussores (21) ; die prätorischen Stipulationen (22). Der unmittelbar - obrigkeitliche Zwang äussert sich vornehm lich in der magistratischen coercitio, d. h . der multae dictio uud pignoris capio . Von diesen Zwangsmitteln scheint ein ausgiebiger Gebrauch gemacht worden zu sein. So wurden z. B . sogar die Se natoren , wenn sie zur anberaumten Senatssitzung nicht erschienen , zur Strafe dafür gepfändet (23 ). Die Aedilen , denen die Aufrecht erhaltung der öffentlichen Ordnung oblag, bedienten sich mit Vorliebe der pignoris capio (24). Im Verfahren extra ordinem wurde ( 18 ) Die Verweigerung der Antwort wird als mangelnde defensio angesehen und zieht ductio bzw . missio in bona nach sich . So die lex Rubria c. 21. A . M . LAUTNER , Festschrift für Hanausek 77 f. (19) Ait praetor : « eum , a quo certum petetur, solvere aut iurare cogam » . LENEL, Ed.3 2366 : wer weder zahlt noch schwört, fällt unter den Begriff « qui non uti oportet se defendit » . Es tritt hiernach also missio in bona ein . ( 20 ) Gai. 4 , 64. 65. 68. Der Zwang bestand im drohenden Prozessverlust infolge von plus petitio . (21 ) Pap . D . 46 , 1, 51, 21 Duo rei promittendi separatim fideiussores dederunt: invitus creditor inter omnes fideiussores actionem dividere non cogitur, sed inter eos dumtaxat, qui pro singulis intervenerunt. • (22) Bei der cautio de rato: Zwang - denegatio actionis; vgl. Consult. 3 , 7-9 ; 39,1,7 pr: 1:13. Bei der Cpawl.D . 12, Ulp . D . 39, 1, 7 pr. Bei der cautio iudicatum solvi: Zwang u . U . missio in bona ; vgl. Ulp. D . 42, 5 , 31, 3. Bei der cautio usufructuaria : Zwang - denegatio actio nis ; vgl. Ulp . D . 7, 1, 13 pr. und Paul. D . 12, 2, 30, 5 . Beider cautio legatorum servandorum causa : Zwang - missio in bona. Bei der cautio collationis: Zwang - Verweigerung der Erbschaftsklagen ; vgl. Ulp . D . 37, 6 , 1 ss 10. 13 ; Paul. D . 37, 6 , 2, 8 ; C . 6 , 20 , 12 pr.; C . 6 , 20 , 14. Bei der cautio rem pupilli salvam fore : Zwang - pignoris capio ; vgl. I. 1, 24 , 3. Bei der cautio damni infecti: Zwang missio in rem . Vgl. auch WOESS, SZ 53, 375. (23) Gell. 14 , 7, 10 : Praetor haec de pignore quoque capiendo disserit deque multa dicenda senatori, qui, cum in senatum venire deberet, non adesset. SE NECA controv. 1, 8 , 4 : senator post secagesimum et quintum annum in curiam venire non cogitur. ( 24 ) Paul. D . 18, 6, 13 (12). Roma · II 16 234 Benedikt Frese die pignoris capio auf Grund des Reskriptes des Kaisers Antoninus Pius zum Exekutionsmittel (25 ). Der jurisdiktionelle Zwang ist mannigfaltiger. Er äussert sich in der denegatio actionis, der Verweigerung von Erbschaftsklagen , dem Erlass von Interdikten (26 ), der ductio, der missio in bona und anderem mehr. Die Prätoren griffen nur ungern zur coercitio (27). Das Gebiet des obrigkeitlichen Zwanges ist ein umfassendes , das Interesse für diese Frage jedoch verhältnismässig gering, was schon der Mangel an Literatur beweist (28 ). Auch die Frage nach dem prozessualen Zwang ist in der Literatur wenig beachtet worden (29), und doch ist sie überaus (25) Ulp . lib. 3 de officio consulis D . 42, 1, 15 pr. A divo Pio rescriptum est magistratibus populi Romani, ut iudicum a se datorum vel arbitrorum sen tentiam exsequantur hi qui eos dederunt. (26 ) Das Interdikt beruht auf dem Imperium des Prätors und ist als obrig keitlicher Befehl zwingend (vgl. Gai. 4, 139, 140 . 150. 167 ; Ulp . D . 43 , 12, 1, 21 ; Ulp . D . 43, 24 , 1, 1 ). Cogi, teneri und obstringi sind hier technisch . Zu cogi vgl. Gai, 4 , 154. 155 ; Ulp . inst. fr. Vind . 4 (nam si fundum vel hereditatem , ab aliquo petam nec lis defendatur, cogitur ad me transferre possessionem ) ; Alf. D . 8 , 5 , 17, 1 (per interdictum cogi posse) ; Ulp. D . 39, 1, 20 , 1 ; Ulp . D . 39 , 3, 4 , 2 ; Ulp . D . 43, 8 , 1 , 17 ; Ulp . D . 43, 16 . 1 SS 19. 35 . 42; Paul. D . 43, 16 , 9 , 1. Zu teneri vgl. Cic. Caec. 14 , 41 (hoc interdicto Aebutius non tenetur) ; Ulp. D . 5 , 3 , 11 pr. ( et Arrianus libro secundo de interdictis putat teneri) ; Gai. D . 4 , 7 , 3 , 2; Ulp. D . 7 , 1, 13, 2 ; Ulp . D . 11, 8 , 1 SS 8. 10 ; Paul. D . 39, 3, 5 ; Gai. D . 39, 3, 13; Paul. D . 43, 2, 2 ; Ulp . D . 43, 3, 1 SS 4 . 6 . 9 ; Paul. D . 43, 3, 2 , 4 ; Ulp . D . 43, 5 , 3 SS 3. 4 . 6 ; Ulp . D . 43, 8 , 2 SS 13. 26 . 27. 28 33. 37. 39.41; Ulp . D . 43, 13, 1 SS 3. 4 . 5 ; Ulp. D . 43, 16 , 1 SS 35. 36 ; Pap. D . 43, 16 , 18 pr.; Ulp. D . 43, 20, 1, 25 ; Ulp . D . 43, 24 , 7 SS 2 . 9. 10 ; Ulp . D . 43, 24, 9 SS 2. 3 ; Ulp . D . 43, 24 , 11 pr. SS 1. 3 ; Cels . D . 43 , 24 , 18 pr.; Venul, D . 43 , 24, 22 ss 1. 3 ; Paul. D . 43 , 3, 2, 4 (tenet interdictum ) ; Ulp . D . 43 , 4 , 4 , 1 (non tenebit interdictum ) ; Ulp. D . 43, 16 , 1, 32 (interdictum tenere). Zu obstringi vgl. Marc. D . 43, 16 , 12. (27) Ulp . D . 25 , 5, 1, 2; Ulp . D . 36 , 4, 5, 27; Ulp . D . 39, 2, 4, 2; Ulp . D . 43, 4, 3 pr. i. f. (itp . Faber); vgl. auch Ulp. D . 11, 7 , 8, 2 ; Ulp . D . 11, 7, 12 pr.; Ulp . D . 11, 7, 14, 2 ; Paul. D . 23, 2, 66 pr.; Ulp. D . 43, 13, 1, 12 ; Ulp . D . 43 , 32, 1, 2. (28) Vgl. jedoch HARTMANN, Die Obligation , Erlangen 1875, S. 141 ff. (29) Zum Teil liegt das daran , dass an einen prozessualen Zwang überhaupt nicht gedacht wird, sondern nur an einen Aktionenzwang. So vor allem BEKKER (Akt. 1, 4 ff., der obligari und actione teneri für gleichbedeutend hält. HART MANN (a . a . 0 , 132) dagegen sagt, obne näher auf die Meinung Bekkers einzu gehen, es bestehe eine sozusagen mathematische Gewissheit, dass sich die Vor stellungen Obligation einerseits und actione teneri andererseits nicht decken . Der obrigkeitliche und der prozessuale etc. 235 wichtig . Denn es handelt sich da vor allem um eine grundsätzliche Stellungnahme zu den Begriffen actio und obligatio, ihrem Verhältnis zu einander und ihrer Bedeutung für den Prozess. Diese Frage bedarf einer näheren Erörterung, denn ihre Lösung erst führt uns zu einer klaren Anschauung darüber, worauf die Haftung des Be klagten im Prozess und vor demselben zurückzuführen ist. Die causa der Haftung ist aber auch bestimmend für Art und Inhalt der Formel, und diese wiederum für das, je nachdem , enger oder weiter gefasste officium iudicis. Der Inbegriff dessen , was in iudicium venit, d . h . alles dessen, was der Richter im ein zelnen Fall berücksichtigt, anordnet und erzwingt, ist für den Ausfall des Prozesses – Freispruch oder Verurteilung des Beklagten von entscheidender Bedentung. Je nachdem das officium iudicis enger oder weiter gefasst ist, hat auch der Richter eine geringere oder grössere Bewegungsfrei heit. Bei der condictio ist die Gebundenheit des Richters der stren gen Fassung dieser Formel ( 30 ) gemäss eine grössere, - bei den bonae fidei iudicia dagegen hat er sogar die Möglichkeit, nach ei genem Ermessen eine Forderung des Klägers mit einer aus der selben causa entstandenen Gegenforderung des Beklagten zu kom pensieren und diesen auf den Rest zu verurteilen . Abgesehen von anderen Seiten der richterlichen Tätigkeit sei besonders darauf hingewiesen , dass der richterliche Zwang in der Hauptsache hinausläuft auf 1. Restitutionszwang; 2. Exhi bitionszwang ; 3. Kautionszwang und 4 . Prästations zwang. LEVY (Konkurrenz 1, 866) schliesst sich in der Hauptsache Bekker an, meint aber, actione teneri sei « eine eigenartige Denkform » . Wie befangen die Romanisten in der Vorstellung von actione teneri sind, zeigt besonders dentlich WINDSCHEID , Die Actio des römischen Zivilrechts ( 1856 ) S. 60 : « Also : iudicio reus tenetur, und weil das Judicium mit der Litiskonte station beginnt : litis contestatione tenetur. Gewiss ist dies das Richtige » , Bis hierher bin ich mit Windscheid einverstanden. Aber dann folgt etwas, was vom Standpunkt des klassischen Rechts aus ganz und gar unzutreffend ist: « Aber dieses Judicium selbst, ist das denn etwas Neues? Ist es nicht dasselbe, welches auch vor seiner Realisierung , vor der Litiskontestation , dem Kläger zustand ? Venditor empti iudicio , empti actione tenetur — von demselben Judicium , von derselben Actio , vor und nach der Litiskontestation » . (30 ) Ueber die condictio als Formel vgl. unten. 236 Benedikt Frese Der Restitutionszwang (31) sowohl wie der Exibitionszwang (32) betreffen vor allem die formula arbitraria . Auf Grund des iussum de restituendo soll der Beklagte z . B . bei der rei vindicatio die Sache dem Kläger herausgeben ; wenn er das nicht tut, so droht ihm das iusiurandum in litem , ein Schätzungseid , welcher dem Kläger vom Richter auferlegt wird. Das gleiche gilt auch bei der Exhibition. Die richterlichen Kautionen (33) sind namentlich bei den bonae fidei iudicia von Bedeutung und Können sowohl dem Kläger (34) als dem Beklagten (35) auferlegt werden . Der Prästa tionszwang bezieht sich vornehmlich auf die Zinsenleistung (36 ). Da gilt der Satz : usurae quae officio iudicis praestantur. . Die Frage, die uns nunmehr beschäftigen soll, ist die , ob die actio schon als Zwangsmittel angesehen werden könne. Für das klassische Recht müssen wir diese Frage verneinen . Nicht die actio hat Zwangscharakter, sondern erst das iudicium , der Prozess selbst. Die actio selber ist nicht Zwang, sondern gibt nur ein Recht auf den Zwang. (31) Der Restitutionszwang ist verknüpft mit einem iussum iudicis : vgl. I. 4 , 17 , 2 ; Iul. D . 5 , 4 , 7 ; Alf. D . 6 , 1 , 57; Iul. D . 23, 5 , 7, 1 ; Ulp . D . 39, 3, 6 , 6 ; Pomp. D . 47, 2 , 9 , 1. Den richterlichen Restitutionszwang bezeichnen die Juristen mit restituere cogere : Ulp. D . 42, 8, 10, 20 (nam arbitrio iudicis non prius co gendus est rem restituere , quam ....); Hermog. D. 5 , 3, 52; I. 2, 1, 35 ; Ulp. D . 6, 1, 17, 1 ; Pap. D . 6 , 1, 48 ; Pap. D . 6 , 1, 65 pr.; Iul. D . 10 , 4 , 8 i. f.; Paul. D . 17 , 1, 59, 1; Pap. D. 20, 1, 1, 2; Paul. D. 21, 1, 58 pr.; Pap. D . 34 , 3, 23 ; Fr. Vat. 12; vgl. auch Cic. in Verr. II, 2, 12, 31 : L . Octavius iudex esto . Si paret fundum Capenatem , quo de agitur , ex iure Quiritium P . Serviliü esse, neque is fundus Q. Catulo restituetur, non necesse erit L . Octavio iudici cogere P. Servi lium Q . Catulo fundum restituere..... (32) arg. Iul. D . 10, 4 , 8. (33) Vom richterlichen Kautionszwang handeln folgende Stellen : Gai. 3, 125 (... aut iussu iudicis satis accipiatur); Pap. D . 22, 1, 1, 2 (iudex iudicii bonae fidei recte iubebit interponi cautiones ) ; Tavol. D . 8, 5 , 12 i. f. (iudicis officio con tineri puto , ut de futuro quoque opere caveri debeat); Paul. D . 10 , 2, 25 , 10 (.... officio iudicis cautiones interponi debere) ; Paul, D . 17, 2, 38 pr. ( Pro socio arbiter prospicere debet cautionibus in futuro damno vel lucro....); Pomp. D . 27, 3, 3 (arbitratu iudicis cavendum est). (34) Ulp . D . 6, 1, 19; Paul. D . 6, 1, 47 ; Pomp. D . 13, 6, 13 pr. (is qui com modatum accepit si non apparentis rei nomine commodati condemnetur, cavendum ei est, ut repertam dominus ei praestet). (35 ) Z. B . die cautio de dolo : I. 3, 18, 1; Gai. D . 6, 1, 18, 20 und die cautio de servo (sc. fugitivo) persequendo et restituendo : I. 3 , 18 , 1 ; Paul. D . 6, 1 , 21; Ulp . D . 21, 2, 21, 3 (cautionibus interpositis absolutus) und Paul. D . 24 , 3 , 25, 3. (36 ) Technisch ist hier usuras praestare cogere. Der obrigkeitliche und der prozessuale etc . 237 Um diesen Satz näher zu begründen , müssen wir uns die Be deutung der juristischen Tatsachen vor Augen stellen, welche dem Prozess vorangehen , wie auch ihr Verhältnis zu einander. Dreierlei kommt hier in Betracht: das Rechtsverhältnis selbst, die actio und die obligatio . Gaius sagt uns in Betreff der Frage nach der Entstehung der obligatio , dass sie zurückzuführen sei auf einen Kontrakt, ein De likt, oder auf variae causarum figurae (37). Die obligatio setzt also eine causa voraus ( 38 ). Diese causa ist das Rechtsverhältnis im weitesten Sinn des Wortes. Gaius beschränkt sich in seiner Erörterung aufdie obligatio , auf das Verpflichtetsein des Schuldners, also auf die Haftung desselben . Er will sagen, die Haftung habe ihren Ursprung im Rechtsverhältnis. Gewiss, so ist es. Allein das Rechtsverhältnis hat doch nicht nur eine passive Seite, sondern auch eine aktive. Ist die passive Seite gekennzeichnet durch den Begriff der obligatio , so erschöpft sich die aktive Seite im Begriffe der actio. Was ist nun das Wesen der actio ? Die actio stellt ein ius ac tionis (39) dar, oder , wie Celsus sagt, ein ius persequendi iudicio (40), und ist in gewissem Sinne dem heutigen Anspruch vergleichbar . Die Grundlage der Haftung ist aber nicht die actio , sondern allein das Rechtsverhältnis. Aus ihm entsteht einerseits die actio , andererseits die obligatio (41) – nicht aber entsteht die obli gatio aus der actio oder umgekehrt. Der Satz « obligatio parit ac (37) Gai. 3 , 88 ; Gai. D . 44, 7, 1 pr. (38) Paul. D. 44, 2, 14, 2; Pomp. D . 50, 17, 27 (obligationum causae). (39 ) Quint. inst. or. 3, 6, 73 (habeo ius actionis ). (40) Cels. D . 44 , 7 , 51 (Nihil aliud est actio quam ius quod sibi debeatur, iudicio persequendi); I. 4 , 6 pr. (actio autem nihil aliud est, quam ius perse quendi iudicio quod sibi debetur ). Vgl. auch Mod. D . leg. II 34, 6 i. f. (Mode stinus respondit ut actiones creditorum filius solus excipiat, iussisse testatorem non proponi) ; Ulp. D . 44, 7, 42, 1 (Creditores eos accipere debemus, qui... actio nem ... habent...) ; Scaev . D . leg . II 88, 10 ( quaesitum est, an , si non deberentur actio esset. Respondi, si non deberentur , nullam quasi ex debito actionem esse... ) ; Fr. Vat. 43 i. f. (creditoris actionem excludit); C . 8 , 18 (19), 2 pr. (... nec hi creditores patris tui qui ( personalem habuerunt actionem ... ); C . 8 , 25 ( 26 ), 8 (.....creditores... palam est actionem suam amisisse eos , quam (in rem ) habebant) . (41) So auch LEVY, Konkurrenz 1, 85 : « Man sieht: weder die obligatio noch die actio ist das Primäre : aus dem Kontrakt oder Delikt entsteht die eine wie die andere unmittelbar » und SEGRĖ, Studi Bonfante 3, 520 : actio e obligatio « hanno l'identica causa » . 238 Benedikt Frese tionem » (42) ist ebenso falsch, wie wenn man sagen wollte « actio parit obligationem » (43). Actio und obligatio sind Parallelerschei nungen und stehen nicht in einem genetischen Zusammenhange. Die causa der Haftung ist also zunächst das Rechtsver hältnis. Darum sagt man auch teneri bzw . obligari ex stipulatu (44), ex testamento, ex empto (45), ex vendito, ex locato, ex conducto, ex dotis dictione (46), commodati, depositi (47), mandati (48 ), furti (49), iniuriarum (50), vi bonorum raptorum u. a . (51). Auf die enge Verbindung der Haftung mit der causa weisen auch folgende Wendungen hin : ex causa iudicati teneri (52), ex causa fideicommissi teneri (53), ex causa venditi teneri (54), ex causa mandati obligari (55), ex causa poenali teneri (56 ) u . a . Auch sonst wird teneri bzw . obligari mit der causa in Verbin dung gebracht (57). Wenn ein Korrealschuldner den andern beerbt, (42) Paul. D . 3 , 3, 42, 2 (itp. Ea obligatio , quae inter dominum et procura torem consistere solet, mandati actionem parit ; vgl. meinen Aufsatz « Das Mandat in seiner Beziehung zur Prokuratur », in den Studi Riccobono). (43) BINDER, Prozess und Recht 49 : « Die actio begründet die obligatio » . (44) Gai. 4, 116 (cum ex stipulatu tenearis). Das klassische Gegenstück zu ex stipulatu teneri ist ex stipulatu liberari, vgl. D . 46, 3, 38, 2. (45 ) Fr. Vat. 13 (ex empto tenebitur) ; vgl. auch D . 26 , 2, 11 ( ex fideicom misso teneri); D . 42, 2, 4 (ex confesso tenetur). (46 ) Fr. Vat. 99 ( ex dotis dictione obligari). (47) Gai. 3, 207 (depositi non tenetur ). (48 ) Gai. 3, 156 (mandati tenebor, mandati teneatur ). (49) Gai. 3, 196 ( furti obligatur); Gai. 3 , 202 (furti tenetur) ; Gai. 3, 209 (tenetur etiam furti). Vgl. auch Paul. D . 17, 1, 22, 7 ( et mandati et furti te te neri Proculus ait). (50 ) Gai. 1 , 141 (iniuriarum tenebimur) ; Seneca controvers. 10, 1 (30 ), 9 (iniuriarum non teneatur). (51) Bereits die Philologen haben festgestellt, dass bei gerichtlichen Verben der Gebrauch des blossen Genitivs durchaus üblich ist. Vgl. auch Perozzi, Obblig . rom . 69 not.: « il genitivo, che qui compare , sta per la causa ». (52) Gai. 3, 180 ; Scaev , D . 42, 1 , 44 . (53) Scaev. D . leg. III 33, 2 ; Scaev. D . leg. III 41, 7 ; Scaev. D . 34, 3 , 28, 5 ; Scaev. D . 36 , 1, 80 ( 78 ), 6 . (54 ) Paul. D . 41, 3 , 48. (55 ) C . 8, 42 (43 ), 13. (56 ) Ulp . D . 48, 10 , 25 (ex causa [actione in factum poenali tenetur ). (57) Paul. D . 15 , 1, 26 ; Ulp . D . 15 , 3 , 1, 5 ; Pap. D . 18 , 6 , 19 (18) pr. ; Paul. D . 25, 2, 6 , 3 ; Ulp . D . 27, 8 , 1 pr. ; Gai. D . 44, 7, 5 , 3 ; Afric. D . 46, 3, 38, 5 ; Paul. D . 50, 1, 21 pr.; Paul. D . 50, 17 , 87 ; Ulp . D . 5 , 3, 20, 20 (ob venditionem ); Gai. D . 9, 2 , 8 , 1 (vulgo dicitur culpae nomine teneri); Pap. D . 12 , 6 , 55 (ob in Der obrigkeitliche und der prozessuale etc. 239 so heisst es in den Quellen ausdrücklich : dass er ex duabis causis verpflichtet werde (58). Und Gaius sagt gelegentlich der Behand lung des Litteralkontrakts (59): ex causa emptionis – ex causa conductionis - ex causa societatis debere ; ähnlich auch Papinian in einer Digestenstelle (60) : ex causa tutelae debere. Was die beiden Juristen von der Schuld sagen, müsste m . E . ohne weiteres auch von der Haftung gelten, nämlich dass auch sie auf die causa zurückgeht (61), nicht aber in der actio ihren Grund hat. Actio und obligatio gehen also auf eine gemeinsame causa zurück . Diese ist das Rechtsverhältnis. Actio und obligatio entspringen aus dem Rechtsverhältnis und münden in den Pro zess. Hiermit treten wir in ein neues Stadium der Haftung. Ein geleitet wird der Prozess durch die litis contestatio, einen Prozess vertrag der Parteien . Durch diesen Prozessvertrag findet eine No vation statt , und zwar sowohl der actio, als auch der obligatio (62). Damit aber ist das ganze Rechtsverhältnis noviert (63). Actio und debitum ); Venul. D . 21, 2, 75 (ob evictionem ); Paul. D . 34, 1, 12 (ob causam fidei commissi); Pap. D . 35 , 2, 11, 2 (legatorum nomine) ; Paul. D . 47, 2, 42, 1 (ob furtum ) ; C . 8, 22 (23), 1 (ob causam iudicati). — Auch das blosse teneri bzw . obligari ohne Verbindung mit der causa bzw . actio begegnet in den Quellen, Vgl. hierzu SEGRÈ Studi Bonfante 3, 508 n . 21 : « teneri non ha punto sempre per complemento necessario implicito actione » . (58 ) Ulp. D . 46 , 1, 5 (reum vero reo succedentem ex duabus causis esse obli gatum ); vgl. Pap. D . 26 , 7, 37 pr. ( Tutorem , qui tutelam gerit, Sabinus et Cas sius... ex pluribus causis obligari putaverunt); Gai. D . 44, 7, 39 (Filius familias ex omnibus causis obligatur ); Tryph. D . 46 , 1, 69 ; Gai. D . 46 , 2 , 34 , 2 (ex di versis causis singuli fuerant obligati); Paul. D . 13, 5, 19, 2 (ex ea causa obstringi) ; Ulp . D . 39, 5 , 12 (ex eadem causa obstringi); C . 8, 40 (41) 15 pr. (ex causa fi deiussionis obstringi). Die causa ist in der kompilation zuweilen durch die begrifflich erweiterte obligatio ersetzt worden und zwar in fol genden Stellen : Paul. D . 12, 6 , 60, 1 ; Scaev. D . 33, 1, 20 , 3 ; Iul. D . 34, 3, 11 ; Pap. D . 42, 6, 3 pr.; C . 5, 46, 1, 3 ; Pomp. D. 50, 16, 121 ; vgl. auch Paul. Sent. 2, 13, 9 (cf. SIBER Naturalis obligatio 36 ). (59) Gai. 3, 129. (60) Pap. D. 35 , 2, 15 , 3; vgl. hiermit Scaev. D . leg. III 41, 6 (ex causa fideicommissi debere). (61) So sagt man sowohl ex testamento debere (Gai. 3 , 125 ) als auch ex te stamento teneri (Paul. D . 19, 2, 24, 5 ; Ulp . D . leg. I 53 $S 3 . 7 ; Iul. D . 33, 5, 12 ; Pomp. D . 34, 3, 2 pr.; Paul. D . 46 , 8, 15). (62) Gai. 3, 180 ( Tollitur adhuc obligatio litis contestatione... incipit autem teneri reus litis contestatione ). (63) Vgl. Paul. D . 17, 2, 65 pr. (iudicio mutata sit causa societatis). 240 Benedikt Frese obligatio gehen nunmehr im iudicium auf. Die Haftung gründet. sich , formell genommen, nicht mehr auf das primäre Rechtsver hältnis, sondern auf das aus diesem erwachsene iudicium . Mit Recht sagt man daher iudicio agere und iudicio teneri bzw . obligari (64). Im diesem Zusammenhang möchte ich noch bemerken , dass höchst wahrscheinlich die Ausdrücke actione agere, actione petere, actione experiri, actione conveniri, actione consequi, actione persequi, actione praestare, actione recipere, actione reciperare, und actione re stituere nicht klassisch sind (65). Statt mit « actione » müssten die genannten Verben im klassischen Recht, wie es auch vielfach geschehen ist, mit iudicio verbunden werden . Man muss sich vergegenwärtigen , dass in den Quellen beides vorkommt: iudicio teneri, iudicio obligari und iudicio cogi einerseits und actione teneri, actione obligari und actione cogi andereseits . In dieser Unausgeglichenheit der Quellen müssen wir eine ältere und eine jüngere Schicht der Rechtsentwicklung erblicken . Welche ist nun die ältere, welche die jüngere ? In der älteren Zeit lag der Schwerpunkt je denfalls nicht in der actio , sondern im iudicium . Die actio ist nach Celsus der prozessfähige obligatorische Anspruch, sie hat also mehr eine materiellrechtliche Bedeutung, das iudicium oder der Prozess aber ist die zwangsweise Verwirklichung des Rechtsanspruchs. Der Prozess beginnt mit der litis contestatio, die das der lis zugrunde liegende Rechtsverhältnis noviert. Bis dahin beruhte der (64) Iudicio teneri kommt in den Quellen überaus häufig vor; iudicio obli gari, soweit ich sehe, nur fünfmal: I. 3, 27 , 4 ; Ulp. D . 23, 3, 38 ; Mod. D . 24, 3, 58 ; Paul. D . 44, 7 , 46 ; C . 8 , 15 (16 ), 6 . Vgl. auch Cic . Verr. 1 9, 24 : videbam me hoc iudicio districtum atque obligatum futurum . (65 ) In manchen Fällen lassen sich die Interpolationen ohne weiteres aufzei gen : 1) actione agere, itp . in Ulp. D . 4 , 3 , 9 , 3 ; Ulp . D . 4, 9 , 3, 5 ; (vgl. auch BESELER, SZ 44, 366 ); Ulp . D . 12, 4 , 3 , 9 ; Ulp . D . 13 , 7, 13 pr.; Ulp . D . 17 , 1, 6 , 3 , (vgl. SIBER Studi Bonfante 4 , 1 , 21) ; vgl. I. 3, 23, 1 und C . 3, 31, 12 , 1a ( a. 531). 2 , actione petere itp . in Paul. D . 16 , 3, 26 , 1 (vgl. LENEL, Paul. 1474 ). 3) actione experiri itp . in Pap. D . 5 , 2 , 15 , 2 und C . 3 , 28, 7 , 4 ) actione conve niri itp. in Ulp . D . 17, 1 , 6 , 1 (vgl. FRESE, Mél. Cornil 1, 3713). 5 ) actione con sequi itp . in Paul. D . 25 , 2 , 6 , 4 und Iul. D . 25 , 2 , 22, 1 (vgl. BESELER, Beitr . 4 , 47). 6 ) actione persequi itp, in I. 4 , 6 , 18 und Ulp . D . 12, 1, 24 . 7 ) actione praestare itp. in Ulp. D. 19 , 1, 13 pr. (Iul.-Marcell. D . 19, 1, 23 u. Nerat. D . 19, 1, 31 pr. : ex empto praestare) und Afric . D . 19, 2, 33. 8 ) actione recipere itp. in Iul. D . 39, 5, 2, 7. 9 ) actione reciperare itp. in Pomp. D . 45, 3, 39. 10 ) actione restituere itp . in Ulp D . 20, 1, 21, 3 (vgl. SCHULZ, SZ 32, 58 ). Der obrigkeitliche und die prozessuale etc . 241 obligatorische Anspruch auf einer bestimmten causa , d. h. einem die Haftung begründenden Rechtsverhältnis . Mit der litis contestatio entsteht etwas ganz Neues, insofern als der Prozessvertrag an die Stelle des alten Rechtsverhältnisses tritt und nicht mehr dieses, sondern das iudicium die haftungbegründende juristische Tatsache wird . Sagte man z. B . vor der litis contestatio « ex empto teneri » , so hiess es nach der litis contestatio « empti iudicio teneri » . Wenn , wie wir gezeigt haben ,die Haftung zuerst auf das Rechts verhältnis zurückgeht und dann mit der litis contestatio in das iu dicium übergeleitet wird , so ist es einleuchtend , dass die Haftung auf einem Entweder – Oder beruht und ein Drittes, nämlich eine auf die actio zurückgehende Haftung, ausgeschlossen erscheint. Als völlig gleichwertige Ausdrucksformen für die Haftung werden in den Quellen gebraucht : teneri und obligari (66 ). Vor der litis con testatio wird in Verbindung mit der Haftung naturgemäss nur die causa genannt während nach der litis contestatio das iudicium hin zutritt. Man sagt dann : litis contestatione teneri (67), officio iudicis teneri (68 ), formula teneri (69), iudicio teneri, condictione teneri (70). (66) So auch SEGRĖ Studi Bonfante 3, 508 n . 21 : « a . obligari e a . teneri sono usati indifferentemente » ; p. 523 n . 76 : « obligari ha senso amplissimo corri spondente a teneri ». A . M . ALBERTARIO (vgl. seine Abhandlungen La c. d . hono raria obligatio , RIL 59 (1926 ), 519 ff. und La c . d . obl. ex c . fideicommissi, RIL 60 (1927), 103 ff.) und, wie es scheint auch ARANGIO -Ruiz (zit. bei Segrè Studi Bonfante 3, 504, 507), die den Gebrauch von obligari auf das ius civile beschrän ken . Dagegen sprechen jedoch die unzweifelhaft echten Wendungen de peculio obligari, iure honorario obligari und fideicommisso obligari. Vgl. Ulp . D . 15 , 1, 3 SS 3 . 5 . 6 ; Ulp. D . 46 , 1 , 8 , 2 (vgl. Pap. D . 14, 3, 19, 3 ; Ulp. D . 47, 5 , 1 , 3 ); Scaev. D . 36 , 1 , 78 ( 76 ) (vgl. Gai. 2, 184 ; Afric. D . leg. II 77, 3 ; Scaev. D . 36, 1, 80 (78 ), 11). Die Ausdrücke teneri und obligari begegnen uns auch beim Pfand recht, aber keineswegs in Verbindung mit der Pfandklage, sondern nur im Sinne von Pfandhaftung. (67) Gai.3, 198,5, 35 pr.; vem...quaeritur... 38,5, 5 pr. (67) Gai. 3, 180 (incipit autem teneri reus litis contestatione). (68) Ulp . D . 28 , 5 , 35 pr.; Venul. D . 43, 26 , 22, 1. (69 ) Fr. de formula Fabiana 2 (... quaeritur... quis teneatur hac formula ); und 7 (tenebitur hac formula ) ; vgl. jedoch Paul. D . 38, 5 , 5 pr. (tenetur Fabiana (actione]). (70) Gai. 3, 91; I. 3 , 14 , 1 ; I. 3, 27 , 6 ; Ulp . D . 7 , 1, 12, 5 ; Ulp. D . 12, 1, 18 pr. ; Iul. D . 12, 4 , 11 ; Paul. D . 13, 1, 5 ; Ulp . D . 13, 1, 6 ; Ulp . D . 13, 1, 9 ; Ulp . D . 13 , 1 , 10 pr. ; Pomp. D . 13 , 1, 16 ; Pap. D . 13, 5 , 9 ; Ulp . D . 23, 3 , 5 , 9 ; Ulp . D . 23, 3, 9 pr. ; Scaev. D . 24 , 1, 56 ; Iul. D . 26 , 8 , 13 ; Paul. D . 39, 6, 39 ; Paul. D . 44, 4 , 5 , 5 ; Paul. D . 44, 7 , 34 SS 1 . 2 (teneri eum condictione et furti ); Ulp . D . 45, 1 , 29, 1 ; Paul. D . 46, 2, 12 ; Iul. D . 46 , 8, 22 pr. (condictio, qua procu 242 Benedikt Frese Da die condictio zur Zeit des Formularprozesses nicht gleich bedeutend mit actio ist, sondern nur die Benennung einer ganz bestimmten Formel (71) mit der intentio dare oportere (72), ist der Ausdruck « condictione teneri » nicht zu beanstanden , um so mehr als es bei Gaius (3, 91) heisst : unde quidam putant pupillum aut mulierem , cui sine tutoris auctoritate non debitum per errorem datum est, non teneri condictione, non magis quam mutui datione. . Einen greifbaren Beweis dafür, dass die condictio eine Formel gewesen ist, bietet ein im Thesaurus 1. l. s. v. condictio angeführtes altes Glossar, wo es von der condictio heisst : condicticia formula . Noch der byzantinische Jurist Stephanus erblickt in der sogenann ten condictio triticaria für das klassische Recht eine Prozessformel (73). Gegenstand der condictio ist ein certum (74), nämlich certa pecunia oder certa res. Die condictio incerti hat augenscheinlich im klassischen Recht keinen Raum . Nach Wegfall des Formularpro zesses sinken die Formeln immer mehr zu actiones herab. Der Entwicklungsgang der condictio wäre also folgender : 1. legisactio ; 2. formula ; 3. actio (condicticia actio) (75 ). Die Bezeichnungen teneri und obligari werden im Gebiet der actiones in personam gebraucht, während bei den actiones in rem , einschliesslich der hereditatis petitio, nur vindicare, formula vindi curator teneretur, si stipulatio interposita non fuisset) ; Pomp. D . 47, 2 , 77 (76 ), 1 ; Paul. D . 47, 7 , 8, 2 (etiam furti tenebitur lignorum causa et condictione et ad exhibendum ). Vgl. auch condictione obligari in Pomp. D . 13, 1, 2; Ulp . D . 13, 1, 7 , 2; Paul. D . 16 , 3, 13, 1; Ulp. D . 24, 1, 11, 8 und condictione obstringi in Pomp. D . 13, 1, 16 . Das klassische Gegenstück zu condictione teneri ist condic tione liberari, vgl. D . 46, 3, 72, 3 ( fur condictione liberatur). (71) Vgl. auch v. Mayr, SZ 24, 262 : die condictio sei bei Gaius, vielleicht nach dem Verschwinden der Legisaktionen , « nur oder doch vorwiegend als Be zeichnung der Formel » anzusehen. A . M . Perozzi bei Zanzucchi SZ 29, 443/44 : « condictio in senso proprio non e nome di certe formule, ma di domande ma teriali », (72) So Gaius 4 , 18 ; 4 , 33 ; Gai. 4 , 5 enthält in « fierive » ein Glossem (vgl. PFLÜGER, SZ 43, 159 Anm . 1). (73 ) Schol. Bas. 24 , 8, 7 . (74 ) Ulp . D . 12, 1, 24 ; Paul. D . 12, 2, 28, 4 (deinde ex isdem causis certum condicatur) ; I. 3 , 15 pr. (condictio bei certa stipulatio ) u . a. (75) I. 3, 14, 1 ; I. 4, 6 , 24 ; I. 4, 6, 25 ; Ulp . D . 12, 1, 24 ; Ulp . D . 12, 2, 13, 2 (condicticia tenetur !); Iul. D . 12, 4 , 7 pr. ; C . 8, 54 (55), 3 pr. Der Ter minus condicticia actio ist immer unecht. Der obrigkeitliche nnd der prozessuale etc. 243 care (76 ), hereditatem petere üblich ist (77). Diese Ausdrucksweise erklärt sich daraus, dass das klassische römische Recht keinen dinglichen Anspruch kennt (78 ). Im Hinblick auf die innere Geschlossenheit des eben in seinen Grundzügen entworfenen Bildes von der Haftung vor und nach der Litiskontestation fühlt man sich unwillkürlich zu der Frage gedrängt : wo ist denn hier noch Raum für ein « actione teneri » ? Sachlich lässt sich für das klassische Recht eine solche Ausdrucks weise in keiner Weise rechtfertigen . Wenn aber der Ausdruck « actione teneri » als unklassisch bezeichnet werden muss, so ergibt sich daraus, dass die actio in der klassischen Zeit kein Zwangs mittel gewesen sein kann. Der Schwerpunkt der actio liegt hier in der Bedeutung eines Forderungsrechts, eines obligatorischen An spruchs. In einer ganzen Reihe von Stellen lässt es sich nachweisen , dass « actione teneri » unmöglich echt sein kann . Die Ausdrücke « actio tenet » (79), « actione teneri » sind vom Standpunkt des klas sischen Rechts aus unzutreffend . (76 ) Ps.-Quint. 'decl. 13 , 1 ; vgl. auch Frontin . (ed . LACHMANN) p. 44 : formula iure Quiritium peti debet. (77) In rem actione teneri (Paul. D . 6 , 1 , 27, 3 ), vindicatione teneri (Ulp . D . 47, 2 , 1 pr.) und hereditatis petitione teneri (vgl. D . 5 , 3 passim ) sind Ausdrücke, die dem Sprachgebrauch des klassischen Rechts nicht angehören . Vgl. auch LENEL, Grinhuts Zschr. 37, 537 f. ; SZ 46, 91. – Aus dem Titel D . 5 , 3 möchte ich eine Stelle herausgreifen , um an ihr die Interpolation von hereditatis petitione teneri aufzuzeigen . Es ist das Ulp . D . 5 , 3, 16 , 4 : Iulianus scribit, si is, qui pro herede , possidebat, vi fuerit deiectus, peti ab eo hereditatem posse quasi a iuris posses sore, quia habet interdictum unde vi, quo victus cedere debet: sed et eum qui deiecit petitione hereditatis teneri, quia res hereditarias pro possessore possidet. Auffallend ist hier dreierlei: 1. der zwiespältige Sprachgebrauch : einmal heredi tatem petere und dann hereditatis petitione teneri, 2. die iuris possessio, die be reits von anderen beanstandet worden ist, 3. die Zession des interdictum unde vi. Ich rekonstruiere die Stelle folgendermassen : Julianus scribit, si is, qui pro he rede possidebat, vi fuerit deiectus, peti ab eo hereditatem posse, qui deiecit, quia res hereditarias pro possessore possidet. (78) Das zeigt sich besonders deutlich beim Vindicationslegat: hier ist immer nur die Rede von einem vindicare gegenüber dem Erben oder einem Dritten als Besitzer der vermachten Erbschaftssache. Ein ex testamento teneri auf seiten des Erben liegt dagegen vor beim Damnationslegat (vgl. Ulp . D . leg. I, 53 SS 2-7). (79 ) In folgenden Stellen , die actio tenet bzw . teneat oder tenebit enthalten , dürfte ursprünglich statt actio « formula » gestanden haben : Ulp . D . 13, 5 , 16 , 3 ; Ulp . D . 15 , 1, 30 pr.; Ulp . D . 16 , 3, 1, 18 ; Pap. D . 16 , 3, 24 ; Ulp . D . 21, 1, 25, 244 Benedikt Frese Richtig dagegen ist formula tenet, formula teneri, iudicium tenet, iudicio teneri, und zwar finden wir « formula tenet » bei Horaz (80), « formula teneri » im Fragmentum de formula Fabiana und « iudi cium tenet » bei Papinian in D . 26 , 7, 37, 1 (81). Anders liegen die Dinge in der späteren , d. h. nachklassischen Zeit. An die Stelle des Formularprozesses ist der Kognitionsprozess getreten, für den der Wegfall der Trennung des Verfahrens in iure und in iudicio charakteristisch ist. Die litis contestatio ist ihrem Wesen nach etwas anderes geworden. Sie hat aufgehört ein Partei envertrag zu sein . Die actio tritt jetzt in den Vordergrund und gewinnt immer mehr eine bloss formelle Bedeutung. Der Prozess beginnt bereits mit der Klageerhebung, in der Regel mit der Einreichung des li bellus. Damit erhält die actio Zwangscharakter und werden die Ausdrücke actione teneri, actione obligari, actione cogi üblich und verständlich. Der Gedanke der Einteilung der Klagen in Kategorien kommt auf. Sprach man früher von bonae fidei iudicia, formula pe titoria (82), formula ficticia (83), formula in factum concepta , for mula in bonum et aequum concepta (84), formula arbitraria (85), 1 ; Ulp . D . 27, 3, 6 ; Ulp . D . 42, 4 , 7, 15 ; Ulp . D . 43, 3, 1, 4 ; Ulp. D . 43, 4 , 1, 3 ; Ulp . D . 46 , 6 , 4 , 3 ; Ulp . D . 47, 10 , 11, 1 . Auch in der Veronesischen Gaius - handschrift, die aus dem fünften Jahrhundert stammt, wird zuweilen formula durch actio ersetzt. Vgl. z . B . Gai. 4 , 4. 60 (vgl. Coll. 2 , 6 , 4 ). (80 ) Horaz, Sat. II, 3 , 45 -46 ; der Herausgeber Kiessling bemerkt hierzu : « Auch tenet wird (wie formula ) der Rechtssprache entlehnt sein » . (81) Es heisst hier : tutelae iudicium ... tenere placuit. (82) Gai. 4, 91. (83) Vgl. Gai. 4 , 34 ; fictiones in quibusdam formulis. In Epit. Ulp . 28 , 12 muss es heissen : ficticiis (actionibus ( formulis ) opus est, in quibus heredes esse finguntur ; in dem von P . M . MEYER (SZ 42, 42 ff.) herausgegebenen Pap. 11753 des Berl. Mus., der ein Paulus - Fragment enthält, muss die Lücke in Recto C . 3 -4 so ergänzt werden : nec fictic[ ia formula age]t, nicht aber mit dem Heraus geber: nec fictic[ia actione age]t. (84) Gai. D . 4 , 5 , 8 ; Pap. D . 47, 12, 10 ; vgl. Ulp . D . 11, 7 , 14 , 6 ; Paul. D . 44, 7, 34 pr.; Ulp . D. 47, 10, 11, 1. (85 ) Gai. 4 , 141. 163 ; Ulp . inst. fr. Vind. 5 ; Fr. de formula Fabiana 1 ; I. 4 , 6 , 33c: arbitraria (actio ] ( formula ) proponitur ; Pap . D . 22, 1 , 3, 1. Vgl. BIONDI, Studi sulle actiones arbitrariae 1913. Richtig auch SCHÖNBAUER, SZ 52, 272 f. A . M . LENEL, Zur Lehre von den actiones arbitrariae (1914 ), 201 ff. Der obrigkeitliche und der prozessuale etc. 245 iudicium contrarium (86 ), so heisst es jetzt: actiones stricti iuris und bonae fidei (87), actio petitoria (88 ), actio ficticia (89), actio in factum , actio arbitraria , actio contraria (90 ). Auch die actio directa (91) ist m . E . eine Neubildung. Die Auffassung der condictio als actio in personam gehört ebenfalls hierher. Die condictio, die früher die appellatio einer bestimmten Formel war, wird zum nomen ac tionis. Verwandt mit den Klagen kategorien sind die neuentstandenen Unterarten der condictio, wie z. B . die condictio indebiti (92), die condictio furtiva (93), die condictio liberationis usw . Die rei vindi (86 ) Vom contrarium iudicium , gegeben wegen calumnia des Klägers, handelt Gaius 4 , 174. 177- 181. Es gibt aber auch contraria iudicia zwecks Geltendma chung von Gegenansprüchen ; vgl. Paul. D . 13, 6 , 17 , 3 ; Afric. D . 13 , 6 , 21 pr.; Ulp . D . 13 , 7 , 9 pr.; Ulp . D . 16, 3 , 5 pr.; Ulp. D . 17, 1, 12 SS 7. 8 ; Ulp. D . 27, 4 , 1 SS 4. 5 . 6 . (87) I. 4 , 6 , 28 : actionem autem quaedam bonae fidei sunt, quaedam stricti iuris. (88) I. 4 , 15 , 4 . (89) Epitome Ulp. 28 , 12 ; vgl. auch GUARNERI-CITATI, Supplemento all' indice 8. v. actio. (90 ) I. 3, 27 , 2; I. 4, 16 , 2; C. 2, 18 ( 19 ), 24, 1 (a. 530 ); C .6, 43, 3, 4 (a. 531). (91) Gai. 4 , 34 (non habet directas actiones et : gloss.); I. 4 , 3 , 16 ; I. 4 , 6 , 4 ; I. 4 , 16 , 2 (hier heisst es von der a . pro socio : quae ab utraque parte directa est ) ; C . 2, 18 (19), 24 , 1 (a . 530); C . 5 , 13, 1, 5 a (a. 530 ) ; C. 5, 14, 11 pr. (a . 530 ). Die Unechtheit der actio directa ist bereits von Wlassak in Erwägung ge zogen, aber abgelehnt worden ; vgl. WLASSAK, Die klassische Prozessformel 89. (92) Voran stelle ich zur Vergleichung Gai. 3, 91 I, 3, 14, 1 unde quidam putant pupillum aut mu - ' unde pupillus, si ei sine tutoris aucto lierem , cui sine tutoris auctoritate non ritate non debitum debitum per errorem datum est, non te - est, non tenetur indebiti condic per errorem datum neri condictione, non magis quam mutui datione. tione non magis quam mutui datione. Die condictio indebiti kommt noch in folgenden Stellen vor: Paul. D . 12 , 6 , 15 pr.; Ulp. D . 12 , 6, 30. 31; Tryph. D . 16 , 3, 31, 1 i. f.; Pap. D . 13, 5, 9; Pap. D . 24 , 3, 41; Pap. D . 46, 8, 3 pr.; Pap. D . 47, 2, 81 (80) SS 5. 7; C. 6, 30, 22, 5 ( a. 531). Schon BARON , Abh. aus d . röm . Zivilpr. I 45 und KIPP, Röm . Recht. 276 halten die Benennung condictio indebiti fur interpoliert. (93) Die condictio furtiva finden wir in folgenden Stellen : Paul. D . 25 , 2, 3, 2 ; Paul. D . 25, 2, 21, 5 ; Afric. D . 46 , 3, 34 , 1; Pap. D . 47, 2, 81 (80) SS 5. 7. Schon BARON a . a . 0 . und Bossowski, Ann. Pal. 13 (1927) 393 halten die Benennung condictio furtiva für interpoliert. 246 Benedikt Frese catio heisst nunmehr vorzugsweise actio in rem (94 ) und auch das Interdikt wird zur actio ( 94 a ) oder wird durch unmittelbar-obrigkeit lichen Zwang ersetzt. In Fideikommisssachen wird eine actio fideicommissi (95) anerkannt. Sogar im Gebiete des Strafrechts kommt der Ausdruck actio in Gebrauch . Man spricht z. B . von einer actio falsi (96 ), actio peculatus (97), actio l. Fabiae (98) usw . . Im späteren Recht macht sich auch eine gewisse Tendenz zur Klagenkumulation bemerkbar. Der Grund dieser Erscheinung ist, dass die Klage ihren individuellen Charakter verloren hat und darum viel elastischer geworden ist in dem Sinne, dass sie leicht mit einer anderen vertauscht werden kann. Erwähnenswert ist auch die grosse Veränderung, die in der Terminologie eingetreten ist. Unter obligatio versteht man nicht nur, wie früher, die Verpflich tung des Schuldners (99), sondern auch das Forderungsrecht des Gläubigers (100 ). So ist es auch zu erklären, dass in einer Reihe von Stellen des Corpus iuris « actio » durch « obligatio » ersetzt worden ist. Während man früher sagte « actionem habet », « actio competit », sagt man jetzt, wenn auch vereinzelt, « obligationem habet » (101), « obligatio competit » (102). Die obligatio hat also nun (94) Eine Missbildung ist es auch, wenn man sagt « vindicare in rem actione » , C . 6, 43, 1, 1 (a. 529), bzw . « per in rem actionem », Ulp . D . 5, 3, 16 , 7. (94 a ) Vgl. ALBERTARIO Actio e interdictum , Pavia 1911 ; a . M . LENEL Ed.3 477. — Auch die in integrum restitutio nimmt immer mehr den Charakter einer actio an ; vgl. hierzu FELGENTRÄGER, Romanistische Beiträge Heft 6, 104. (95 ) So mit Recht RICCOBONO, SZ 47, 105 . ( 96 ) C . 1, 3 , 8, 1 (a. 385 ). ( 97) Ulp . D . 48, 13 , 13 (11): (lege) peculatus (actione] tenetur. (98 ) Ulp . D . 43, 29, 3 pr. i. f. itp .). (99) Ein Beweis dafür, dass die obligatio im klassischen Recht nur als Haf tung des Schuldners erscheint, ist, dass sie in den Quellen als onus bezeichnet wird . Vgl. Fr. Vat. 328. 332; Ulp . D . 16 , 1, 8, 2 ; Pap. D . 46, 1, 48, 1. (100) BONFANTE, Ist. di diritto romano9 360 : « La parola obligatio significa propriamente... ma si usa altresì pel dovere dell'obbligato , e talora, almeno nel linguaggio delle fonti giustinianee pel diritto stesso del titolare (obligatio cre ditoris) » . ( 101) Ulp . D . 46, 1, 5 i. f. (itp.) ; Scaev. D . 39, 5 , 35 i. f. (itp . verum credi torem firmam pignoris obligationem habere); Tryph. D . 49, 15 , 12, 12 (itp.). ( 102) Paul. D . 17 , 1, 45 pr. (itp . obligationem , quae adversus te venditori competit) ; Ulp. D . 21, 2, 51, 3 (itp. cum et aliis quibusdam casibus plenior ad versus heredem vel heredi competat obligatio ) ; C . 4, 65, 30 (itp. nullam obliga tionem ... competere sancimus, entnommen aus Nov. Th. 9, 5, wo es heisst: nec actionem ... competere locatori). Der obrigkeitliche und der prozessuale etc. 247 eine passive und eine aktive Seite. Um diese beiden Seiten der obligatio kenntlich zu machen , sagt man , wenn auch vereinzelt, a obligatio debiti » (103) und « obligatio crediti » ( 104). Es fragt sich nun , warum hat die obligatio eine doppelte Be deutung erhalten ? Wohl deswegen, weil die actio ihren alten Sinn verloren hatte. Die actio verkörpert in der Praxis nicht mehr das Forderungsrecht des Gläubigers, sondern ist das den Prozess einleitende Zwangsmittel für die Geltendmachung des An spruchs geworden, vor allem des obligatorischen, allem Anschein nach aber auch eines dinglichen . Der Schwerpunkt der actio ist in den Prozess verlegt. Der Prozess oder das iudicium ist das ganze ungeteilte gerichtliche Verfahren . Als Bestandteil dieses Verfahrens nimmt die actio am Zwangscharakter desselben Teil. In diesem Zusammenhange kann man daher auch sagen « actione teneri ». Sagt man aber « actione teneri » , so ist auch das Gegenstück dazu erlaubt, nämlich « actione liberari » (105), statt des klassischen « obligatione » bzw . « iudicio liberari » (106 ). . (103) Vgl. hierzu SOLAZZI, RIL 59, 370 ff. (104 ) Vgl. Paul. D . 22, 2 , 6 ( crediti obligatio); Scaev. D . 44, 7, 30 (redisse dicitur in obligationem creditorum ) ; vgl. dagegen Tryph . D . 49, 15 , 12, 12 : Si pignori servus datus... in veterem obligationem revertitur. (105) Iul. D . 2 , 10 . 3 pr. i. f. (... veluti si reus tempore... (actione] liberatus nae ob poenam creditorutione liberatur); um,ges fuerit); Paul. D . 7, 1, 48 pr. (itp. sed actione negotiorum gestorum liberatur) ; Paul. D . 11, 1, 8 i. f. (dominus ( ea actione] liberatur); Ulp . D . 14, 6 , 9 , 4 (itp. non repetunt, qui ob poenam creditorum actione liberantur ; vgl. Pomp. D . 12, 6 , 19 pr. : Si poenae causa eius cui debetur debitor liberatus est, ....solutum repeti non potest); Paul. D . 15 , 3 , 11 i. f. (quamvis [actione] de peculio liberatus sit dominus); Ulp . D . 16 , 3, 1 , 36 i. f. (itp. KRÜGER-FABER et omni actione deposi tarium liberari) ; Ulp. D . 27 , 3, 1, 22 (itp. hac actione conventus furti actione non liberatur, vgl. SOLAZZI, RIL 53, 1253); Ulp . D . leg. I 39, 2 (sed ex empto (actione] liberatus); Iul. D . leg. I 84, 5 ([actione] ex vendito absolvi debet); Scaev. D . 34, 3 , 28 , 3 ( Seium patrem meum liberatum esse volo (ab actione tutelae]) ; Scaev. D . 34 , 3, 28, 4 (Maevia testamento suo alterum ex heredibus (!) suis [actione tutelae] voluit liberari); Tryph. D . 20, 5 , 12 ,1 (liberet debitorem (per sonali actione pecuniae creditae); vgl. SEGRÈ, Studi Scialoja 1, 2792) ; Ulp . D . 39, 4, 1, 4 (( poenali actione ex hac parte edicti liberatur); Afric. D . 46, 3, 38 , 2 (non solum (actione] iudicati, sed etiam ex stipulatu et ipse et fideiussores liberentur). Vgl. I. 4 , 1, 16 (18 ): furti actione liberari; C . 6 , 2, 22, 2 (a . 530 ) : furti actione liberari. (106 ) Gai. 2, 85 ( liberatur obligatione) ; Paul. D . 3 , 6 , 2 ( si quis obligatione liberatus sit); Iul. D . 12, 7, 3; Cels. D . 23 , 3, 58, 1 ; Valens D . 34 , 1, 22, 1 ; 248 Benedikt Frese Dass die Wendung actione teneri sich bereits in vorjustinia nischer Zeit eingebürgert haben muss, wird dadurch nahegelegt, dass sie in einigen mehr oder weniger von Glossemen durchsetzten oder der nachklassischen Zeit angehörigen Quellenschriften ver einzelt anzutreffen ist. Wir begegnen « actione teneri » in einer Stelle gleich zu Anfang des 4 . Buches der Institutionen des Gaius (107), je einmal in der Epitome Gai (108), im Gaiuskommentar von Autun (109), in der Epitome Ulpiani (110 ) und in den Frag Paul. D . 38 , 1, 37 , 1 (liberabitur operarum obligatione) ; Ulp . D . 42, 1, 4 , 7 (obligatione liberatur ); Tryph. D . 46, 1, 69 (liberavit reum promittendi obliga tione) ; Paul. D . 46 , 4, 11 pr. ( liberare dominum obligatione) ; Labeo-Paul. D . 46 , 4, 23 (liberantur obligatione); Paul. D . 50, 17, 115 pr. (si quis obligatione libe ratus sit). C. 2, 3, 5 (ea obligatione... liberatus es); C. 2, 3, 22 i. f.; C . 4, 5, 8 i. f.; C . 4 , 6 , 4 (ut libereris obligatione); C . 6 , 3, 7, 1 i. f. (obligatione operarum liberatur); C . 8 , 27 ( 28 ), 1 ( pignus obligatione liberatum ) ; C . 8 , 42 (43), 12 (non se liberat obligatione); C. 4, 36 , 1, 2 i. f. Bas. 14 , 1, 87 (Hb. 2, 153) obligationis vinculo emptorem libe- oủi nevděporal tñs ảyogaoią rare non potuit (vgl. Ulp. D . leg. I, dywyns. 43, 3 ; Ulp . D . 42, 1, 15 , 7 ). Pap. D . 17, 1, 54 pr. (iudicio venditi liberari potest); Ulp . D . 27, 4 , 3, 1 (ut tu telae iudicio liberetur) ; Cic . Verr. I 5 , 13 (homines... iudicio liberati) ; Cic . Verr. II 2, 28 , 68 ( facile eo iudicio est liberatus) ; Cic. de or. 1 , 36 , 166 (tutelae iu dicio liberaretur ). . (107) Gai, 4 , 4 (teilweise gloss.); verdächtig plane, receptum est, ut (statt Acc. cum Inf.), odio furum , die allgemeine, die rei vindicatio und die condictio mit einbegreifende Wendung « quo magis pluribus actionibus teneantur » (vgl. LENEL SZ 46, 91) : « seltsamerweise » ) und schliesslich hac actione (statt formula , vgl. Anm . 79) teneantur ; ganz anders drückt sich Gaius aus in dem inhaltlich verwandten fr. 55 (54) $ 3 D . 47, 2. ( 108 ) Epitome Gai. 2, 11, 4 . (109) Gai. Fr. August. 2 , 72. (110) Epitome Ulp. 7, 2 : Si maritus divortii causa res amoverit, rerum quo que amotarum actione tenebitur. Der ganze Satz ist schon deshalb als nicht ul pianisch anzusehen, weil im klassischen Recht die actio rerum amotarum allein dem Mann gegen die Frau zusteht (vgl. Schulz, die Epitome Ulpiani 32 ; SIRER, Studi Riccobono 3, 246 ); vgl. auch Ulp . D . 25 , 2, 11 pr. (rerum amotarum teneri) und Ulp . D . 25 , 2, 19 (rerum amotarum iudicio tenebitur, rerum amotarum teneri). Der obrigkeitliche und der prozessuale etc. 249 menta Vaticana (111), zweimal in der Collatio (112) und mehr mals in den sog. Sentenzen des Paulus ( 113). Wie wir gesehen haben, unterschied das klassische Recht einen unmittelbar - obrigkeitlichen Zwang einerseits und einen prozes sualen Zwang andererseits (114). Letzterer beruhte darauf, dass der Richter aufGrund des iussum iudicandi mit Zwangsbefugnissen ausgestattet war. Im justinianischen Recht spielte sich der Prozess in den Formen der extra ordinem cognitio ab, eines Verfahrens, das schon viel früher den Formularprozess verdrängt hatte und zur Regel geworden war. Hiernach ist der Iudex nicht mehr iudex privatus, sondern ein beamteter Richter. Der iudex competens des iustinianischen Rechts ist in seiner Eigenschaft als Richter Reprä sentant der Obrigkeit und Interpret des Rechts, nicht auch Rechts bildner, wie der frühere iudex privatus. Sein officium ist begrenzt, der Schwerpunkt wird in die Natur der actio verlegt. Der richter liche Zwang ist ein unmittelbar-obrigkeitlicher geworden und damit auch der prozessuale Zwang. (111) Paul. Fr. Vat. 102 (et ideo actione rei uxoriae filii nomine teneatur gloss.); verdächtig ist schon die Phrase et ideo , auch erscheint die vorausgegan gene Frage nach dem Konsens des Vaters als abschliessend und macht den her ausgehobenen Satz entehrlich . Ueber sonstige Glosseme in Fr. Vat. 102 vgl. Al BERTARIO , Glossemi nel Fr. Vat. 102, Pavia 1920 und RABEL, SZ 46 , 480. (112) Paul. Coll. 10 , 7, 10 Ulp . D . 16 , 3, 1, 25 Si rem apud te depositam vendideris Si rem depositam vendidisti eamque po eamque redemeris, post perdideris, se - stea redemisti in causam depositi, etiam mel admisso dolo perpetua de- si sine dolo malo postea perierit, tene positi actione teneberis (gloss.). ri te depositi, quia semel dolo fecisti , cum venderes . (113) Z. B . Paul. Sent. 2 , 31, 23 (actione legis Aquiliae tenebitur gloss., denn es müsste ursprünglich geheissen haben « lege Aquilia tenebitur » ; vgl. folgende Paulusfragmente : D . 9, 2 , 28 pr. 30 pr. 33 , 1. 45 SS 2. 4 ; D . 11, 1, 8 ; D . 44, - 7 , 34 pr.) ; Paul. Sent. 1 , 8, 2 (Qui dolum vel metum adhibuit... uterque de vi et dolo actione tenebitur ; schon SIBER , Röm . Recht 2, 235, hält die Stelle für völlig verdorben ). (114 ) Pap . Coll. 2 , 3 , 1 : Per hominem liberum noxae deditum si tantum ad quisitum sit, quantum damni dedit, manumittere cogendus est a prae tore, qui noxae deditum accepit : sed fiducia e iudicio non tenetur . Roma · II 250 Benedikt Frese ANH AN G . QUELLENUEBERSICHT ALS ERGAENZUNG ZU DEN VORSTEHENDEN AUSFUEHRUNGEN . Die Stellen, welche die klassische Ausdrucksweise iudicio teneri ent halten , sind so zahlreich, dass es unmöglich erscheint sie alle aufzu zählen. Interessant ist Scaev. D . 21, 2, 69, 5, wo empti iudicio teneri dreimal hintereinander steht. Iudicio obligari begegnet in den Quellen fünfmal (vgl. Anm . 64 ), officio iudicis teneri zweimal (vgl. Anm . 68) und iudiciis obstringi einmal (Paul. D . 36 , 1 , 37 (36 )). Demgegenüber steht das nachklassische actione teneri. Interpolationsverdächtige Quellenstellen . Quellenstellen betreffend die Verbindung von actio mit teneri bzw . obligari. A . Im allgemeinen . 1) I. 3, 14, 2 item is cui res aliqua utenda da tur, id est commodatur, re obli- vgl. Gai. D . 44, 7 , 1, 3 is quoque, cui rem aliquam com modamus, re nobis obligatur, sed gatur [et tenetur commodati actione] is de ea ipsa re quam acceperit restituenda tenetur 2) I. 3, 14 , 3 vgl. Gai. D . 44, 7, 1, 5 Praeterea et is, apud quem res Is quoque, apud quem rem aliquam aliqua deponitur, re obligatur [et deponimus, re nobis tenetur: qui actione depositi], qui et ipse de ea re quam accepit restituenda te. et ipse de ea re quam restituenda tenetur acceperit netur 3) I. 3, 14, 4 : Creditor quoque qui pignus acce- vgl. Gai. D. 44 , 7, 1, 6 Creditor quoque, qui pignus acce pit re obligatur, qui et ipse de ea pit, re tenetur: qui et ipse de ea ipsa re quam accepit restituenda ipsa re quam accepit restituenda tenetur [actione pigneraticia ] tenetur 4) I. 3, 25, 9: Socius socio utrum eo nomine tantum teneatur [ pro socio aclione] si quid dolo commiserit, sicut is qui deponi apud Der obrigkeitliche und der prozessuale etc. 251 se passus est, an etiam culpae ...nomine: praevaluit tamen etiam cul pae nomine teneri eum (vgl. Gai. D . 9, 2, 8, 1 : vulgo dicitur culpae nomine teneri). 5 ) Paul. D . 2 , 11, 10 pr. Mommsen streicht aus textkritischen Gründen die Worte quia iam actione forte non tenebatur. Ein genialer Einfall ! Der Satz kann aber ebenso gut eine Glosse bzw . Interpolation sein . 6 ) Ulp. D . 8, 5, 15 : Altius aedes suas extollendo, ut luminibus domus minoris annis viginti quinque [vel impuberis], cuius curator [vel tutor] erat, officiatur, efficit: (quamvis hoc quoque nomine actione ipse heredesque teneantur] quia quod alium facientem prohibere ex officio necesse habuit, id ipse committere non debuit, (tamen et adver sus possidentem easdem aedes danda est impuberi vel minori actio, ut quod non iure factum est tollatur). 7 ) Iul. D . 9 , 2 , 42: Qui tabulas testamenti depositas ...delevit..... depositi [actione) et ad eschibendum tenetur... 8 ) Paul. D . 9,4 , 12 ...obligari eum [actione] iudicio, (quae] quod datur adversus eos, qui [servum in potestate habeant aut] dolo fece rint, quo minus servum in potestate haberent rel. Zur Interpolation vgl. Iul. D . 9, 4, 16 ; Paul. D . 9, 4 , 24 ; Iul. D . 9, 4, 39 pr. iudicium ho norarium ) . 9 ) Paul. D . 10 , 4 , 12 , 1 : Et filius familias ea actione tenetur, si facultatem rei exhibendae habet ( itp. BESELER, Beitr . 1, 21). 10 ) Pomp. D . 10 , 4 , 14 i. f. (itp. et ideo ad exhibendum actione tenetur) ; vgl. Ulp. D . 10 , 4, 9, 4 : ad exhibendum eum [actione] teneri (schon die Wortstellung verrät die Hand der Kompilatoren !). 11) Scaev. D . 11, 1, 22 ...an [quasi interrogatoria ] creditoribus ceteris teneatur ? (vgl. Solazzi Bull. 25, 112; LAUTNER, Festschr. f. Ha nausek 53). 12 ) Ulp. D . 12, 2, 13, 2: Idem Iulianus scribit, eum , qui iuravit furtum se non fecisse, videri de toto iurasse , atque ideo neque furti neque (condicticia ) (condictione ) tenetur, quia (condicticia ) (condictione), inquit, solus fur tenetur rel. (vgl. auch BESELER, SZ 45, 462 u . Beitr . 2 , 63 ). 252 Benedikt Frese 13) Ulp. D . 13, 5, 1, 8: Sed et is, qui [honoraria actione] non iure civili obligatus est, constituendo tenetur rel. Gelegentlich hat auch ALBERTARIO (La c. d . honoraria obligatio 13) a . obligari, nicht aber a . teneri für interpoliert erklärt, das hängt zu sammen mit seiner Differenzierung von teneri und obligari. Vgl. Anm . 66 ). 14) Scaev. D . 13, 5, 26 i. f. [actione] de constituta pecunia eum teneri. Vgl. Gai. 4, 171 (ex quibusdam causis... de pecunia certa cre dita et pecunia constituta ) ; Ulp. D . 13 , 5 , 5 , 3 i. f. (tenetur Titius de constituta pecunia ) ; Iul. D . 13, 5 , 23 (de constituta pecunia tenebitur). 15 ) Paul. D . 13, 5 , 29 : Qui iniuriarum vel furti vel vi bonorum raptorum tenetur [actione], constituendo tenetur. 16 ) Ulp. D . 14, 4 , 1 , 3 (itp. Scientiam hic eam accipimus — te nebitur actione tributoria (vgl. Riccobono SZ 34 , 248). 17 ) Paul. D . 16 , 1, 22 : Si mulieri dederim pecuniam , ut eam creditori meo solvat vel expromittat, si ea expromiserit, locum non esse senatus consulto Pomponius scribit, quia (mandati actione obligata ) in rem suam videtur obligari. 18 ) Mod. D . 16, 1, 25 pr. [actione honoraria ) quod iussu tene bitur ; vgl. Ulp . D. 15, 3, 1 SS 4 . 5 ; Paul. D. 15, 3, 2 , 2 ; Ulp. D . 17, 1, 12, 13 ; Ulp. D . 45 , 1, 1 pr.; Ulp. D . 46, 1, 10, 2 ; C . 4, 26 , 13 pr. ( a. 422) ; auch in Scaev. D . 18, 5 , 8 i. f. muss es statt praetoria actione teneri heissen quod iussu teneri. 19) Iul. D . 16 , 3, 15 qui rem suam deponi apud se patitur vel utendam rogat, nec depositi nec commodati [actione] tenetur. Das klassische Gegenstück zu commodati teneri ist commodati libe rari vgl. D . 47, 2, 60 (59). 20 ) Ulp . D . 17, 1, 21, 4 : Iulianus scripsit mandati obligationem consistere.... etiam pro ea parte, qua heres sit, obligatur [mandati ac tione] et obligut. 21) Iul. D. 17, 1, 31 : Si negotia mea mandavero gerenda ei, qui mihi [actione] ( intra annum ins. Hal. Vulg. cum Bas.) in quadru . plum tenebatur rel.; vgl. Paul. D . 47, 8, 1. 22 ) Afric. D . 17, 1, 34 pr. ...et in proposito igitur dicendum [actione mandati] obligatum fore procuratorem rel. Vgl. hierzu meinen Der obrigkeitliche und der prozessuale etc. 253 Aufsatz « Das Mandat in seiner Beziehung zur Prokuratur », in den Studi Riccobono . 23) Scaev. D. 17 , 1 , 62, 1 i. f. ....an (actione mandati] teneretur. respondit teneri. 24) Ulp. D . 19, 2, 19, 5 ...verius est ex conducto eum teneri [ et ad exhibendum actione, sive scit sive ignoraverit) rel. (vgl. BESELER , Beitr. 1, 42). 25) Pap. D . 19, 5, 9 : Ob eam causam accepto liberatus, ut no men Titii debitoris delegaret, si fidem contractus non impleat, [incerti actione] (condictione) tenebitur rel. (vgl. BESELER, Beitr . 2, 163 f.; DE FRANCISCI, Evváhaayna 1, 239 ; PARTSCH SZ 35, 339). Ulpian kennt im gleichen Fall nur die condictio (vgl. D . 12, 4, 4 ). 26 ) Ulp . D . 23, 3, 38 : Sane videndum est, an marito mulier, quae iussit accepto ferri obligetur. et putem obligari (mandati actione] et hoc ipsum in dotem converti, quod mulier mandati iudicio obligata erit, rel. (Vgl. Cels. D . 12, 1, 32 ... an mihi obligaris ?... propius est ut obligari te existimem und Ulp. D . 47, 2 , 43, 8 ...an furti obligetur. et non puto obligari eum ). 27 ) Marcell. D . 26, 7 , 21 ... Marcellus respondit secundum ea quae proposita essent [actione] (formula ) de peculio et de in rem verso patrem teneri rel.; vgl. Gai. 4 , 74 ; C . 4 , 26 , 1 (a. 196 ) (« iudicio de peculio et de in rem verso »). 28) Tryph. D , 26 , 7, 55, 1 : Sed si ipsi tutores rem pupilli furati sunt, videamus, an ea (actione] ( formula ) , quae proponitur ex lege duodecim tabularum adversus tutorem in duplum , singuli in solidum teneantur rel. 29) Ulp . D . 29, 4, 12 , 1 : Heredem eius, qui omissa causa te stamenti ab intestalo possidet hereditatem , in solidum (legatorum ac tione] teneri constat (vgl. WLASSAK, SZ 31, 225 ff. u . SZ 42, 401 : « der allgemeine obligatorische Legatsanspruch ist nachklassischen Ursprungs » ) . 30) Ulp . D . 42, 1, 6, 2 : Qui iudicati bona auctoritate sua di straxit, furti [aclione] et vi bonorum raptorum ei tenetur. 31) Scaev. D . 45 , 1, 122, 1 ...et nihilo minus (actione ex stipu latu ] Callimachus de pecunia domino Stichi teneatur. Da es sich um 254 Benedikt Frese certa pecunia handelt, entsteht hier nicht die actio ex stipulatu , sondern die actio certae creditae pecuniae als Anspruch und ist die condictio als Formel zuständig. (Vgl. Ulp . D . 12, 1, 24 ). A . M . LENEL , Ed. 284, der die a . certae creditae pecuniae und die condictio für ein und dasselbe hält. 32) C . 2 , 4 , 3 (a. 223 ) et si apud iudicem negabit se [actione] teneri (vgl. Fr. Vat. 94 ait enim se propterea non teneri; C . 8, 40 (41) , 12 Blanditus tibi est, qui non teneri te persuasit). 33) C . 2, 18 (19), 4 (a . 201) : Qui pupillae negotia tutoris man dato suscepit, pro tutore negotia non videtur gessisse, sed (negotiorum gestorum actione] (tutor ) pupillae tenebilur (vgl. Ulp . D . 26 , 7, 5, 3 : videtur enim (sc. tutelam ) gessisse qui per alium gessit und Tryph . D . 26, 7, 55 pr.). 34) C. 4, 24, 3 (a. 222) ...in rationem exonerandi debiti compu tare necesse habet et, si agrum deteriorem constituit, eo quoque nomine (pigneraticia actione] obligatur; C . 4, 24 , 7 pr. (a. 241) ...in rationem deducere cogitur et, si dolo vel culpa rem suppositam de teriorem fecerit, eo quoque nomine (pigneraticia actione] tenebitur. In beiden Stellen ist die Rede von dem , was in iudicium venit , deshalb ist die Erwähnung der actio pigneraticia unangebracht; « ratio » ist ein Ausdruck , der häufig gebraucht wird für die Berücksichtigung dessen , was « in iudicium venit » . 35 ) C. 4, 26 , 5 (a. 223): Nulla res prohibet filios familias si pro aliis... fideiusserint [actione adversus eos competenti] teneri (vgl. Bas. Suppl. Zach. 37 zu C . 3, 32, 8 : Xatézetai tais åprogovoais dyoyais = tenetur competentibus actionibus). 36 ) C . 5, 28 ,4 i. f. (a. 224) (itp. der Schlusssatz nullo vero ex his interveniente – protutelae actione tenentur; vgl. PETERS, SZ 32, 257 f.; die Klassiker sagten anscheinend pro tutore teneri : vgl. Ulp . D . 27, 5, 1, 7). 37) C . 6, 2, 12 pr. i. f. (a. 293) furti teneri convenit (actione]. 38 ) C. 8, 13 (14), 14 (a. 293) (personali] obligatos sibi. 39) C. 8, 17 (18 ), 4 (3) (a. 215 ) [personali actione] eum habuit obligatum (vgl. Berger, Teilungsklagen 103 f.: « actio personalis ist eine spezifisch justinianische Ausdrucksweise » und GUARNERI-Citati, In dice delle parole e frasi ritenute interpolate nel Corpus iuris s. v. actio). Der obrigkeitliche und der prozessuale etc. 255 40) C . 8 , 44 (45), 2 (a . 205) (itp . der Schlusssatz nudo aulem pacto interveniente minime (!) donatorem hac (!) actione teneri certum est; vgl. jedoch C . 2, 3, 10 (a. 227) : dici solet ex pacto actionem non nasci). 41) C . 9, 51, 4 [actione tutelae administratae] tibi non tenetur. 42) Nov. 123 cap. 25 : åyoy) Éavtous évoyous noinoovoiv = actio nibus semet ipsos obligatos fecerint; vgl. Nov. 4 cap. 2 : si (creditores) quosdam habuerint homines ipsis sibimet obligatos et qui hypothecariis actionibus sibi teneri possint. 43 ) Theophil. Paraphr. zu vgl. I. 3 , 27, 2 I. 3, 27, 2 : T) tutelae ratexóạevoi åyoy ) = tu - Tutores quoque, qui tutelae iudicio telae actione tenentur tenentur 44) Theophil. Paraphr.zu I. 3, 27, 2 : Évojov čzelt tutelae actione = pupillus cum tutore habet tutelae obligatum habet tutelae actione actionem vgl. I. 3, 27, 2 B. Einzelfälle . 1) actione teneri in Form einer rhetorischen Frage Ulp. D . 10 , 4, 9, 1 (itp. qua actione possum teneri ?) Ulp. D . 17, 1, 8 pr. (itp . qua actione mihi teneatur ?) Paul. D . 19 , 5 , 5 pr. itp . qua actione mihi teneris , quae situm est). Paul. D. 47, 2, 21, 7 (itp . Quid ergo ? qua actione tenebitur ?). 2 ) nulla actione teneri Pap. D . 5 , 3, 50, 1 itp. quamvis enim stricto iure nulla te neantur actione; vgl. BESELER , Beitr. 4, 43). Ulp. 41 lib . ad Sab . D . 19, 5 , 14 pr. itp. nulla tenetur ac tione statt furti non tenetur, denn Ulpian hat im 41. Buch ad Sabinum vom furtum gehandelt). Ulp. D . 27, 6, 12 (itp . nulla eum actione teneri). C. 5 , 28, 1 (a. 207) (itp. nulla actione tibi tenetur) vgl. Mod. D . 27, 1 , 13, 12 (inhaltlich verwandt mit Ç . 5 , 28, 1) : ipso iure non teneris . Nov . Th . 9 , 2 : nulla tenebitur actione. 256 Benedikt Frese 3) aliqua actione teneri Tryph. D . 12 , 6, 64 : Si quod dominus serro debuit manu misso solvil, (quamvis existimans ei aliqua teneri actione, tamen ] re petere non poterit rel. Der Ausdruck « aliqua actio » ist schwerlich klassisch ; anstössig ist auch quamvis – tamen . 4 ) eadem actione teneri Paul. D. 17, 1, 58 pr. i. f. (itp. eadem actione teneri; vgl. Frese, Defensio, solutio, expromissio, in Studi Bonfante 4, 408 Anm . 46). Ulp . D . 26 , 2 , 19, 2 (itp. u . a . et hic eadem actione tenebitur , passt schlecht zum nachfolgenden tutelae iudicio tenebitur). Gai. D . 44 , 7, 5 , 3 (itp . eadem actione tenetur, qua debitores creditoribus ; vgl. RICCOBONO, Annali del seminario giuridico Palermo 1917 p. 285 ; ALBERTARIO, Ancora sulle fonti dell'obblig . rom . (1926) p. 37). Schol. Bas. 14 , 1, 31 (Hb. 2, 118 ): tý ajti xaraoyeunoetai dyoy ) . 5 ) hac actione teneri itp. für hac formula teneri (vgl. Fr. de formula Fabiana 2 : quis te neatur hac formula , und 7 : tenebitur hac formula ). Vgl. WLASSAK , SZ 42, 410 : « haec actio ist offenbar die mit der Injurienformel begrün dete Prozessobligation ». Iul. D . 9, 4, 39, 4 hac [actione] non tenebitur. Ulp . D . 11, 3, 9 pr. apud Iulianum libro nono digestorum quaeritur, an hac [actione] teneri possit . Ulp. D . 11, 3 , 13, 1 hac [actione] tenebitur. Ulp. D . 11, 6, 1, 2 Is autem tenetur hac [actione] qui re nuntiavit. Ulp . D . 47, 7, 7 SS 2. 4 hac [actione] non tenetur ; hac [ac tione] tenetur. Ulp. D. 47, 8 , 2 SS 12. 18 hac [actione] tenetur; hac [ac tione] non tenebitur. Ulp . D. 47, 9, 3, 4 hac [actione] tenetur. 6 ) noxali actione teneri statt noxali iudicio teneri Paul. D. 9, 4, 22, 1. Paul. D . 11, 1, 13, 1. Paul. D . 19, 2 , 15 pr. C . 6, 2, 21, 3 (a. 530). Iul. D . 9, 4, 39, 1 quamvis noxali (actione] obligetur. 7 ) temporali actione teneri Paul. D . 3, 5 , 18 (19). Der obrigkeitliche und der prozessuale etc. 257 Pomp. D . 4, 4, 50. Ulp . D. 13, 5, 18, 1 ; (schon von Savigny, System 5, 402 für itp . erklärt). Paul. D . 16 , 1, 24, 1. Ulp. D . 26 , 7, 9, 2. Der temporalis actio begegnen wir noch in folgenden mehr oder weniger verdächtigen Stellen : Paul. D . 4 , 6 , 31; Paul. D. 15 , 2, 2 pr. ( idemque dicendum in omnibus temporalibus actionibus !) ; Paul. D . 44 , 7, 6 ( In omnibus temporalibus actionibus !) ; Paul. D . 27, 7, 8, 1 i. f.; Pomp. D . 36 , 1, 72 (70), 2 ; tit. I. 4, 12 ; C . 1, 20 , 2 (a. 529). Der Aus druck temporalis actio ist um so mehr zu beanstanden , als der Ausdruck temporalis exceptio nachweislich einer späteren Zeit angehört. Im klas sischen Recht sagte man actio quae certo tempore finitur (arg. Marcell. D . 44, 3, 2). Zuweilen verdeckt die temporalis actio eine befristete causa , z. B. die Sponsionsbürgschaft. Man vergleiche folgende Stellen miteinander: Paul. D . 3, 5, 18 (19) vgl. Ulp . D . 3 , 5 , 7 (8 ) pr. sicut is, qui (temporali actione] te- si ex causa fuit obligatus, nebatur, etiain [ post tempus exactum ] negotiorum gestorum [actio ne] id praestare cogitur (vgl. unten quae certo tempore finieba tur, et tempore liberatus est, ni hilo minus negotiorum gestorum II B ) [actione) erit obligatus. idem erit dicendum et in ea causa , ex qua heres non teneretur Ulp. D . 26, 7, 9, 2 (vgl. § 1) Item si (temporali actione] fuit obligatus tutor, dicendum cum esse tretelae iudicio est lo - vgl. Tryph. 46, 1, 69 Tulor datus eius filio , cui ex [ fi deiussoria ] causa obliga tus erat... quamvis tempore li beratus erit, tamen tutelae iudicio eo nomine tenebitur, item heres eius, quia cum eo ob tutelam ... agitur rel. · Zuweilen begegnet in den Quellen auch der Ausdruck temporariu actio , wahrscheinlich interpoliert für temporaria formula : Ulp . D . 11, 3, 13 pr. Haec [actio] (formula ) perpetua est, non temporaria . Ulp. D . 12 , 2, 9, 3 : Si is, qui temporaria (actione] (formula ) mihi obligatus erat, ... tempore non liberatur, quia post litem contesta tam cum eo perpetuatur adversus eum (obligatio ] (actio ) . Die Litiskon testation ist eben die mit der Formel begründete Prozessobligation . Ulp. D . 15 , 2, 1, 1 temporaria esse incipit, id est annalis (sc . formula ). 258 Benedikt Frese Ulp . D . 15 , 2, 1, 3 : Merito autem temporariam ... fecit prae tor [actionem ] ( formulam ). Das Adjektiv temporarius, - a , -um treffen wir auch noch in folgen den Stellen an : Pap. D . 12, 6 , 56 (temporaria ... exceptionis defensio ); Mod . D . 26 , 7, 32, 6 ; Ulp . D . 43, 8, 2 , 44 (interdictum temporarium ) ; Ulp. D . 43, 20 , 1, 44 (possessio temporaria ); Coll. 7, 4 , 1. 8 ) in factum actione teneri Zur actio in factum vgl. ERMAN, SZ 19, 295 ff. und SZ 23, 445 ff. und DE FRANCISCI, Evváriayna I. II. passim . Die actio in factum ist überaus beliebt im justinianischen Recht (vgl. C . 1, 2 , 21, 1 : per in factum actionem , cuius tenor in multis et variis iuris articulis saepe est ad missus). Sie hat meist den Charakter einer subsidiären Klage, ersetzt aber auch eine formula in factum (einmal auch eine formula ficticia ) und tritt hin und wieder an die Stelle einer actio utilis (vgl. I. 4, 1, 11; Gai. D . 11, 7, 7, 1; Pap. D . 23, 3, 26, 3) oder eines obsolet gewordenen Interdiktes (vgl. Ulp . D . 42, 8, 10 $ S 2. 3 und zu Iul. D . 6, 1, 52 LEVY, Privatstrafe und Schadensersatz 90 ) . I. 4, 3, 16 (itp. Krüger von sed si non ab bis in factum ac tione teneri). Paul. D . 3, 6 , 7, 2 i. f. et ipse ex hac parte edicti [in fac tum actione] tenetur . Gai. D . 4, 7, 1 pr. (itp. in factum actione) ; die actio in fac tum ist hier um so auffallender, als in den Institutionen des Gaius nur die formula in factum begegnet. Vgl. Gai. 4, 46. 47. 60. 106 , aber auch Gai. D . 11, 7, 9 (KRÜGER - ERMAN : in factum ( formula ) agere : per quam ; Fr. de formula Fabiana 1 ; Ulp. disp . fr. ; Pap. Fr. Vat. 14 (iudicium ab aedilibus in factum ... proponitur) ; Ulp. D . 2, 7, 5, 3 (Hoc iudicium in factum est). Ulp. D . 9, 2, 49 pr. i. f. (itp. et ideo in factum actione te nebitur. Ulp. D . 11, 7, 2, 2 i. f. itp . KRÜGER -LENEL qui hoc fecit in factum actione tenetur et poena pecuniaria subicietur). Ulp. D . 39, 2 , 4 , 2 : In tamen is, qui non admittit, etiam pignoribus a magistratibus coerceatur ? non puto , sed ſin factum ( c tione] ( ficticia formula) tenebitur. Ulp. D . 42, 8, 10, 2 teneri eum [in factum actione] (inter dicto ) . Ulp. D . 42, 8, 10 , 3 an ſin factum actione] (interdicto ) le neatur. Ulp . D . 48, 10 , 25 : Qui nomine praetoris litteras falsıls red didisse edictumve falsum proposuisse dicetur, ex causa [actione in factum ) poenali tenetur rel. (vgl. zur causa poenalis Ulp. D . 46, 3, 7 ) . Der obrigkeitliche und der prozessuale etc. 259 Gai. D . 50, 13, 6 ideo videtur quasi ex maleficio teneri [in factum actione]; vgl. aber I. 4, 5 pr. = Gai. D . 44, 7, 5, 4 ideo videtur quasi ex maleficio teneri. 9 ) utili actione teneri Ulp. D. 5 , 3, 13, 8 i. f. utili (sc, actione) tenetur (itp . FABER, Rat. ad h . 1.). Ulp . D . 15 , 1 , 9 , 4 quo nomine vel tutelae vel negotiorum gestorum [vel utili actione] tenebitur ? Vgl. ALIBRANDI, Opere 1 , 584 . Tryph . D . 20 , 5 , 12, 1 (itp . u . a . utili actione tenetur) ; zur In , terpolation vgl. RICCOBONO, Bull. 8, 188. Pomp. D . 46, 3, 66 (itp . der Schlusssatz sed pupillus - utili actione tenebitur; vgl. ALBERTARIO , RIL 46, 869); abweichend SIBER, SZ 53, 472. 10 ) furti actione teneri Ulp. D . 47, 2 , 14, 1 Paul. D . 47, 2, 21 pr. Ulp. D . 47, 2, 17 SS 1. 3 Pap. D . 47, 2, 82 (81) Paul. D . 47, 2, 83 (82) 88 2. 3 C . 6, 2, 20, 1 (a. 530) Ulp. D . 47, 2 , 19, 5 Ulp . D . 47, 2, 33 Paul. sent. 2, 31 Paul. D . 47, 2, 20 , 1 C. 6, 2, 21, 4 (a. 530 ) C . 8, 4, 11, 1 (a. 532) u. a. St. Viel häufiger als furti actione teneri begegnen wir in den Digesten der Wendung furti teneri bzw . obligari. So sagt z. B . Ulpian in fr. 43 D . 47, 2 achtmal furli teneri, einmal furti obligari und einmal furti obstringi und in fr. 52 D . 47, 2 sogar vierzehnmal furti teneri. Dies deckt sich mit dem Sprachgebrauch bei Terenz, Plautus, Gellius und Gaius : Ter. Eun. 809 (sed furti alligare) ; Plaut. Poen . 737 (homo furti sese adstringet); Plaut. Rud. 1260 ; Gell. 6, 15 , 2 (furti se obligarit); Gell. 11, 18, 20 (furti tenetur); Gell. 11, 18, 21 (furti obstringitur); Gai. 3, 196 (furti obligatur), 202 (furti tenetur) und 209 (tenetur etiam furti); Paul. D. 47, 2, 67 (66 ), 2: furti teneri veteres responderunt. Wir werden wohl annehmen dürfen , dass dieser letztere Sprachgebrauch auch der klassische ist. 11) contraria actione teneri Paul. D . 13, 6, 22 i. f. ... [contraria autem commodati tunc eum teneri, cum sciens talem esse servum ignoranti commodavil ] Zur Interpolation vgl. GRADENWITz, Interpolationen 120 f.; KÜBLER, SZ 38, 109; HELDRICH, Das Verschulden beim Vertragsabschluss 37; BIONDI, Iud . b . f. 102. Ulp. D . 13, 7, 1, 2 i. f. ... (tenebitur tamen pigneraticia con traria actione qui dedit, praeter stellionatum quem fecit] Zur Interpo 260 Benedikt Frese lation vgl. BESELER, SZ 43, 429; HELDRICH, Das Verschulden beim Ver . tragsabschluss 34. 12 ) utraque actione teneri Paul. D . 9, 2, 48 : Si servus ante aditam hereditatem dan num ... dederit et liber factus ... [utraque actione] tenebitur. Hier greift bekanntlich eine besondere Klage Platz (vgl. Titel D . 47, 4 ), die Kompi latoren geben aber nicht nur diese, sondern auch die actio legis Aquiliae unter Verletzung des klassischen Sprachgebrauches lege Aquilia teneri. Paul. D . 27, 3, 2 , 1 : Quod si furandi animo fecit, etiam furti tenetur. [utraque autem actione obligatur)... (vgl. Ulp . D . 27, 3 , 1 , 22 tutorem , qui intercepit pecuniam pupillarem , et furti teneri Pa pinianus ait). Ulp . D . 47, 1, 2, 5 : Item si quis ancillam alienam subripuit et (flagitaverit] ( flagitavit ), [utraque actione tenebitur, nam ] et servi corrupti agi poterit et furti. 13) actionibus teneri Gai. 4, 4 (vgl. Anm . 107). Gai. D . 4 , 7 , 3 , 2 (itp. hactenus istis actionibus tenetur ; vgl. BESELER , Beitr . 3, 91. 131). Die Interpolation ist schon daraus ersichtlich , dass das in den istae actiones mit einbegriffene interdictum quod vi aut clam im klassischen Recht doch keine actio ist ! Ulp. D . 7, 1, 13, 2 ... lege Aquilia tenetur et interdicto quod vi aut clam , ut Iulianus ait: nam fructuarium quoque teneri [his ac tionibus nec non ] furti certum est (vgl. Ulp. D . 47, 2, 46, 6). Ulp. D . 13, 7, 13 pr. ... scripsit Iulianus et est rescriptum ob hanc conventionem pigneraticiis actionibus ] teneri creditorem rel. • Vgl. BIONDI, Iud . b. f. 235 . Scaev. D . 18 , 5 , 8 ... respondit Titium , si non ipse vendidit, non idcirco actionibus civilibus teneri, quod serro vendente subscrip serat, sed servi nomine praetoria actione teneri. Ich rekonstruiere die Stelle folgendermassen : ... respondit Titium quod iussu teneri; vgl. Ulp. D . 15 , 4, 1, 4 ; Ulp. D . 15 , 4, 1, 9 (in ipsum sc. procuratorem potius dandam actionem idem Labeo ait). Ulp . D . 47, 1 , 1 pr. : civilis constitutio est poenalibus actio nibus heredes non teneri ... sed quamvis furti actione non teneantur, attamen ad exhibendum actione teneri eos oportet ... sed enim et vin dicatione tenebuntur ... (itp . BESELER , Beitr. 1, 43 ; 2, 134) Ulpian hat im 41. Buch ad Sabinum vom furtum gehandelt und nicht von den actiones poenales im allgemeinen ; anstössig ist quamvis - attamen , vindicatione teneri u. and . Ulp. D . 47, 1, 2, 4: Item si quis subreptum flagello ceciderit, [duabus actionibus] tenetur furti et iniuriarum [et si forte hunc eundem Der obrigkeitliche und der prozessuale etc . 261 occiderit, tribus actionibus tenebitur). Die Anknüpfung mit « et si forle » ist verdächtig . 14 ) actionibus obstringi bzw . adstringi Marcell. D . 23, 3, 59, 1 ...nam mulieri in hoc tenetur, ut hereditatem restituendo transferat actiones (et quas habet et quibus est obstrictus), quas transferre ad alium , quam cui debet fideicommis sum , non potest rel. Das doppelte quas ist unerträglich und der eingeklammerte Satz wohl als ein Glossem anzusehen . Man vergleiche hiermit Paul. D . 36 , 1, 41 (40) pr. : Quamvis senatus de his actionibus transferendis lo quatur, quae iure civili heredi et in heredem competunt, tamen honorariae actiones transeunt rel. sowie Paul. D . 36 , 1, 37 ( 36 ) : ... et tamen heres iudiciis quibus conventus est aut stipulationibus quibus necesse habuit promittere, obstrictus manebit. Pap. D . 36 , 1, 55 (53): Non est cogendus heres suspectam adire hereditatem ab eo, cui libertas a legatario , hereditas ab herede relicta est, cum status hominis ex legato pendeat et nemo se cogatur adstringere (hereditariis actionibus (hereditati) propter legatum rel. Es liegt auf der Hand, dass Papinian hier vom prätorischen Zwang zur Erbantretung gesprochen hat und dass es daher heissen musste se adstringere hereditati, nicht aber hereditariis actionibus. Vgl. dazu Ulp . D . 29, 2, 6, 4 (obliget se hereditati); Paul. D. 29, 2, 22 (obstringat se hereditati); Pomp. D . 29, 2, 78 (hereditati se alligasset). Pap. D . 50, 1, 17, 15 : (Fideiussores] qui salvam rem publicam fore responderunt (spoponderunt edd.) et qui magistratus suo periculo nominant, (poenalibus actionibus] (poenis ) non adstringuntur, in quas inciderunt hi, pro quibus intervenerunt. Die sonst üblichen klassischen Wendungen poena bzw . poenis teneri (vgl. Gai. 3, 194 ; Epit. Ulp. 16 , 3) und in poenam incidere (vgl. SECKEL HEUMANN, 8. v. incido) machen die Interpolation nahezu gewiss. Vgl. auch Paul. D . 46, 1, 68 pr.: (Fideiussores] magistratuum in poenam vel mul tam , quam non spopondissent, non debere conveniri decrevit. II Der prozessuale Zwang im klassischen Recht und der nachklassische Aktionenzwang. A . Der prozessuale Zwang im klassischen Recht. Der prozessuale Zwang verwirklicht sich im klassischen Recht nur im iudicium oder durch das officium iudicis. Davon zeugen folgende Beispiele : Benedikt Frese 262 Gai. 3 , 111 sed quidquid consecutus erit, mandati iudicio nobis restituere cogetur. Paul. D . 2, 13, 9 pr. i. f. sed iudicio tutelae solet cogi edere ( sc. rationes ). Pap. D. 13, 7, 42 : Creditor iudicio, quod de pignore dato proponitur, ut superfluum pretii cum usuris restituat, [iure) cogitur rel. Ulp . D . 17, 1, 8 , 5 empti iudicio necesse habebit praestare. Paul. D . 17, 1, 26 , 8 : Faber mandatu amici sui emit servum decem et fabricam docuit, deinde vendidit eum viginti, quos mandati iudicio coactus est solvere rel. Paul. D . 17, 1, 45, 5 cogimur eam (sc . actionem ) prae stare iudicio mandati. Pap. D . 17, 1, 56 , 4 i. f. iudicio mandati restitui ne cesse est. Paul. D . 17, 1, 59, 1 mandati iudicio conventum ...resti tuere cum fructibus cogendun . Paul. D . 17 , 2, 74 i. f. sed societatis iudicio cogitur rem communicare. Scaev. D . 19, 1, 48 quaeritur, an empti iudicio cogendus sit ostendere. Ulp . D . 19, 2, 9, 4 iudicio locati casum praestare non co geris. Pap. D . 22, 1, 4 pr. quia non est verisimile plus venditorem promisisse, quam iudicio empti praestare compelleretur . Ulp. D . 43, 24 , 11, 10 i. f. fructus medio tempore perceptos venditi iudicio praestare cogendum ait (sc. Iulianus). Mod. Coll. 10 , 2, 1 : Commodati iudicio conventus etiam culpam praestare cogitur. C. 4, 35 , 14 i. f. (a. 294) ad parendum placitis eos mandati iudicio conventos bona fides urguet . C . 4, 65, 9 i. f. (a. 234 ) bonae fidei iudicio ei quod placuit parere cogitur. Gai. 2 , 220 nam officio iudicis coheredes cogi posse exi stimant soluta pecunia luere eam rem . Paul. D . 6, 1, 58 respondit, non oportere iudicem cogere. Ulp . D . 7, 1, 7, 2 reficere quoque eum aedes per arbitrum cogi Celsus scribit. Ulp. D . 7 , 1, 7, 3 Cassius quoque scribit ... fructuarium per arbitrum cogi reficere, quemadmodum adserere cogitur arbores. Ulp . D . 19, 2 , 19, 6 officio enim iudicis continetur , ut cogat eum aditum et facultatem inquilino praestare ad .... Der obrigkeitliche und der prozessuale ete. 263 Iavol. D . 33, 2 , 30, 1 ... ita, ut iudex cogat heredem ... eum liberare. Ulp . D . 37, 7, 1 pr. i. f. ad collationem dotis per arbi trum familiae erciscundae posse compelli. Alf. D . 39, 3 , 24 pr. quaesitum est, an per arbitrum aquae pluviae arcendae posse cogi. B . Der nachklassische Aktionen zwang. Als Beispiele mögen dienen : Paul. D . 2 , 13, 9 pr. non cogitur a praetore ( per metum in factum actionis rationes edere. Vgl. Pap. D . 5 , 3, 49 ( itp. citra metum exceptionis ; BESELER, Beitr . 2, 38 ); Mod . D . 13, 7, 38 (itp. propter metum pigneraticiae actionis) ; Ulp. D . 24, 1, 45 (itp . citra metum se natus consulti ; BESELER, Beitr. 2 , 40); Pomp. D . 38, 1, 4 (itp. sinemetu exceptionis ; KRÜGER-ALBERTARIO ). Paul. D . 3, 5 , 18 (19) sicut is, qui temporali actione teneba tur, etiam post tempus exactum negotiorum gestorum actione id prae stare cogitur. Verdächtig die Anknüpfung mit sicut, temporalis actio , tempus exactum u . a. Paul. D . 6 , 1 , 43 [ in factum autem actione] petitori extra ordinem subvenitur, ut is, qui hoc fecit, restituere eos ( sc . lapides) compellatur. Das Aktionensystem und die cognitio extra ordinem schlies sen doch einander aus ! (Vgl. Marc. D . 48, 10 , 7 : ne quidem omnino iure civili neque iure praetorio neque extra ordinem ). Iul. D . 6 , 1, 52 sed ſin factum actio] adversus eos reddi de bebit, per [quam ] restituere cogantur. Das interdictum quem fundum ist hier ersetzt durch actio in factum ; vgl. Levy, Privatstrafe und Schadensersatz 90. Gai. D . 11, 7, 7 pr. loci pretium praestare cogitur (per in factum actionem ]; vgl. DE FRANCISCI Evválarua II 108 ; a . M . WIEACKER SZ 53, 5134. Ulp . D . 13, 6, 7, 1 ... [si forte damnum dedit alter, quod hic qui convenitur commodati actione sarcire compellitur). Vgl. EISELE SZ 13, 137. Paul. D . 17, 2 , 65 , 3 ... commodum autem communicare co getur [actione pro socio ). Afric. D . 19, 2, 33 ... nec ultra [actione] ex conducto prae stare cogeris ; LENEL , SZ 51, 43 erklärt den ganzen Satz für itp . Pap. D . 20 , 1, 2 Cum praedium pignori daretur, nominatim , ut fructus quoque pignori essent, convenit. eos consumptos bona fide emptor utili Serviana restituere non cogetur. Die Stelle ist sicher in 264 Benedikt Frese terpoliert. Die Gründe, welche für die Annahme einer Interpolation spre chen , sind folgende : 1) Die Klassiker sagten bekanntlich nicht « fructus consumptos suos facit » , sondern fructus suos facit. 2) Der Gebrauch von bona fide emptor steht auf einer Linie mit dem von bona fide pos sessor, der in der Kompilation öfters an Stelle des bonae fidei possessor gestreten ist: man vergleiche nur C . 6 , 2 , 21 SS 1. 3 -5 (a . 530) und zahl reiche Basilikenscholien . 3) Im Originaltext hat Papinian wahrscheinlich vom bonorum emptor gehandelt, gegen den der Pfandgläubiger als « Se paratist » klagend vorgeht. 4) Die utilis Serviana ist typisch kompilato risch (vgl. C. 6 , 43, 1, 1 (a. 531)). Die dingliche Pfandklage hat im ju stinianischen Recht vier Namen, nämlich 1. hypothecaria 2. quasi Ser viana 3. utilis Serriana 4 . pigneraticia in rem . 5 ) Der Restitutions zwang wurde im klassischen Recht nicht mittels der Klage, sondern in iudicio durch den Richter realisiert. Ulp . D . 23, 4, 4 ... cogendum [de dote aclione] fructus reddere Pomp. D . 27 , 7 , 1 , 1 i. f. [et utili actione hoc reddere com pellitur] Vgl. BESELER, Beitr. 1, 50. Ulp . D . leg. I 75 , 4 (itp . per quam actionem compellat he redem experiri) Lic . Ruf. D . leg. II 62 i. f. (itp . itaque utilis actio hoc casu competit, ut is, ad quem emolumentum hereditatis pervenerit, et fidei commissum praestare compellatur ). Verdächtig utilis a . competit, emolumentum und der in Fideikommisssachen nicht anwend bare Actionenschutz ) ; vgl. auch SECKEL -HEUMANN S . v . utilis und BESELER , Beitr. 3 , 17 . Pap. D . 35, 1, 73 ... postea in Asiam pervenerit, Sempronio heres, quod ex stipulatu cautionis (sc. Mucianae) consegni potest, [utiti actione] praestare cogitur rel. Ulp . D . 39, 3, 1, 2 i. f. aquae pluviae [actione] (arcendae formula ) cogetur tollere Paul. D . 39, 3, 2 , 5 non posse me vicinum cogere aquae pluviae arcendae [actione] (formula ) (vgl. die Inskription zu Gai. D. 39, 3, 13 : ud edictum praetoris urbani titulo de aquae pluviae arcendae formula ) ). Paul. D . 39, 3, 2, 5 nam hac [actione] (formula ) neminem cogi posse Pap. D . 39, 5 , 28 (itp. si hoc minime faciat et creditores contra patrem veniant, cogendam eam per actionem praescriptis verbis patrem adversus eos defendere) vgl. GRADENWITZ, Interpolationen 130 . Pap . D . 41, 2 , 49, 2 (itp. sed per actionem mandati ea ce dere cogitur). Vgl. meinen Aufsatz « Das Mandat in seiner Beziehung zur Prokuratur », in den Studi Riccobono. Der obrigkeitliche und der prozessuale etc. 265 Ulp . D . 42, 5 , 17 pr. quod reddere eum , si viveret, funeraria (actione] (formula ) cogi oporteret (vgl. Ulp. D . 11, 7, 14, 6 : Haec[actio] (formula ) quae funeraria dicitur). C. 2, 55 (56), 4 , 6 (a . 529 ) et sic omnimodo per actionem in - factum eum compelli ea facere quibus consensit. C . 3 , 31, 7 pr. i . f. cum mixtae personalis actionis ratio hoc respondere compellat. Für itp. erklärt den Satz mit Recht ARANGIO -Ruiz (vgl. KRÜGER Add.). C . 3, 36 , 14 (itp. per actionem praescriptis verbis). Vgl. KNIEP, Praescriptio und Pactum 90 : « Merkwürdig ist auch noch die Verbindung praeses provinciae per actionem q brescriptis verbis com pellet. Sie macht ganz den Eindruck, als ob per actionem praescriptis verbis erst später eingeschoben wäre ». C . 4, 10 , 13 (a. 294 ) : Eum , cui mutuam dedisti pecuniam , ad solutionem urguere [ competenti ] debes [actione]. C . 4, 25 , 1 (a . 212 ): quod si ea (actio ] (formula ) locum non habet, si quid in rem tuam versum probabitur, [actione] (formula ) in eam rem proposita cogeris exsolvere. C. 5,51, 11 (a . 294): Tutor post puberem ... aetatem puellae... tutelae [actione] (iudicio ) totius temporis rationem praestare cogitur (vgl. hierzu Gai. I, 191). C . 8, 16 (17), 4 (utilibus actionibus] satis tibi facere... com pelletur... C. 8, 30 (31), 3 (a . 293) .... restitui tibi res pacto pignoris obligatas providebit, cum etiam edicto perpetuo, [actione] (formula ) proposita pec nia soluta creditori vel si per eum factum sit quominus solveretur, ad reddenda quae pignoris acceperat iure eum satis evi denter urgueri manifestum sit. Vgl. C . 4 , 32, 19, 2. Roma · II PROF. DR . IUR . ELEMÉR BALOGH BEITRÄGE ZUR ZIVILPROZESSORDNUNG JUSTINIANS ZUR ENTWICKLUNG DES AMTLICHEN KOGNITIONSVERFAHRENS BIS ZU JUSTINIAN SUMMARIUM Auctor demonstrat quo modo a legis actionibus ad cognitionem , quae vocatur « extra ordinem », perventum sit. Primum novi praetores, qui ius dicerent de fideicommissis et de liberalibus causis ab imperatoribus introducti sunt, ut has causas extra ordinem diiudicarent. Fiscales quoque lites hac via examinabantur, exeunte iam primo saeculo post J. Chr. Eodem ferme tempore – cum lites iam non a iudice privato sed a magistra tibus iudicarentur – appellationes quoque paulatim in usu uenerunt. In ius vocatio , quae antea quidem ab actore semper perficiebatur, per magis tratus quoque interpositionem effici solebat, postquam cognitio extra ordinem in usu recepta est. Formularum autem usus usque in quartum saeculum prorogatus est, et hoc ex ipsa constitutione, quae de formulis tollendis anno 342 lata est, intellegi potest. Quae autem viri docti de litis denuntiatione et de libello conventionis scrip serunt, iterum examinata sunt. Quo modo lites in provinciis iudicarentur inter viros doctos quaeri solet, nec una adhuc praevaluit sententia . Ex Gaii institutio nibus et ex papyris colligi potest formulas etiam in provinciis in usu fuisse. ' Vadimonium desertum et aliae eiusdem generis causae, quae temporibus quoque liberae reipublicae a iuris peritis tractatae fuerunt, praebuit praetori occasionem at de his, qui non defendebantur vel fraudationis causa latitabant, statueret. Ex his snspicari potest quae fuerit origo « denuntiationis ex auctoritate » factae. Evocatio , quo modo a magistratibus efficiebatur et ex quibus causis fieri solebat, per longum exposita est. Denique autor ostendit in excursu quo modo in provinciis formulae in usu esse desierint et cognitio extra ordinem introducta fuerit. Wenn die vorliegende Arbeit den bescheidenen Titel “ Bei träge zur Zivilprozessordnung Justinians , trägt, so bedarf es für die darin liegende Beschränkung des Umfanges der Arbeit keiner weiteren Erläuterung. Denn eine umfassende Darstellung des Ju stinianischen Prozesses könnte nur auf Grund eines vorangehenden Abrisses der politischen, sozialen und kulturellen Zustände des ost römischen Reiches im ausgehenden 5 . und 6 . Jahrhundert erfolgen . Zwar bestehen über dieses Thema zahlreiche beachtliche Einzelfor schungen (1) ; aber im ganzen stellen die Geschichte und soziolo (1 ) Vgl. Ch . DIEHL, Histoire de l' Empire byzantin , Paris 1920 ; H . GELZER , Abriss der byzantinischen Kaisergeschichte, in KRUMBACHER, Geschichte der by zantinischen Literatur von Justinian bis zum Ende des oströmischen Reiches 270 Elemér Balogh gische Struktur der frühen byzantinischen Epoche noch so viele Fragen , dass es im Rahmen dieser Arbeit unmöglich ist, einen so umfassenden Untergrund zu schaffen , wie ihn ein vorausgeschickter historischer Abriss darstellen würde. Aber auch das eigentliche Thema der Arbeit konnte nicht in seiner ganzen Breite behandelt werden , da teilweise die Vorarbeiten fehlten , andrerseits auch der Zweck der Arbeit und der Rahmen , in den sie eingespannt ist, eine so weite Ausdehnung nicht vertragen hätten . Die byzantinische Epoche und namentlich die Tätigkeit Justi nians auf dem Gebiete des Zivilprozesses hat eine besonders grosse Bedeutung für die Geschichte des römischen Rechts. Die Kodifi kation Justinians bezeichnet nicht nur den Endpunkt der Entwick lung des römischen Prozesssystems, sondern sie enthält auch im Keime die Elemente, die sich in dem späteren Prozessrecht ent falten, und auf denen der Zivilprozess der modernen Rechte be ruht. Zum Verständnis des Endpunktes ist eine kurze Darstellung der Entwicklung die zu ihm geführt hat, unerlässlich , soweit sie der Erfassung des justinianischen Rechts dienlich ist. Nach einer altbekannten Unterscheidung zerfällt die Geschichte des römischen Prozessrchtes in drei Hauptperioden : 1 . die Periode des Legisaktionenprozesses, 2 . die Periode der Formularprozesses, 3. die Epoche des Kognitionsverfahrens, zu der die Anfänge der byzantinischen Zeit gehören . Man kann keine dieser Perioden fest datieren , denn sie haben sich übereinander gelagert, und die einzelnen Verfahrensarten wa ren nebeneinander in Uebung. Der Prozess der ersten und zweiten Periode, der Legisactionen prozess und das Formularverfahren , bilden begrifflich unter einander keineGegensätze ; denn beide ruhen sie auf dem Gedanken des Schiedsgerichts und haben auch, ohne sich zu stören , neben einander bestanden . Ihr Unterschied besteht im wesentlichen darin , dass die umständlichen und schwierigen Spruch formeln - sich versprechen zog den Verlust des Prozesses nach sich – durch die (IWAN VON MÜLLER, Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft in systema tischer Darstellung . IX 1. Zweite Auflage bearbeitet unter Milwirkung A . EHRHARD und H .GELZER. München 1897 . Anhang S. 911-1067) ; H . VOLKMANN, Zur Rechts prechung im Principat des Augustus, in Münchener Beiträge zur Papyrusfors chung und antike Rechtsgeschichte, XXI, München 1935. 271 Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians Schriftformel ersetzt wurden , die die Parteien unter dem des Praetors vereinbarten . Mit dieser Handlung Schutz – dem judicium edere und accipere – verpflichteten sich die beiden Parteien, den Streit vor einen ihnen genehmen Richter zu bringen und sich sei nem Spruch zu unterwerfen . Dieser “ Vertrag , , wie ihn Wlassak in seinen Publikationen seit 1888 auffasst ( 1), hat dann die novie rende Wirkung , dass der Anspruch auf ein dare oportere untergeht und ein neuer auf ein condemnari oportere auflebt; zugleich sind mit diesem Akt der Litiscontestation folgende Wirkungen verbunden : 1) die Klagenverjährung wird unterbrochen ; 2 ) das Klagrecht wird konsumiert (ne bis in eadem re actio ). Einem auf nochmalige Verhandlung derselben Sache gerichte ten Begehren steht die exceptio der rei judicatae oder in judicium deductae entgegen, wobei judicium nach Wlassaks Ausführungen als Schriftformel zn verstehen ist (2). Diese Formulierung des Rechtsstreits am Ende des Verfahrens in jure macht den Prozess reif für die Ueberweisung an den judex und damit frei von der Amtsgewalt des Praetors. Diese Wirkung ist im Legisaktionenpro.. zess genau die gleiche wie im Formularverfahren und stellt damit die klassische Prozessführung in einen deutlichen Gegensatz zu dem sog. Kognitionsverfahren der späteren Zeit . Im Gegensatz zu dieser kurzen Kennzeichnung des Legisak tionen - und des klassischen Formularprozesses bedarf es einer ausführlicheren Darstellung des nachklassischen Verfahrens, insbe sondere der grundlegenden Fragen ; eine in die Einzelheiten ge hende Betrachtung kann bei dieser dem justinianischen Prozess recht gewidmeten Studie nicht gegeben werden, zumal die wahre Besonderheit seines Charakters erst spät erkannt worden ist und vertiefte Gesamtdarstellung noch nicht erfahren hat. Die Notwendigkeit der Betrachtung des nachklassischen Ver fahrens ergibt sich aus dieser Zwischenstellung zwischen dem For mularprozess, der ihm voraufgeht, und dem justinianischen Libell prozess , der ihm folgt. Die scharfe Scheidung, die das nachklassi sche Verfahren von dem ausgebildeten Verfahren per libellos unter Justinian trennt, håt bereits Bethmann -Hollweg (3) erkannt. Die (1 ) Die Litiskontestation im Formularprozess, in Breslauer Festschrift für Bernhard Windscheid , Leipzig 1888, 53-139. (2) WLASSAK , Liliskontestation, 65 -72, s. auch 72-75 . ( 3) Der römische Civilprosess , Bd . III. Bonn 1866 , § 152, S. 242-251. . 272 Elemér Balogh ältere Literatur hat zur Erklärung des justinianischen ausschliess lich auf die extraordinaria cognitio zurückgegriffen . Unter cognitio wird hierbei das Verfahren verstanden , das sich von der Einleitung bis zur Entscheidung des Prozesses vor dem richterlichen Beamten selbst abspielt. Unklar bleibt nur, welche Verfahren als extraordi när zu bezeichnen sind. Insofern der ordo judiciorum dem Formu larverfahren gleichgesetzt wird , ist die Unterscheiding klar. Ge meint sind mit der extraordinaria cognitio alle Verfahren , die die amtsrechtliche Zweiteilung und die Geschworenenstellung des Rich ters nicht kennen . Soweit der Ausdruck extraordinaria cognitio auch noch inner halb des zeitlichen Geltungsbereichs des Kognitionsverfahrens ver wandt wird, ist der Gegensatz zum Formularverfahren nicht mehr gegeben . Extraordinär sind dann alle Verfahren, die unter Aus schaltung der ordentlichen Magistraturen erster Instanz stattfinden . Es empfiehlt sich , den Ausdruck extraordinaria cognitio innerhalb des Kognitionsverfahrens mit Vorsicht zu gebrauchen. Da nämlich das Kognitionsverfahren zweistufig ist, ausserdem aus noch zu er läuternden Gründen das Reparationsverfahren eine grosse Rolle spielt, so ist die Unterscheidung innerhalb des Kognitionsverfahrens bisweilen schwierig . Jedenfalls ist es nicht richtig , die Zeit des Kognitionsverfahrens als die Zeit der ausserordentlichen Kognition zu bezeichnen, da während dieser Periode der Gegensatz zum ordo des Formularverfahrens nicht mehr besteht (1). Ein kurzer Ueberblick über die in Rom bestehenden Extraor dinarverfahren zeigt, dass die Ableitung des allgemeinen Kogni tionsprozesses von der cognitio extraordinaria nicht möglich ist. Es handelt sich bei ihr stets um Verwaltungssachen oder Angelegen heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, die von dem ordentlichen Verfahren eximiert sind. Für die extraordinaria cognitio trifft die Bezeichnung als Verwaltungsverfahren durchaus zu (2 ). Hierbei bleibt es aber unbeachtlich , dass es sich bei den fraglichen Mate rien zum Teil um solche handelt , die wir nach deutschem in das Gebiet des ordentlichen Zivilprozesses verweisen . Recht (1) WENGER, Institutionen des römischen Zivilprozessrechts, München 1925, § 25 S . 246 . Anm . 1. mit weiterer Literatur , (2 ) GIRARD, Manuels Paris 1929, S . 1140 ; PERNICE, Volksrechtliches und amtsrechtliches Verfahren in der römischen Kaiserseit, Juristische Abhandlungen . Festgabe für Georg Beseler. Berlin 1885, 51. Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians 273 In republikanischer Zeit besteht bereits die Kognition der Konsuln und Zensoren in allen Angelegenheiten geistlicher Ge richtsbarkeit. Hierher gehören auch alle solche Prozesse, in denen um res religiosae gestritten wird, wenn sie auch sonst als bürger liche Rechtsstreitigkeiten erscheinen. So z. B. die Klage auf Ein richtung eines Notwegs zum Grabe die durch eine mit seinem Vater L . Septimius Severus gemeinsam erlassene Verfügung des Kaisers M . Aurel Caracalla begründet wurde und nach dem Be richt Ulpians ausdrücklich in das ausserordentliche Verfahren vor die Provinzialstatthalter verwiesen wird (1). Die Annahme ist da her erlaubt, dass in Rom gleichfalls die extraordinaria cognitio ge geben war, aber nicht die des Praetors, sondern die der Konsuln . Dass eine Klage im ordentlichen Verfahren nicht gewährt wird , ist ausdrücklich hervorgehoben (2 ). ( 1) D . 11, 7 , 12 pr. ( 2) D . 11, 7, 14 , 2 (Si cui funeris sui curam testator mandaverit et ille ac cepta pecunia funus non duxerit, de dolo actionem in eum dandum Mela scripsit : credo tamen et extra ordinem eum a praelore compellendum funus ducere.) ent hält ein anderes Beispiel für die in Rede stehende Frage. Hiernach muss näm lich nach der Ansicht Ulpians derjenige, dem der Testamentserrichter die Re sorgung seiner Leiche aufgetragen und dieser das Geld genommen, aber die Leiche nicht bestattet hat, ausserdem , dass wider ihn die Klage wegen Arglist zu erteilen ist, vom Statthalter im ausserordentlichen Verfahren angehalten werden , auch die Leiche zu beerdigen. In der eben angeführten Stelle ist zwar von Praetor und nicht vom Statthalter die Rede. Ulpian hat hier offenbar, ebenso wie in der vorher angeführten , gleichfalls dem 25 . Buche seines Ediktskom mentars entnommenen Stelle praeses geschrieben , der versehentlich durch Flüch tigkeit der Abschreiber in praelor verwandelt wurde. Bekanntlich gehören die geistlichen Angelegenheiten von jeher nicht vor dem Praetor (Vgl. D . 5 , 3, 50, 1 ; 11, 7, 12 pr. ; C . 1, 3, 4 , 11 a . 223). Sind auch mannigfache Mängel, wie Widersprüche, Wiederholungen innerhalb desselben Werkes, in den Arbeiten Ulpians initunter zu finden , die bei der grossen Fülle der literarischen Leistun gen Ulpians, die sich auf einen kurzen Zeitraum zusammendrängen, auch be greiflich sind, doch kann eine derart nachlässige Redeweise wie praelor fiir Statthalter ihm nicht zugemutet werden . Hier handelt es sich offenbar um einen Schreib - und Lesefehler der justinianischen Abschreiber, den vielleichtdie starke Interpolation des Fragments, dem unsere Stelle angehört, verursacht haben mag . Mit Recht hat bereits Scialoja nachdrücklich darauf hiny wiesen, dass mitunter durch eine Interpolation der Kompilatoren ein Schreibfehler in den justiniani schen Digestentext gekommen sei, weil der. Text durch die Streichungen und Zusätze (zwischen den Zeilen und am Rande) der interpolierenden Kompilatoren für die Schreiber der Reinschrift der Digesten schwer lesbar geworden war ( Per 274 Elemér Balogh Die ausserordentliche Kognition des Praetors spielte keine grosse Rolle. Er half vielmehr durch actiones in factum , durch An wendung des Billigkeitsrechts, sowie durch Schaffung von Amts recht, indem er neue verfolgbare Ansprüche einführte. Dagegen erfuhren die Beamten in der Kaiserzeit, in der ein Teil der republikanischen Aemter an Einfluss viel eingebüsst hat und mitunter nur noch ein Schatten der ehemaligen Bedeutsamkeit war, ein anderer Teil derselben , zu dem auch die Prätur gehörte, zwar im Wesen geändert, seine Bedeutung, wenigstens zunächst, behalten hat, eine ausserordentliche Machtsteigerung, die es er wünscht erscheinen liess, bei Begründung von neuen Gerichten das Verfahren in einer Hand zu lassen. So sind zu den Kompe tenzen der Prätoren der Republik in der Kaiserzeit weiter gewisse zivilrechtliche oder doch an das Zivilrecht angrenzende Spezial kompetenzen hinzugetreten . Es ist eine Anzahl von Sonderpräturen eingerichtet worden , die das ausserordentliche Verfahren anwandten . So übertrug Claudius sämtliche Fideikommiss- Sachen auf zwei Prätoren, von denen aber Titus einen beseitigte (1). Dieser praetor fideicommissarius (2) heisst auf Inschriften mitunter praetor supre marum (3). Nerva beauftragte einen Praetor mit der Rechtspre chung zwischen Fiskus und Privaten (4 ) und Mark Aurel einen mit Vormundschaftssachen (5 ). Schliesslich ist ein Sonderpraetor la critica delle Pandette , Atti del congresso internasionale di scienze storiche, Roma, 1-9 aprile 1903, Vol. IX . Atli della Sezione V : Storia del diritto , storia delle scienze economiche e sociali, Roma 1904 . S . 191-192). (1) Vgl. D . 1, 2, 2, 32. (2 ) Gai. II 278, Ulp . XXV 12, D . 32, 78 , 6 ; Iust. 2 , 23 , 1. S . auch CIL VI 1 Nr. 1383 (S . 303 ) ; Nr. 1123 (1881): 1245 (1988 ) (S . 130, 145 ) = DESSAU , In scriptiones Latinae selectae I. Berolini 1892, Nr. 1063 (S. 233) ; 1086 (S. 238 ); 1179 (S. 259); cf. auch 1050 (S . 229). ( 3) Vgl. C I L XII Nr. 3163 (S. 405) = DESSAU , Inscriptiones Latinae selectae I Berolini 1892, Nr. 1168 ( S. 257) ; C IL VIII Supplement. Pars IV Nr. 22721 (S . 2297) = DESSAU , 1 . c. III 2 , Nr. 8978 ( S . XXXIV ). S . auch MOMMSEN , Rö misches Staatrecht II, 13. Leipzig 1887. S . 104 Anm . 1 ; KÜBLER , Geschichte des römischen Rechts . Leipzig 1925. S. 211 Anm . 3. (4 ) Vgl. D . 1, 2, 2, 32. (5 ) Vita Marci 10 s 11 ; CILV I Nr. 1874 ( S. 179) = DESSAU , I. c . I Nr. 1118 S . 246 ; CIL VIII 1 Nr. 7030 ( S. 630) = DESSAU , I. c. Nr. 1119 S . 246 . Für weitere Inschrifen s . den Index yon DESSAU , Inscriptiones Latina Selectae Vol. III l. Berolini 1914 S. 396 . S . auch Vat. fr . 232, 233, 238, 244, 247 ; KÜB LER, L. c. 211 Anm . 6 . Beiträge zus Zivilprozessordnung Justinians 275 für Freiheitssachen , ein sogenannter praetor de liberalibus causibus wenigstens seit dem Anfange des dritten Jahrhunderts bekannt (1 ). Wie bekannt, waren die Fälle des Extraordinärverfahrens ur sprünglich nnr solche, wo ein eigentliches Judicium unter den streitenden Personen oder über das streitige Verhältnis entweder nach hergebrachtem Recht nicht möglich und dem Geist desselben zuwider war, oder wenigstens in persönlicher oder sachlicher Hin sicht der Anspruch etwas ausserordentliches hatte, das den Gedan ken an seine Einfügung in den regelmässigen Weg für die Entschei dung von Rechtsstreitigkeiten in den sogenannten ordo iudiciorum privatorum entfernte. Die Zahl der im ausserordentlichen Verfahren behandelten Rechtssachen vermehrte sich nach und nach immer mehr und eine gute Uebersicht derselben gibt bereits Bekker (2). Um nur einige Beispiele für die Fälle des ausserordentlichen Ver fahrens anzuführen , wollen wir zunächst auf die Ansprüche aus Fideikornmissen hinweisen, über deren Ursprung wir am besten unterrichtet sind (3) und für die es uns unzweideutig bekundet ist, dass Augustus ursprünglich nur bei Fällen ganz besonderer Untreue durchgegriffen haben wollte, und dass er dazu die Consuln anwies, die eben in besonders anstössigen Fällen den betreffenden Univer sal- oder Singularsuccessor zur Erfüllung der Auflage zwangsweise anzuhalten hatten (4). ( 1) Vgl. c . 4 , 56 , 1 (a . 223) ; C IL X 1 Nr. 5398 (S . 354 ) = DESSAU, I. c . I Nr. 1159 S . 255 ; CIL, VIII Supplement, IV Nr. 22721 (S . 2297) = DESSAU, 1. c . III 2 Nr.8978 (S . XXXIV). Vgl. dazu NICOLAU, Causa liberalis, Paris 1933, 66 . (2 ) Die Aktionen des römischen Privatrechts II. Berlin 1873, 194-199. (3 ) Gai. Il 278 ; Ulp . 25 , 12 ; Inst. 2 , 23 , I und Theophilus dazu. Cf. auch Pauli Sent. 4 , 1 , 18 ; Inst. 2, 25 pr.; D . 1, 2, 2, 32 pr. ; 2, 1, 19 pr. ; 31, 29 pr. ; 32, 78 , 6 ; 35, 1, 92 ; 40, 13, 4 ; 50, 16 , 178, 2 ; C . 3 , 36 , 7 (a . 239 vel. 241) ; 6 , 42, 16 , 1 (a . 294 ) ; 8, 17 (18 ) 2 (a . 212 ) ; Suet. Claud. 23 ; Quint. inst. or . 3, 6 , 70 ; CIL VI I Nr. 1383 (S . 303); X 1 Nr. 1123 ( 1881), 1254 (1988), (S . 130 , 145 ) = DESSAU , I, c . 1 Nr. 1063 ( S . 233 ) ; 1086 ( S . 238 ) ; 1179 (S . 259). cf. 1030 (S . 229). Vgl. hier auch CILXII Nr. 3163 ( S . 405 ). DESSAU , l. c . 1 Nr. 1168 (S. 257) ; C IL VIII 4 Nr. 22721 ( S. 2297) = DESSAU , I. c . III 2 Nr. 8978 (S . XXXIV). (4 ) Vgl. Inst. 2, 25 pr.; 2, 23, 1 und Theophilus, dazu a. a. 0 . Vgl. dazu BETHMANN -HOLLWEG , Der römische Civilprozess II. Bonn 1865 S 122. S. 763-764 ; MOMMSEN , Römisches Staatsrecht II 13. Leipzig 1887. S . 103-104 ; Il 23. Leipzig 1887 S. 913 ; PERNICE, Marcus Antistius Labeo I. Halle 1873 S . 413-414 ; der selbe, Festgabe für G . Beseler 63 . 276 Elemér Balogh Die Entwicklung des Instituts der Fideikommisse führte zu den fideikommissarischen Freilassungen. Der Sklave erhielt die Be fugnis aus diesem Grunde wider den Herrn zu klagen (2), später und nach vielem Streit ebenso der Sohn wider den Vater auf Emancipation (1) Hieran schliesst sich an , dass auch in einigen anderen Fällen dem Sklaven auf Freilassung zu klagen und über haupt gegen den Herrn klagend aufzutreten gestattet wurde und diese Rechtsstreitigkeiten dann in ausserordentlichem Verfahren von dem Magistrat behandelt wurden . So kann der Sklave wegen arger Misshandlung, dier er von seinem Herrn erfährt, vor dem Stadtpräfekten oder dem Provinzialstatthalter klagend auftreten und wenigstens seinen Verkauf an einen anderen Herrn (3 ), oder wenn er sich mit seinem Gelde zu diesem Zwecke hat kaufen las sen , die Freilassung erzwingen (4 ), wie auch der Ausspruch auf Freilassung wegen Prostitution gegen Vertrag gewährt wurde, wenn der andere Kontrahent nicht auf dem Recht aus seiner Bedingung, dass die Sklavin nicht zur Wollust preisgegeben werde, besteht (5). Hat der Herr das Testament unterschlagen , worin dem Sklaven die Freiheit hinterlassen worden ist, so kann die Klage wegen Un terschlagung des Testaments, die sogenannte actio suppressi testa mcnti, die von den Kaisern Mark Aurel und Commodus eingeführt worden ist, angestellt und hierdurch die Freilassung erwirkt wer den (6 ). Ebenso sind die Summen , die eventuell von den Sklaven für die Freilassung zu erlegen wären , im ausserordentlichen Ver fahren zu bestimmen ( 7). Desgleichen kann das im Falle eines Delikts in die Knechtschaft des Verletzten gegebene Hauskind, ( 1) D . 40, 5, 44 : De libertate fideicommissaria Praestanda servus cum do mino recte contendit s. auch D . 38 , 2, 41 ; 19, 1 , 43. ( 2 ) D . 35 , 1 , 92 : Pauli Sent. IV , 13 , 1 ( s . aber HUSCHKE -SECKEL KÜBLER : Jurisprudentia Anteiustiniana II, 1 Lipsiae 1911. S. 111. Anm . 1). Plin . ep. 4 , 2 , 2; cf. aber D . 35 , 1 , 93; D . 30 , 114, 8 . (3 ) Vgl. Gai. I, 53: Collat. III, 3 , 3 ; Inst. 1, 8 , 2 ; D . I , 6 , 2 ; 48, 18 , 1, 27 , cf, hier auch Collat. III, 2, 1 ; III, 4, 1 ; D . 1, 6 , 1, 2 ; 1, 12, 1, 1; 8 ; 30, 53, 3 ; 45 , 1, 96 ; 48, 8, 11 , 1 ; 2 ; C . 9, 14 , 1 (a . 319) . Senec. de clem . I, 18 : Suet. D. 26 . 18,7. Se Claud . 25 ; Aeli Spartiani de vita Hadriani 18 , 7 . (4 ) Vgl. D . 40, 1, 5 pr. cf. auch D . 26 , 4 , 3 , 2 . (5 ) Vgl. D . I, 12 , 1, 8 ; C . 4 , 56 , I (a . 223) ; s . auch C . 4 , 56, 2 (a . 223); 3 (225). 8; c.1 (6 ) D . 48, 10 , 7 ; s. überhaupt D . 5 , 1, 53. ( 7) Vgl. D . 4, 4, 31, 44, 3, 29 pr. Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians 277 wenn es die Schuld abverdient hat, seine Freilassung durch den Praetor erzwingen ( 1). Der Kaiser Trajan hat sogar in einem einzelnen Falle den Vater, der seinen Sohn misshandelt, zur Emancipation desselben genötigt (2). Und dieses Urteil verzeichnete die Jurispru denz als Präjudiz für ähnliche Fälle ( 3). In den eben geschilderten Fällen handelte es sich um das persönliche Verhältnis zwischen dem Herrn und seinem Sklaven , dem Vater und seinem Kinde. Und dieses konnte nach altem Rechte nicht Gegenstand eines Rechtsstreits vor Gericht sein . Erst der humane Absolutismus der Kaiserzeit machte auch dies möglich . Dies geschah natürlich nicht in der Form eines gewöhnlichen Ju diciums, sondern im Wege des amtlichen Kognitionsverfahrens (4 ). Die eben vorher angeführten Forderungen der Gewaltunterworfenen gegen den Hausherrn konnten nicht im ordentlichen Prozesse ver handelt werden , weil der Richter nicht frei erklären durfte, wo über die Tatsache der Unfreiheit kein Zweifel war. Der ordentli che Prozessweg sollte hier auch ausgeschlossen werden , weil man auf diese Verhältnisse nicht ausschliesslich die Sätze des Privat rechts anwenden wollte. Wie bereits Pernice es sehr richtig nach drücklich betonte (5 ), war es gerade die Absicht, die fraglichen Sachen als Verwaltungssachen zu behandeln , weil dabei eben der Staat und das Gemeinwohl in Betracht kommen . Die Angelegenheit, bei der die Grundsätze des Privatrechts nicht beachtet wurden (6 ), wurde als polizeiliche angesehen , womit nur im Einklange steht, dass durch die spätere Gesetzgebung hier dem Bischofe und dem defensor civitatis eine Einwirkung gestattet wurde ( 7 ). Das amtliche Kognitionsverfahren dient schlankweg der freien Gewalt des Ma gistrats und bedeutet formell ein Verfahren im Verwaltungswege, im Gegensatz zu dem ordentlichen Prozess, dem Verfahren im Rechtswege. Das ordentliche Verfahren ist Verfahren nach Volks (1) Vgl. Collat. II, 3 ; Inst. 4 , 8 , 3 ; cf. auch Gai. I, 140; IV , 75 ; 79 . (2) Vgl. D . 37, 12, 5 . (3) Vgl. D . 38 , 6 , 8 ; cf. D . 29, 4 , 27, I ferner vgl. dazu D . 1, 7, 31. (4 ) S , auch BETHMANN -HOLLWEG , Der römische Civilprozess. II . Bonn 1865 , § 122 S. 765. (5 ) Festgabe für G . Beseler, 63-64 . (6 ) Vgl. D . 5 , 1, 53 ; Collat. III, 3, 5 -6 und dazu D . 2, 4 , 10 pr. & 1 ; 18 , 1, 56 . (7) Vgl. C . Th. 15 , 8, 2 = C. I. 1, 4 , 12 = 11, 41 (40), 6 = Bas. 60, 38, 1. Elenér Balogh 278 recht, wo die geregelte Selbsthilfe , d. h . die vom Praetor geleitete und geförderte Selbsttätigkeit der Parteien herrscht und ein Ver fahren mit der Macht des Rechts obwaltet. Das amtliche Kogni tionsverfahren ist dagegen Verfahren nach Amtsrecht, wo wiede rum die verwaltende Amtsmacht herrscht und ein Verfahren mit der freiwaltenden Macht der Obrigkeit vorliegt (1). Wird der Herr zum Verkaufe oder zur Freilassung des Sklaven genötigt, so ist die Behörde dafür, wie bereits oben erwähnt, zwar der Stadtprä fekt, jedoch kann er den Sklaven nicht für frei erklären . Denn er hat keine. Legisactio . Mit Recht wies bereits Pernice darauf hin (2 ) dass es offenbar damit zusammenhängen mag, dass Pius (3 ) hier die Konsuln einschiebt (4), die seit der lex Aelia Sentia (5 ) obnehin eine Art von Jurisdiktion in Freilassungssachen hatten (6 ). Und diese consularischen Freilassungen haben sich lange behauptet. Als im Laufe der Zeit für gewisse Freilassungen die vorgängige Recht fertigung der Gründe bei einem Rat erfordert ward, lag es in Rom dem Consul ob, dasselbe zu bilden und seinen Spruch herbeizu führen (7). Nach unseren Ueberlieferungen steht die Leitung der Freiheitsprozesse aber nachweisbar seit dem Anfange des dritten Jahrhunderts einem besonderen Praetor, dem sogenannten praetor de liberalibus causis zu, der in einer Inschrift aus dieser Epoche (8 ) und in einer Verordnung des Kaisers Alexander Severus aus dem Jahre 223 (9) genannt wird und ausserdem noch in einer Inschrift vorkommt, deren genaues Datum wir nicht feststellen können (10). Es unterliegt keinem Zweifel, dass der eben erwähnte Freiheits praetor und nicht der Stadtpraetor den für den von demselben verursachten Schaden dem Beschädigten zum Eigentum hingege (1) S . PERNICE, Parerga II, Sav. 2. V (1884) S. 30 ; Sohm , Institutionen !7, München 1923, $ 120, S. 723. ( 2 ) S . Festgabe für G . Beseler , 64 . (3 ) Regierte 138 -161 n . Chr. (4 ) D . 35 , 1, 50. (5 ) 4 n . Chr. (6 ) D . I, 10 , 1. ( 7) D . 1, 10 , 1 pr. ; 40, 2, 5 ; CIL VI, I Nr. 1877 ( p . 420) a . 73 = DESSAU , Inscriptiones Latinae selectae. I, Nr. 1970, S. 377 . (8 ) Vgl. CIL X , 1 Nr. 5398 (p . 534 ) = DESSAU, I. c . III, 2 , Nr. 8978, S . XXXIV . (9 ) C . I. 4 , 56 , 1. ( 10 ) CIL VIII Supplement. Pars IV , Nr. 22721 (S . 2297 ) = DESSAU, 1. c. III, 2, Nr. 8978 (S . XXXIV ) . Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians 279 benen Gewaltunterworfenen zur Freiheit verhalf, nachdem die Schuld abverdient worden ist (1 ). Denn bekanntlich ist die ganze Einrich tung erst jüngeren Ursprungs (2). Hängt auch die Einsetzung des Freiheitspraetors zunächst mit den Freilassungssachen zusam men , so dehnt sich seine Zuständigkeit allmählich auf Personen standssachen jeder Art aus. Allmählich wurden alle Statusprozesse im Kognitionsverfahren vor ihm verhandelt (3 ). Weitere Fälle des ausserordentlichen Verfahrens bieten die Ansprüche auf Alimentation zwischen Eltern und Kindern, Patro nen und Freigelassenen , welche die Kaiserzeit einführte, ohne je doch, dass uns das genaue Datum überliefert worden wäre und bei denen die Gerichtsbarkeit den Konsuln zustand (4). Hierher gehören auch die Alimentenforderungen der Mündel gegen ihre Vormünder. Das Recht, für die Mündel den Unterhalt zu bestim men, steht dem Prätor zu, so dass er selbst anordnet, welche Summe die Vormünder den Mündeln zum Unterhalt leisten sollen (5 ). ( 1) S . Collat. II, 3 ; Inst. 4 , 8 , 3 . (2 ) Vgl. Gaius I, 140 s. auch IV , 75, 79 ; Just. Inst. 4 , 8 , 7 ; D . 43, 29, 3, 4 . (3 ) C . Th . 6 , 4, 16 (359 Dec. 30 ) = C . I. 1, 39, I. (4 ) Vgl. D . 25 , 3, 5 . In dieser Stelle haben die Kompilatoren überall an Stelle consul das Wort index gesetzt, weil das Wort consul bezw . consules, wie es ur sprünglich hiess, freilich in die Gerichtsverfassung unter Justinian nicht mehr passte. In mehreren anderen Rescripten , die Ulpian in seinen Büchern de officio consulis, denen unsere Stelle entnommen ist, an führt, ist der Ausdruck consules nicht durch iudices ersetzt, sondern auch erhalten, wie in 1. D . 35 , 1, 50 und D . 34, 1 , 3 . In der letzten Stelle ist doch zu Anfang indices interpoliert, am Schlusse consules aber stehen geblieben . Die Interpolation in der 1. D . 25 , 3 , 5 bemerkten bereits CUJACIUS, Observationum l. 19 c. 4 Opera III, Napoli 1758 , Sp. 570 ; RUDORFF bei SAVIGNY , Ueber das Interdict quorum bonorum , in Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft VI, Berlin 1828, S . 238 Anm . 1 ( = SAVI GNY: Vermischte Schriften II Berlin 1850 S. 251 Anm . 2 ); LENEL, Pal. II Sp. 953 Anm . 5 , 6 ; 954 Anm . 2-6 ; KRÜGER bei MOMMSEN D .15 S. 366 -367, und noch viele andere , s. LEVY-RABEL, Index Interpolationum II Weimar 1931 Sp. 111-113 , woraus zugleich hervorgeht, dass diese Stelle überhaupt stark interpoliert ist . D . 25 , 3, 6 pr: ; 34 , 1, 3. Wie bereits erwähut ist in der letzten Stelle das Wort consules zwar am Schluss stehen geblieben, jedoch zu Anfang der Stelle haben die Kompilatoren gleichfalls statt dessen iudices geschrieben. In diesem Sione bereits, LENEL, Pal. II Sp. 955 Anm . 2, KRÜGER, I. c. S. 519, und Bon FANTE, Corso di diritto romano I. Roma 1925 S. 279 Anm . 6 . Vgl. C. V, 25 . (5) Vgl. D. 27, 2, 3 pr.: Jus alimentorum decernendornm pupillis praetori competit, ut ipse moderetur, quam summam tutores vel curatores ad alimenta pupillis vel adulescentibus praestare debeant. Ueberzeugend hat bereits GRADEN 280 Elemér Balogh el m idtd dder orm er VVormund Münddürfte . s sein, seine so ewird Sollte der Mündel aber je doch nicht genötigt, denselben aus seinem eigenen Vermögen zu ernähren . Und wenn der Mündel, nachdem der Unterhalt bestimmt worden ist, in Dürftigkeit geraten sein sollte, so muss der festge setzte Unterhaltsbetrag vermindert werden , ebenso wie er vermehrt zu werden pflegt, wenn etwas zu dem Mündelvermögen hinzuge kommen sein sollte (1). Ein weiteres Beispiel des amtlichen Kog nitionsverfahrens bietet uns überhaupt das Verfahren gegen einen widerspenstigen oder suspekten Vormund (2). Die Vormünder werden in ausserordentlichem Verfahren zur Verwaltung angehalten, weil keine ordentliche Klage dazu vorhanden ist. Der Prätor oder Statthalter gebraucht im Zögerungsfalle die Zwangsmittel von Auspfändung oder Auflegung einer Geldstrafe . Das amtliche Kognitionsverfahren greift auch bei den Hono rar -, Salar- und Mäklerlohforderungen Platz, die vor dem Praetor oder Statthalter geltend gemacht werden und für die wesentlich dieselben materiellen Rechtsgrundsätze wie bei der Dienstmiete zur Anwendung kommen ( 3). Zu den vorgenannten Forderungen , die sich auf die Belohnung von Dienstleistungen höherer Art oder die sonst nicht Gegenstand eines Dienstvertrages zu sein pflegten , beziehen, gehören das Honorar der Sachwalter und Advocaten , der Aerzte, zu denen auch die Hebammen gehören und denen sie gleich behandelt werden (4 ), der öffentlichen Lehrer, der Feldmesser und anderer (5), das Salar öffentlicher Beamten, wie das Gehalt der WITZ ausgeführt, dass in der eben angeführten Slelle, in der der Vordersatz nur von pupilli spricht, der folgende aber auch von adulescentes redet, die Worte vel curatores und vel adulescentibus interpoliert sind . Uebrigens erwähnt der ganze Titel D . 27, 2 . Ubi pupillus educari vel morari debeat et de alimentis ei praestandis erwähnt nur zweimal (D . 27, 2 , 3 pr. und 3 , 6 ) den Curator (GRA DENWITZ, Conjecturen , Zeitschrift für das Privat und öffentliche Recht der Ge genwart. XVIII. Wien 1891 S. 342). Graden witz stimmen hierin auch SOLAZZI, La minore elà nel diritto Romano, Roma 1912- 3, S . 67 und KRÜGER beiMOMMSEN D .15 S . 399 bei, (1) Vgl. D . 27 , 2 , 3, 6 . ( 2 ) D . 26 , 7 , 1 pr, : Gerere atque administrare tutelam extra ordinem tutor cogi solet . Wir können SOLAZZI nicht beistimmen , dass diese Stelle interpoliert wäre ( Istituti tulelari, Napoli 1929, 35 sq. ). (3 ) Vgl. D . 19, 2 , 19, 19, 1010 ;; 38 , 1 ; Plin . ep. IV , 12. pr . 81. 17; 2, 99 pr. (4 ) D . 50, 13, 1 , 2; cf. auch DD.. 99,, 2, . 56, 3: (5 ) Vgl. D . 50, 13, 1 ; 3 ; 11, 6 , 1 pr.; 17 , 1, 7 ; 56, 3 ; C . 4, 35, 1 . Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians 281 zum Gefolge, zum Unterbeamtenpersonal eines Magistrats, insbe sondere der Provinzialstatthalter, Gehörigen, und der den Magi straten und den höheren Staatsbeamten zur Entscheidung von Rechtssachen zur Seite stehenden rechtskundigen Beisitzer (1) und der Mäklerlohn des Unterhändlers (2). Zu den im amtlichen Kognitionsverfahren behandelten Rechts sachen gehören auch die Fiskalsachen (3). (1) D . 50, 13 , 1, 8 ; 4; 1, 22, 4 (cf. auch D. 19, 2, 19, 10 ); 19, 1, 52 , 2. (2 ) D . 50, 14 . (3) D . 43, 8, 2, 4 ; 48, 13 , 11 (9), 6 ; D. 42, 1, 47, 1; Pauli Sent. V, 5 a, 6 b. C. Suetoni Tranquilli Nero 17, ed. lum p. 231. Marc Aurel übertrug dem Senat die Appellation von den Consuln Juli Capitolini vita Marci Antonini Phi lophi 10 , 9 (s. Scriptores Historiae Augustae. Edidit E . Hohl. I, Lipsiae 1927, IV , S . 56 ). Probus bestätigt bei seinem Regierungsantritt die drei Rechte der Gesetzgebung , der Statthalterernennung und der obersten Appellation Flavii Vopisci Probus 13 , 1 (s. Scriptores Historiae Augustae. Edidit E . Hohl, II, Li psiae 1927, XXVIII. S . 212-213). Mit Recht hat bereits Mommsen darauf hinge wiesen, dass es mit dem eben Gesagten der Sache nach zusammenfällt, wenn Kaiser Tacitus bei seinem Regierungsantritt vonden Proconsuln und sämtlichen Beamten die Appellationen an den Stadtpraefekten weist, der hier, vielleicht proleptisch, als Nachfolger der Consuln in der Leitung des Senats gedacht ist Flavii Vopisci Syracusii Tacitus 18 (5 ), 3, 5 ; 19 (6 ), 2 s. Scriptores Historiae Augustae. Edidit E . Hohl, II, Lipsiae 1927 , XXVII, S. 200-201. Vgl. dazu MOMM SEN, Römisches Staatsrecht II, 13. Leipzig , 1887. S . 106 Anm . I, II, 23 . Leipzig, 1887, S. 987. Ohne hinreichende Gründe erblicken RUDORFF, Römische Recht sgeschichte II. Leipzig, 1859 § 85 Anm . 13, v. BETUMANN -HOLLWEG, Der römi sche Civilprozess II, Bonn 1865 § 62 Anm . 25 S. 47. MERKEL, Ueber die Geschi chte der klassischen Appellation . Abhandlungen aus dem Gebiete des römischen Rechts. Heft II, Halle 1883, § 5 S. 56 -63 s. insbesondere S . 58 .60 und KIPP , R . E . II, s. v. appellatio Sp. 200 Ziff. III, in den eben vorhes angeführten Nach richten nur vorübergehende Konzessionen einzelner Kaiser . Im Gegensatz zu GEIB (Geschichte der römische Kriminalprozess bis zum Tode Justinians. Leipzig 1842 S . 678 ) und MOMMSEN , a , a . 0 . II, 13, S . 105 - 108, betrachten die vorge nannten Schriftsteller also die Senatsappellation trotz den direkten Belegen nicht als eine dauernde, sondern nur als eine vorübergehende Einrichtung. Andrer seits war es aber entschieden nur von vorübergehender Bedeutung , wenn ein zelne Kaises, wie Nero zu Anfang seiner Regierung, ferner Tacitus und Probus, 17 a. a . 0 .; Flavii Vopisci Probus 13 , I a . a . 0 ., und schon früher C . Caligula (C . Svetoni Tranquilli C. Caligula 16, ? (ed. Ihm S . 162) auf ihre eigene Ap pellationsgerichtsbarkeit zu Gunsten derjenigen des Senats ganz verzichteten , vgl. MOMMSEN, a . a. O ., S . 107 Text und Anm . 2. KIPP, a. a. O ., Sp. 200 Ziff. III. Roma · II 19 282 Elemér Balogh Die Annahme Mommsens (1), der übrigens auch Ettore de Ruggiero (2) und L Mitteis (3 ) beipflichten , als ob die Geltung des Kognitionsprozesses für Fiskalsachen in der Zeit von Nerva bis Hadrian eine Unterbrechung erlitten hätte , hat keinen quellen mässigen Halt ; zu dieser Ansicht neigt bereits Pernice (4 ), noch mehr aber Wlassak (5 ). Der von Nerva eingesetzte Fiskalpraetor, der keineswegs zwischen zwei Privaten , vielmehr zwischen dem Fiskus und Privatleuten Recht spricht (6 ) und von dem der jün gere Plinius in seiner Lobrede auf Traian , aus der wir fast ledig lich die Regierungszeit Traians bis zum Jahre 100 kennen lernen , handelt, entschied keineswegs mit Geschworenen, wie es sich aus dem Zusammenhange der einschlägigen Plinius Stelle bei genauer Prüfung ergibt. Diese lautet nämlich folgendermassen : (Dicitur ac tori atque etiam procuratori tuo :) " In ius veni, sequere ad tribunal. , Nam tribunal quoque excogitatum principatui est par ceteris, nisi illud litigatoris amplitudine metiaris, Sors et urna fisco iudicem adsignat ; licet reicere, licet exclamare : “ Hunc nolo , timidus est et bona saeculi parum intellegit; illum volo , qui Caesarem fortiter amat. , Eodem foro utuntur principatus et libertas; quae praecipua tua gloria est, saepius vincitur fiscus, cuius mala causa numquam est nisi sub bono principe (7 ). Es kann aus dieser Stelle nicht herausgelesen werden , dass die Prozesse zwischen dem Fiskus und Privaten , die bekannt lich Nerva einem eigenen Prätor überwies (8), unter Traian im or dentlichen Rechtsweg durch erloste Geschworene abgeurteilt wur (1 ) CIL II Supplementum Nr. 5368 S . 839 = Ephemeris Epigraphica II (Romae 1875 ) S. 150- 151 = BRUNS -MOMMSEN-GRADENWITZ : Fontes iuris Romani antiqui. 17. Tudbingae 1909. Nr. 83. Epistula Trajani vel Hadriani S . 256 ; Römisches Staatsreckt II, 13 S .. 226 Ziff. 4 ; s. auch II 23 S. 1021-1022. (2 ) Dizionario epigraphico di Antichità Romane. I, Roma 1895, 8. v. advo catus fisci S. 126 . ( 3 ) Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians I, Leipzig 1908 . S . 364 Text u . Anm . 57 , 365 Text u . Anm . 39 , dazu noch S . 368. ( 4 ) Festgabe für G . Beseler , S . 78 Anm . 1. (5) Zum römischen Provinsialprozess, Sitz., in Ber. Wien . Akad . d . Wissen schaften. Phil.-Hist . Klasse 190. Band, 4. Abhandlung . Wien 1919. S . 14 Anm . 8 . (6 ) D . 1 , 2 , 2, 32 : ...post deinde divus Claudius duos praetores adiecit qui de fideicommisso ius dicerent, ex quibus unum divus Titus detraxit: et adiecit divus Nerva qui inter fiscum et pin vatos ius diceret.. . (7) Panegyricus 36 , 4. (8 ) D . 1, 2, 2, 32. 283 Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians den , wie Mommsen es getan hat (1). Die Auslosung eines Richters. und die Zulässigkeit der Zurückweisung des Erlosten für die pri vate Partei, von denen in der eben angeführten Stelle die Rede ist, bieten keinerlei Anhalt für die Annahme eines ordentlichen Privatprozesses. Beide sind dagegen mit dem amtlichen Kognitions verfahren vereinbar, worauf schon Wlassak sehr richtig hingewie sen hat (2 ). Hier handelt es sich offenbar um die Auslosung eines Richters aus einer Dienstliste des Fiskalprätors, den jedoch die private Partei zurückweisen konnte (8 ). Es konnte jede Partei vor der Litiskontestation (4) unter Angabe eines rechtmässigen Ver dachtgrundes, als welchen die Quellen ausdrücklich nur die Feind schaft des Richters gegen eine Partei im allgemeinen anführen (5 ), den Richter ablehnen (6 ) und dadurch sich der Kompetenz dessen zu entziehen, von dem sie zu fürchten hatte , dass dieser zu ihrem Nachteil die andere Partei begünstigen werde. Im Einklange damit, dass ursprünglich die Tätigkeit des iudex datus, der vom magistratus zur Entscheidung des einzelnen Rechtsstreites bestellt ward , bloss von der Uebereinkunft der streitenden Teile abhing (7), konnte derselbe in der früheren Zeit auch ganz ohne alle Angabe eines Grundes abgelehnt werden . Der Kläger hatte das Recht, einen Richter vorzuschlagen, und der Magistrat bestellte ihn , wenn der Gegner ihn nicht verwarf. Diese Zurückweisung geschah mit der Formel eiero iniquus mihi est (8 ). Brauchte auch für diese Ejera tion keine besonderen Zurückweisungsgründe angeführt zu werden , so setzte eine von dem Magistrat als grundlos und mutwillig er (1) Römisckes Staatsrecht II 13 S . 226 ; CIL II, Supplementum Nr. 5368 S. 839 = Eph . ep. II S . 150 = BRUNS-MOMMSEN -GRADENWITZ a . a . 0 . S . 256 . ( 2 ) Provinzialprosess S . 15 Anm . 8 . (3 ) Vgl. dazu Lex coloniae Genetivae Juliae s. Ursonensis a. 710 (= 44 ) c . 95 Z . 27 = CIL II Supplementum Nr. 5439 S . 856 = DESSAU, Inscriptiones Latinae Selectae II, 1 Berolini 1902. N . 6087. S . 508 = BRUNS-MOMMSEN -GRADENWITZ : Fontes iuris Romani antiqui 17 Tubingae 1909 Nr. 28 S . 131. (4 ) Vgl. C . 3 , 1, 12 , 1 ; 16 ; Nov. 53, c . 3 pr. 96 , c . 2 , § 1 . (5 ) Vgl. D . 40, 12, 9 pr. (6 ) Vgl. C . 3, 1, 12, 1 . . ( 7) Vgl. Cicero pro Cluentio 43, 120 : neminem volneruntmaiores nostri non gl. Cqui nter aadversarios ic.iinter dversarios sconvenisset. p.indicem ed ne pecus 48 ) ,Vnisi modo de existimatione cuiusquam , sed ne pecuniaria quidem de re minimam esse (8 ) Vgl. Cic. de orat. II, 70, 285. Quom ei M . Flaccusmullis probris obiectis P . Mucium iudicem tullisset, Eiero, iniquil, iniquus est...; s. auch In C . Verrem Act. II, lib . III c. 60, 137. 284 Elemér Balogh kannte Weigerung jedoch den Beklagten in die Lage dessen, der die Einlassung aus Ungehorsam ablehnt, so dass er als vorGericht nicht verteidigt betrachtet und mithin wie ein Verurteilter behan delt wurde ( 1). Solange nun nur der iudex datus die Instruktion und Beurteilung der einzelnen streitigen Rechtsverhältnisse, der ihn ernennende Magistrat aber mit diesen Geschäften streng genommen nichts zu tun hatte, konnte dieser letztere natürlich auch nicht als verdächtig zurückgewiesen werden . Dasselbe ist auch für das jus tinianische Recht bekundet. Wir haben unumstössliche Belege dafür, dass das justinianische Recht zwar die Ablehnung der beauf tragten Richter, nicht aber die der Magistrate gestattete (2 ). Hielt eine Partei den Magistrat verdächtig, so konnte sie darauf antragen dass der Verdächtige die Sache gemeinsam mit dem Erzbischof instruiere und entscheide (3 ). Im Kognitionsverfahren kann der Magistrat die Sache von Anfang bis zu Ende selber erledigen oder für einzelne Prozessakte, auch für die Urteilsfällung, sich unter geordneter Richter (iudices dati), um die es sich in der angeführten Plinius- Stelle eben handelt, bedienen, an deren Bestellung die Par teien keinen Anteil haben , wenn ihnen auch gelegentlich faktisch solcher Anteil gewährt wird . Gleich der verher angeführten Plinius Stelle kann auch die spanische Bronze aus Italica im CIL II Sup plementum Nr, 5368 S . 839 (4 ), die die spärlichen Reste eines Briefes von Traian oder Hadrian enthält, mit ihrem ergänzten Texte nicht als Beweis für die Annahme Mommsens, dass die Gel tung des Kognitionsprozesses für Fiskalsachen in der Zeit von Nerva bis Hadrian eine Unterbrechung erlitten hätte , angeführt werden . Denn , wie bereits Wlassak richtig betont hat (5 ), beruht Mommsens überaus waghalsige Ausfüllung der grossen Lücken un (1) Vgl. Lex de Gallia Cisalpina tab. II, c. XXI, XXII, abgedruckt in CIL . I 22 Nr. 592 (205 ). S . 478 -481 = BRUNS-MOMMSEN -GRADENWITZ : Fontes iuris Romani antiqui 17 Tubingae 1909 Nr. 16 S . 99-100 = GIRARD, Textes de droit romains. Paris 1923. I § 3, Nr. 13. S. 76-77 = RICCOBONO, BAVIERA, FERRINI: Fontes iuris Romani Antejustiniani. I, Nr. 17 . S . 138 -139 ; D . 50, 17, 52 : Non defendere videtur non tantum qui latitat, sed et is qui praesens negal se defen dere aut non vult suscipere actionem . Vgl. dazu D . 38, 5 , 1, 7, 8 . ( 2) Vgl. C . 3, 1, 16 ; 18 ; Nov. 53 c . 3 ; 96 c . 2 8 1 , (3 ) Nov. 86 c . 2. (4 ) Ephemeris Epigraphica , II, S . 150- 151 = BRUNS-MOMMSEN-GRADENWITZ I. c. Nr. 83, S . 256 . (5 ) Provinsialprosess S. 15 , Anm . 8. Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians 285 serer Inschrift eben auf der vorgefassten Meinung, dass Nerva die Fiskalsachen dem ordentlichen Privatprozess unterworfen babe. Weitere Beispiele der im amtlichen Kognitionsverfahren be handelten Rechtssachen wollen wir hier nicht anführen , weil dies von unserem eigentlichen Gegenstande uns zu weit ablenken würde. Wir verweisen diesbezüglich auf den bereits oben angedeuteten Ueberblick von Bekker (1). Hier wollen wir nur noch darauf hin deuten, dass eine der wichtigsten Anwendungen dieses Verfahrens während der Zeit des Prinzipats die in der Beamtenkognition stattgefundene Appellation war (2 ), die hier das normale Rechts mittel gegen das Endurteil bildete ( 3) und die in der Kaiserzeit (1) Aktionen II, S . 194- 199. (2 ) Vgl. D . 49, 1 ; s. auch D . 49, 2 -13 init den weiteren Ausführungen des Appellationsrechts; Pauli Sent. V , 32- 37 ; C . Th. XI, 30 (Brev. VIII) C . Th. XI, 31-38 ; C . I, 7, 62 ; vgl. noch C . I. 7 , 63-70 . Aus der Literatur vgl. ausser den einschlägigen Abschnitten der Hand- und Lehrbücher der Geschichte und des Systems des römischen Rechts statt aller Fr. C. CONRADI, Jus provocationum ex antiquitate Romana erutum Lipsiae 1723, c. III- IV, S . 25 -55 ; C . W . KÜSTNER, Historiae provocalionum et appellationum apud veteres Romanos Specimen , 1, Lipsiae 1740 ; JOHANNES MERKEL , Abhandlungen aus dem Gebiete des römischen Rechts. Heft. II. Ueber die Geschichte der klassischen Appellation . Halle 1883; KIPP, Erörterungen zur Geschichte des römischen Civilprozesses und des inter dictum quorum bonorum I. Ein Erbschaftsstreit aus dem Jahre 384 n . Chr. in : Festgabe su Bernard Windscheids fünfzigjährigem Dohtor jubiläum . Zwei Abhand lungen von Rudolf Stummler und Theodor Kipp. Halle 1888. S. 74-85 ; Appella tion RE . II. Stuttgart 1896 . Sp. 194 -208; PERROT, L 'appel dans la procédure de l' Ordo judiciorum . Thèse de Paris . Paris 1907, dazu WENGER, Sav. 2 . XXX (1909) 479-482 ; SAVIGNY, System des heutigen römischen Rechts VI. Berlin 1847, $ 284 , S . 289-295 , Beilage XV. Appellatio und Provocatio S . 485 -500 ; MOMMSEN , Römisches Staatsrecht II, 23. S . 978 -988 , 1044, 1058, 1066 , 1000, s. auch 13 (1887 ) S . 233, 274-280, II, 13 (1887) S . 105 -108 ; III, 13 ( 1887) S . 704-705 ; III, 23 (1888) S . 1065, 1267. BETHMANN -HOLLWEG , Der römische Civilprozess, II, S . 46-47, 700 712, 762 ; III, 88 -90, 325 -338 ; F . L . v . KELLER -WACH , Der römische Civilprozess und die Actionens ( 1883) S . 256 , 419-425 ; Costa , Profilo storico del processo civile Romano . Roma 1918, S . 177 -183 ; WENGER, Institutionen d . röm . ZPR . S . 63, 201-202, 296 -298 . ( 3, Vgl. C . 1. 7, 62, 6 pr. 18 3 (Diocletian ) ; C . Th. XI, 36 , 18 (365 Dec. (?) 20 ; C . l. 3 , 1, 16 (a . 531) ; 7, 45, 16 (a . 530) ; C . I. 7 , 62, 36 (a . 527) . Aus der zu letzt angeführten Stelle geht zugleich hervor, dass die Appellation gegen ein Zwischenurteil grundsätzlich nicht gestattet wurde, weil die Möglichkeit einer Appellation hier nur zu unnützen und nachteiligen Verzögerungen gefübrt hätte vgl. auch C. Th. XI, 36 , 11 (355 Jul. 25 ) ; C . I. 7, 45 , 16 (a. 530 ). Wie wir un ten sehen werden , ist diese Regel durch einzelne Ausnahmen durchbrochen worden. Durch die Ausschliessung der Appellation erleidet hier niemand einen 286 Elemér Balogh von je her (1), in Zivil-, Kriminal- und Administrativsachen ( 2) Naehteil, weil ja das Zwischenurteil von der Appellation gegen das Endurteil ohnedies mitbetroffen wird . Wie wir es weiter unten sehen werden , finden wir in den Quellen für die Appellationen gegen Zwischenurteile sogar Strafandro hungen . (1) ( ab es auch von altersher keine ordentlichen Rechtmittel zur Anfech tung eines Urteils auf Grund materiellen Unrechts, was auch mit dem Fehlen verschiedener Obrigkeiten derselben amtlichen Wirksamkeit, deren eine der an deren untergeordnet gewesen wäre, zusammenhängt, so stellte bereits Augustus das Prinzip der Möglichkeit einer Appellation von allen Behörden des Reiches an den Princeps auf, wozu er sich durch die Ungerechtigkeiten der Rechts pflege, die in den letzten Zeiten der freien Republik überhandgenommen hatten , veranlasst sah , und zugleich übertrug er die Appellationssachen , wenn die strei tenden Parteien in Rom wohnten , jährlich dem Präſekten der Hauptstadt, einer Magistratur, die erst er neu geschaffen hatte (C. Suetoni Tranquilli Divus Au gustus c. 37 ed. Ihm S . 68), die der Provinzialen, auch aus den senatori schen Provinzen (D . 36 , 1, 83 (81) dagegen Männern , welche die Konsulwürde bekleidet batten und deren er jeder Provinz je einen für diese Rechtsfälle zuord nete, so dass jede Provinz einen Exkonsul in Rom als Appellationsrichter batte (C . Suetoni Tranquilli Divus Augustus c. 33 , 3 ed. Ihm S. 67 -68 ; vgl. auch Dio . Cass. LII, 21, 1-2 ; 33, 1 ed Boissevain II S. 393, 403). Ausnahmsweise kam es auch vor, dass der Kaiser aus besonderem Vertrauen dergleichen Berufungen an den Beamten , der das Dekret gefällt hatte, zu nochinaliger Erwägung übersandte (Dio . Cass. 59, 8, 5 ed. Boissevain , II, S. 626 ). Im übrigen baben die vorgenannten Appellationsrichter in den Provinzen ihre Stelinng auch später behauptet. Wir begegnen solchen noch auf Inschriften des dritten Jahrhunderts C . I. L . X , 1 Nr.5178 (S. 513), 5398 (S. 533); VI, 1, Nr. 1532 (S. 336 ); 1673 (S. 361); 8. auch MOMM SEN , Römisches Staatsrecht II, 23 . Leipzig 1883, S . 986 Anm . 1. Unbestreitbar war es nur einer der vorübergehenden Einfälle Caligulas, dass er am Anfang seiner Regieruug die republikanische Unabhängigkeit der Magistrate wieder . herstellen wollte und die Appellation an den Princeps aufhob ( C . Suetoni Tran quilli C . Caligula c. 16 , 2 ed. Ihm S. 162). Nach der Appellationsmöglichkeit an den Princeps wurde baldigst auch eine Appellation an den Senat einge führt, der diese Tätigkeit aber , wie es scheint, wesentlich durch Delegation an die Konsuln ausübte. Wie der Kaiser die an ibu gericbteten Civilappellatio nen regelmässig delegierte, scheinen die an die Konsuln und an den Senat ge richteten Appellationen ebenfalls durch stehenden Senatsbeschluss den Konsuln zur alleinigen Erledigung überwiesen worden sein (s. MOMMSEN , Römisches Staat recht II, 13, S. 107). Diese Appellation an den Senat stellte Nero , unter dem alle Appellationen von den die Rechtspflege verwaltenden Magistraten dem Se nat überwiesen worden sind , der an den Princeps gleich ( S . Tac. ann . XIV , 28 ...auxilque patrum honorem statuendo ut, qui a privatis iudicibus ad senatum provocavissent, eiusdem pecuniae periculum facerent, cuius si qui imperatorem appelarent; nam antea vacuum id solutnmque puena fueral, (2) Vgl. D . 49, 1, 12; 21 , 2; 49, 4, 1, 1-15 ; 49, 10 , 1; 2, 50, 16 , 244 ; V, I, 7, 62, 4 ; 7; il. Wie es aus den eben angeführten Stellen offenbar hervorgeht, Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians gleichmässig in der Form 287 der Kognition verhandelt wurde ( 1). Die Behörde, an die appellirt wird, untersucht und entscheidet durch Decretum , ohne dass ein Judicium angeordnet wird. Durch das Dekret wird die Beschwerde entweder verworfen und die Sen tenz bestätigt, oder für begründet erklärt und hiernach die Sentenz abgeändert. Wie bereits aus den eben vorher nur beispielsweise ange führten Fällen der im amtlichen Kognitionsverfahren behandelten Rechtssachen offenbar hervorgeht, handelte es sich dei der extra ordinaria cognitio der klassischen Zeit stets um ein Verfahren, das ausserhalb des Rahmens des eigentlichen Zivilprozesses fällt. Und dieses Verfahren tritt auch ein , wenn in Polizei- und Verwaltungs sachen ein damit zusammenhängender Rechtsstreit zu entscheiden war, was namentlich bei den kaiserlichen Praefekten in Rom häufig vorkam (2). Die extraordinaria cognitio beschränkte sich daher nicht auf die ein für allemal bestimmten Fälle im Ressort der Konsuln in der früheren Kaiserzeit und der sie ablösenden Spezialpräturen , der Volkstribunen der Kaiserzeit, des Oberaufsehers des Getreide wesens, dem zur Ergänzung der praetorischen Rechtspflege auch eine gewisse Gerichtsbarkeit zukam (3), und des Oberbefehlshabers der militärisch organisierten Schutzmannschaft und Feuerwehr für die nächtliche Sicherheitspolizei und den Löschdienst in Rom , dem war die Appellation neben dem Zivil- und Kriminalprozess auch in manchen Ad ministrativsachen zulässig . Während der Kaiserzeit scheint die Appellation das einzige Rechtsmittel gewesen zu sein , um die Aufhebung ungerechter Verwal tungsentscheidungen herbeizufüheen . So war die Appellation gegen die Ueber tragung von Vormundschaften zulässig , jedoch nach Verfügungen von Mark Aurel und Severus und Caracalla erst gegen das Dekret, durch welches die Ab lehnung der Vormundschaft verworfen wird. D . 49, 4 , 1, 1 ; 27, 1, 13 p . . ; 49, 1, 17, 1 ; 49, 10 , 2. Ebenfalls war die Appellation gegen die Vebertragung städtischer Aemter und sonstiger Lasten statthaft . D . 49, 1, 21, 2 ; 49 , 1, 12 ; 49, 4 , 1 , 2- 4 : 49, 10 , l ; C . 1. 7, 64 , 3 ; 7, 66 , 4 (a . 238 ) : 7, 62 , 4 ; 7 ; 11 ; 7, 64, 8 ; 9 ; C . Th . XI, 30, 10 (320 Jul. 8 ) ( = C. I. 7, 63, 1) ; XI, 30 ,53 (395 Mai 16 ) (= C . I. 7 , 62, 27). (1) C . I. 7 , 66, 5 . Imp. Gordianus A . Felici. Quamvis ancilta, de cuius do minio disceptabatur et a rectore prcvinciae contra le iudicatum fuerat, in fatum concesserit, tamen cum appellationem super ea interpositam fuisse et in numero cognitionum pendere proponas, ea provocajio suo ordine propter peculium ancil lae audiri debet. PP. VII k . Dec. Pio et Pontiano conss. (a . 238 ). (2 ) Vgl. D . 11, 7, 12 pr. ; 14 , 2 ; 43, 32, 1, 2 ; 50 , 13, 2. (3 ) Vgl. D . 14 , 1, 1, 18 ; 14, 5 , 8 ; 48 , 2 , 13 ; 48, 12, 3, 1. 288 Elemér Balogh erwiesenermassen auch eine Gerichtsbarkeit in Strafsachen und die Mietpolizei zukam (1), des Stadtpräfekten (2) und anderer Magi strate , deren Rechtsprechung gleichfalls Bedeutung gewinnt. Es sei hier aber zugleich betont, dass , während der Kaiser jede Rechts sache willkürlich annehmen und dann entweder selbst in Form der cognitio entscheiden (3 ) oder einen Vertreter zur Erledigung der selben in gleicher Form ernennen konnte, dessen Stellung natür licherweise eine neue extraordinäre war (4 ), die ordentlichen Ge richtsobrigkeiten dagegen , also auch der Praetor und die Provin zialstatthalter, nicht die Wahl hatten, ob sie eine Sache in den ordo iudiciorum privatorum leiten , oder zu ihrer eigenen Cognition ziehen wollten , sondern je nach deren Beschaffenheit durch ihr Edikt und die neueren Gesetze zu jenem oder diesem verpflichtet waren (5 ), sie nur, ob die Sache zu der einen oder anderen Kate - gorie gehöre, zu beurteilen hatten (6 ). Alle Kognitionssachen wa ren übrigens der obgenannten höheren Volks-und Reichsbeamten vorbehalten (7). Funktionell erscheint als Verfahren extra ordinem das Eingreifen der Kaiser, sei es als unmittelbare Abhilfe auf an sie geriehtete Gesuche, sei es im Reskriptprozess. Bekanntlich ist der Kaiser befugt, wie jeden Kriminalprozess, se auch jeden Zivil prozess und überhaupt jede nicht kriminelle Rechtssache an sich zu ziehen und an die Stelle des von dem zuständigen Magistrat zu fällenden oder gefällten Dekrets das eigene zu setzen. Es kann dies in der Weise geschehen, dass die betreffende Partei sich mit ihrem Gesuch (supplicatio) anstatt an den zunächst zuständigen Magistrat vielmehr an den Kaiser wendet und dessen Entscheidung anruft, worauf dann dieser, wenn es ihm beliebt, dieselbe im Wege der eigenen Kognition gibt, als sein Eingreifen soweit wie das Dekret des Magistrats reicht (8 ). (1) D . 12, 4, 15 ; 47, 2, 57 (56 ), 1 ; 201, 2, 9. ( 2 ) D . 1 , 12 , 2 . (3 ) Suet. Domitian 8 , 1; D . 28 , 5 , 93 (92 ). (4 ) Pauli Sent. V , 5 a , 1 ; D . 1, 2, 2 , 33 ; C . I. 3, 4 , 1, 2 ; Suet . Claud , 23, 1, Vesp . 10 ; Gell. XII, 13, 1. (5 ) C . 3, 3 . 2 (a . 294 ); 7 . 45, 4 (a . 229). (6 ) D . 1 , 18 , 8 . (7 ) D . 50 , 17, 105, (8 ) Vgl. D . 28, 5, 93 (92) ; C . I, 1, 19, 1 (a. 290) ; 22, 1 (a. 293); C. Th. 2, 18, 3 (Brev. II, 18, 2) (325 lal. 30) = C. I. 3, 1, 10 . Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians 289 Mit Recht hat aber bereits Mommsen darauf hingewiesen, dass dieses Verfahren , das, folgerichtig durchgeführt, die gesamte Recht sprechung an den Kaiser gebracht haben würde und bei dem es kaum möglich war , den streitenden Parteien gleiches und gerechtes Gehör zu gewähren , praktisch wenigstens in der besseren Kaiser zeit nur in beschränktem Umfang und hauptsächlich da zur An wendung gekommen ist, wo eine ausserordentliche die Befugnis des zuständigen Magistrats überschreitende Vergünstigung erwirkt werden sollte (1). Bestand das Institut der Supplikation , das in einer schon rechtshängigen ( 2) oder rechtskräftig entschiedenen Sache (3 ) der Regel nach verboten war, von jeher für den Fall, dass der Magistrat die Annahme der Appellation verweigert (4), so hängt das geordnete Supplikationsverfahren der nachdiocletianischen Zeit (5 ) wesentlich von der Einführung der Inappellabilität für die höchsten Reichsgerichte ab und ist, wie diese selbst, dem früheren Kaiserrecht fremd (6). Wie bereits vorher angedeutet, ereignete es sich stets seltener, dass der Kaiser selber untersucht und durch Dekret entscheidet, vielmehr er meist mit bestimmter Weisung, Reskript, die Untersuchung und Entscheidung einer Unterinstanz überlässt. Die Einholung eines kaiserlichen Reskripts durch eine Partei wird seit Hadrian üblich. Trajan hat auf Anfragen Privater noch nicht geantwortet (7). Ursprünglich erscheinen die kaiserli chen Reskripte lediglich als Gutachten. Unsere Ueberlieferung bietet uns eine grosse Anzahl von derartigen Kaisererlassen (8 ). (1) Vgl. D . 28 ,5 , 93 (92), cf. dazu Aeli Lampridi (Commodus) Antoninus 7, 5 -6 (Scriptores Historiae Augustae edidit ERNESTUS Hohl 1. Lipsiae 1927. S . 104 ); MOMMSEN, Römisches Staatsrecht II, 23 , Leipzig 1887. S . 975 -976. (2) C. I. 1, 21, 1 (a. 232); 2 (a. 316 ) = C . Th. XI, 30 , 6; II, 4, 4 (Brev. II, 4, 4 ) ( 885 lun, 18). (3) C. Th. XI, 30, 17 (831 Aug. 1) = C. I. 1, 21, 3; cf. 1V, 16, 1 (319 Dec. 26) = C , I. 7, 50, 3 . (4 ) Vgl. D . 49, 5 , 5 , 1 . (5) S . BETHMANN-HOLLWEG, Der römische Civilprozess III. Bonn 1866 & 137 Ziff. 3, S. 92 ff.; § 161 S. 338- 341. (6 ) S . MOMMSEN , 4 . a . 0 . S. 975 Anm . 1. (7 ) Vgl. Juli Capitolini Opilius Macrinus 13, 1 . (8 ) Vgl. C . Greg. 14 ; C . I. 4 , 65, 10 (a . 239) ; D . 34, 1, 3 ; 13, 1 = C . I. 6 , 37, 1 ; 2 , 19 (20), 3 (a . 238); 3, 32, 3 (a . 222) ; 3, 41, I (a . 223); C . Greg. 13, 1 = Vat. fr . 267 (a. 205 ) ; C . I. 4, 2 , 1 (a . 213); 4 , 32 , 13;' 3, 33, 2 (a. 215 ); 5, 11, I (a . 231) ; D . 22, 1, 17 , 1 ; 17 , 1, 6 , 7 ; 30 , 41, 7 ; C . I. 4 , 6 , 1 (a . 215 ) ; 2 (a. 227); D . 4, 2, 18 ; C . I. 2, 19, 1 (a. 223); 3, 42, 5 (a. 239 ); D . 42, 4, 7, 290 Elemér Balogh Aber bekanntlich sind die kaiserlichen Reskripte beim einfa chen Gutachten nicht stehen geblieben . Sie tragen in späterer Zeit durchaus den Charakter von Instruktionen an den Richter. Wie Pernice es richtig bemerkt hat, scheinen sie diesen aber erst all mählich und fast unbewusst angenommen zu haben (1). Der Ueber gang ist klar ersichtlich aus einigen Erlassen Hadrians, die durch Bittschriften der Partei veranlasst, aber an den erkennenden Beamten, der angewiesen werden soll, gerichtet sind (2). Seit der zweiten Hälfte des Zweiten Jahrhunderts, als schon von der Zeit des aus gebildeten Reskriptsverfahrens die Rede sein kann , ist der kaiser liche Erlass cin volkommenes Gegenstück der prätorischen Formel, welche Paralelle sich ins Einzelne durchführen lässt. Der Kläger reicht beim Kaiser die Bittschrift um dessen Eingreifen ein , die dann in der kaiserlichen Kanzlei behandelt und entschieden wird. Wird die Sache an den Unterrichter verwiesen , so wird das Re skript, das auch von der Ernennung dieses Unterrichters Kenntnis gibt, dem Kläger übergeben, der es dann unter notwendinger Ver wendung eines Exsekutors dem Unterrichter und unter dessen Mit wirkung in Abschrift weiterhin der Gegenpartei mit der Klage zu stellen lässt. Die ordentliche Gerichtsbehörde, an die der Kläger mit dem Reskript gewiesen wurde, hat nach Ermessen entweder die Sache extra ordinem zu untersuchen und entscheiden, oder einen Richter zu bestellen und ihn auf das Reskript zu instruieren (3 ). Das auf einseitigen Vortrag der Partei erlassene kaiserliche Re skript stellt die Rechtssätze fest, auf deren Anwendung und die Tatsachen , auf deren Beweis es ankommt, wofür fast jedes Reskript des Justianischen Codex Beispiele bietet. Der Kaiser zeichnet also dem Richter die Entscheidung vor, aber unter der auch stillschwei gend sich verstehenden Bedingung, dass die Tatsachen in Wahr heit so sind , wie die Bittschrift sie enthält. Bereits die Verfassung des Reskriptes, die auf den Tatbestand Bezug nimmt, deutet stets unbestreitbar darauf hin, dass das Reskript seine Erklärung von 16 s. auch PERNICE, Volksrechtliches und amtsrechtliches Verfahren in der rö mischen Kaiserseit. Juristische Abhandlungen . Festgabe für Georg Beseler zum 6 . Januar 1885 , Berlin 1885 S . 69 Text und Anm . 3- 7. ( 1) A . a . 0 . S . 71. ( 2) D . 5 , 3, 5 , 1 ; 42, 1, 33 ; 37 , 9 , 1, 14; 48, 3 , 12 ; 48, 5 , 28 (27), 6 ; 49, 14, 3, 9. (3) D . 1, 18 , 8; 9. Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians 291 der Richtigkeit des dargestellten Tatbestandes selbst abhängig macht. Mitunter wird dies sogar mit besonderem Nachdruck aus drücklich hervorgehoben ( 1). Gesetzwidrige und auf unrichtige oder ungenügende Ausführungen erlassene Reskripte gelten als erschli chen (2 ). Daher soll dem Reskripte die Bedingung : si preces veritate ni tantur entsprechend dem si paret Formel, aber auch ohne dies die Einrede der Erschleichung dagegen zugelassen werden (3). Der Gegner kann den dem Reskript zugrundegelegten Tatbestand als unwahr bezeichnen . Er konnte von jeher der ihm nachteiligen Wirkung des Re skripts durch den Einwand begegnen, dass es von dem Impetranten durch Entstellung der faktischen Verhältnisse erschlichen sei, be stehe diese Enstellung in der Beimischung falscher Tatsachen (subreptio ) oder in der Zürückhaltung wahrer (obreptio ). Gelingt dem Gegner der Beweis der vorgenannten Reskriptenerschleichung, so wird er freigesprochen (4). Uebrigens hat der Richter selber die Pflicht zu untersuchen , ob die Tatsachen in Wahreit so sind, wie die Bittschrift sie enthält. Er hat die etwaige Unwahrheit in der Bittschrift von sich aus im Untersuchungswege aufzudecken (5 ). Diejenigen Richter, die die Beschwerden über solche Bittschreiben , die Unwahrheit enthalten , zurückgewiesen haben, wurden mit Ent richtung von 10 Pfunden Goldes bestraft (6). Schon wegen Raummangels kann ich mich hier in die weitere Erläuterung des Reskriptprozesses nicht einlassen , wiewohl mich manche Streitfragen , die insbesondere durch die von Jean Mas pero veröffentlichten Kaiserreskripte, P. Cair. Cat. I 67024 -67029, ( 1) Vgl. C. II, 4 , 13, 2 (a . 290 ); s. auch C . 1, 23 , 7 pr. (a . 477). • (2 ) C . 1. 1, 22, I (a . 293) ; 2 (a . 294); 3 (a . 313); 4 (a . 333) = C . Th . 1, 2 , 6 (Brev. 1 , 2, 4 ) (333 Nov. 11); C. I. 1, 22, 5 (a. 426 ) ; Symm rel. (Epistularuni libri X ) 39 (52, 59) a. 381-385 (Monumenta G . H. Auctorum antiquissimorum yi, 1. Edidit OTTO SEECK, Berolini 1883 S. 311. ( 3 ) C . I , 23, 7 a . 477 . (4 ) Vgl. C . I. 1, 1, 2 pr. (a . 381) ; 1, 14 , 2 (a . 246) ; 10 , 16 , 7 (a . 385) = C . Th . I 2 , 9 (385 Sept. 24 ) = XI 1 , 20 ; C . I 1 , 22, 2 ( a . 294 ) ; s , auch C . Th . I 2, 3 (316 immo 317-8 Dec. 3); XIV 3, 20 (398 Apr. 25). (5 ) C . Th. I 2 , 6 ( = Brev. 1, 2, 4 ) ( 333 Nov. 11) = C . I. 1, 22, 4 . (6 ) C. 1, 22, 3 a. 313. 292 Elemér Balogh 67032 (1) hervorgerufen worden sind, hierzu verlocken würden. Wir müssen uns hier begnügen , einstweilen auf die einschlägigen Haupt quellen und Literatur zu verweisen (2 ). Der Gegensatz zwischen dem vorgenannten Eingreifen der Kaiser, der höchsten Macht im Staate oder ihrer unmittelbaren Vertreter und der ordentlichen Rechtsprechung erster Instanz der Provinzialstatthalter, zweiter Instanz der Appellations- und Resti tutionsgerichte bildet in der Periode des Kognitionsvarfahrens die Grenze zwischen ordo iudiciorum privatorum (privatum iudicium ) Verfahren extra ordinem . Während der Gegensatz zur Zeit des Formularprozesses das ganze Prozessverfahren erfasst, handelt es sich innerhalb des Kognitionsverfahrens nur um besondere ausser ordentliche Zuständigkeiten von Magistraten ; die Abweichungen im Verfahren sind nicht grundlegend. Aus diesen Ausführungen ergibt sich die Begrenztheit der ex traordinaria cognitio gegenüber dem klassischen Verfahren. Für diese Zeit mag auch zutreffen , dass es sich um ein mehr oder weniger der Diskretion des Beamten überlassenes Verfahren handelte ; diese (1) Service des antiquités de l' Egypte. Catalogue général des Antiquités Egyp tiennes du Musée du Caire, Nos. 67001-67124. Papyrus grecs d ' époque byzantine par M . JEAN MASPERO, I. Le Caire 1911 S . 53-63, 65-70. (2) Vgl. C . Th. I 2 : De diversis rescriptis ; II, 4 : De denuntiatione vel edi tione rescripti; C . I. I, 19 : De precibus imperatori offerendis et de quibus rebus supplicare liceat vel non ; 20 : Quando libellus principi dalus litis contestationem facit ; 21 : Ut lite pendente vel post provocationem aut definitivam sententiam nulli liceat imperatori supplicare ; 22 : Si contra ius utilitatemve publicam vel per men dacium fuerit aliquid postulatum vel impetratum ; 23 : De diversis rescriptis et pragmaticis sanctionibus. Aus der Literatur vgl. statt aller : BETHMANN -HOLLWEG , Der römische Civilprozess III, Bonn 1866, § 164, S . 350-352 ; PARTSCH, Neue Urkunden zum justinianischen Reskriptenprosesse, Nachrichten von der königli. chen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen . Philologisch-historische Klasse aus dem Jahre 1911. Berlin 1911, S . 201- 253; derselbe Juristische Literatur übersicht im Arch. Pap. V ( 1913) s. c. Nr. 55 S . 527-530 ; ERNST VON DRUFFEL, Papyrologische Studien sum byzantinischen Urkundenwesen im Anschluss an P . Heidelberg 311 München 1915 . Anhang . Bemerkungen zu den Kairener Kaiser reskriplen S. 74-92 ; Costa , Profilo storico del processo civile Romano. Roma 1918 , S . 197- 199; ANDT, La procédnre par rescrit. ( Paris Th, dr. 1920 ). Paris 1920, mit reichen Literaturangaben ; P . COLLINET, Le P . Berol. gr. inv. n.o 2745 et la procédure par rescrit au Ve siècle, in Revue égyptologique N . S . II Paris 1921 S . 70-81 ; WENGER , Institutionen des römischen Zivilprozessrechts. München 1925 S 32 S. 307-314. Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians 293 Formfreiheit konnte aber nicht die Formenstrenge erzeugen, die für Teile des Kognitionsverfahrens gilt. Für das Kognitionsverfahren ist daher der Ausdruck Extraor dinarverfahren wenig passend, wenn man nicht als Gegensatz das Verfahren einer bereits vergangenen Epoche fingieren will (1). Noch täuschender aber ist der Ausdruck “ nicht- förmliches Verfahren ,, den Samter in seinem 1911 erschienenen Buche auf die Cognition anwendet (2 ). Die Nichtförmlichkeit kann auf zwei Weisen verstanden werden : Entweder bezieht sie sich auf das Vor gehen des Beamten, den modus procedendi im engeren Sinne, oder sie bezieht sich auf die Befreiung von Beschränkungen , die das klassische römische Verfahren dem Kläger für die Formulierung seiner Anträge auferlegt. In beiden Punkten besteht aber im Kog nitionsverfahren die Nichtförmlichkeit nicht. Selbst da, wo die Ermessensfreiheit des kognoszierenden Beamten besteht, lässt sich ein typisches Verhalten erkennen ; obwohl er an die Parteivorschläge nicht gebunden ist , werden diese bei der Bestellung von Unter richtern zumeist berücksichtigt (3 ). Andererseits erhalten stets die (1) Haben bereits BETHMANN -HOLLWBG ( Der römische Civilprozess II, Bonn 1865 § 122 S. 762- 763) und MOMMSEN (Ueber den Inhalt des rubrischen Gesetzes, Gesammelte Schriften I. Juristische Schriften I. Berlin 1905 S . 170 Anm . 10 = Jahrbuch des gemeinen deutschen Rechts II, Leipzig 1858 S . 329 Anm . 10) die quellenwidrige « extraordinaria cognitio im weitern Sinne » von KELLER (Der römische Civilprozess und die Actionen . Sechste Ausgabe bearbeitet von Adolf Wach . Leipzig 1883 § 1. i. f. SS 74-80 S. 6, 371-409) abgelenbnt, nach dem eben alles, was der Praetor in Justizsachen ausserhalb des ordo iudiciorum privato rum tat, für extra ordinem und jede Cognition desselben für eine extraordinaria coynitio zu erklären wäre, so hat hernach WLABSAK die Vieldeutigkeit des ne gativen Begriffs extra ordinem überzeugend dargestellt (Kritische Studien zur Theorie der Rechtsquellen im Zeitalter der klassischen Juristen . Graz 1884 S . 85 96 ; derselbe : Cognitio RE . IV 1 Stuttgart 1900 Sp. 206 ff, 215 f; derselbe: Zum römischen Provinsialprosess (Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschafien in Wien . Philosophisch -historische Klasse. 190 . Band, 4 . Abhandlung). Wien 1919 S. 70 Anm . 36 ). Auch Wenger weist den gebräuchlichen Ausdruck cognitio extra ordinem oder extraordinaria cognitio für das amtliche Kognitionsverfahren ab ( Institutionen des römischen Zivilprozessrechts . München 1925 S 25 Anm . 1 S . 246 ). (2 ) Nichtförmliches Gerichtsverfahren , Weimar 1911. (3) Vgl. P. Lond . II Nr. 196 Col. I Z. 13- 16 (ed .Kenyon S. 153 = Neudruck bei Mitteis, Chrestonnathie, Berlin 1912, Nr. 87 S . 97. S. auch Berichtigung Kenyon und Bell. P . Lond. III S . 384) (Circa 141 n . Chr.) ; P . Oxy 1 67 (337 n . Chr. ), Z. 8. 11, 17 (ed . GRENFELL-Hunt (1898) S. 126 = Neudruck bei Mitteis a. a. 0. Nr. 56 S . 63-64 = MEYER : Juristische Papyri. Berlin 1920 Nr. 87 S . 297 . 294 Elemér Balogh gleichen Kategorien von Beamten die gleichen Aufträge als judices dati. Eine solche Gleichartigkeit des Verhaltens ist aber nich denk bar, wenn nicht eine formale Bindung vorgelegen hätte. Das Kognitionsverfahren umfasst die gesamte Periode vom Ende des klassischen Prozesses bis zum Beginn der justinianischen Periode. Aber ebensowenig wie klassisches und justinianisches Pro zessrecht unmittelbar aneinander anknüpfen, auch wenn die Spuren des Kognitionsverfahrens in wichtigen Punkten aus den justinia nischen Gesetzbüchern verschwunden sind, so wenig war das Ver fahren innerhalb der nachklassischen Periode einheitlich . Bis stark in das dritte Jahrhundert erhält sich in Rom das Geschworenen verfahren . Für Rom ist das Dasein der Volksrichter durch inschrift liche Zeugnisse bis in die Zeit der Severe unzweideutig bekundet ( 1). Auch die Provinzialstatthalter haben bürgerliche Rechtsstrei tigkeiten im Verwaltungsverfahren allgemein wohl erst seit der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts zu entscheiden. Noch für das Severische Zeitalter sind sichere Spuren des Ordo iudiciorum auch in den Provinzen zu erkennen (2). Andrerseits steht es aber ausser jedem Zweifel, dass es in dem absoluten Kaiserreich bereits unter der Herrschaft Diocletians und Konstantins I keine Volks richter mehr gab und um so weniger einen Judex, der von den Parteien nur mit dem Vollwort des Beamten bestellt wird . Wie für Rom innerhalb der nachklassischen Periode von einer Einheitlich -- - - - (1) CIL XI 1 Nr. 1836 (S. 341); 1926 (S. 363); s. auch 0 . E. HARTMANN, Ueber die römische Gerichtsverfassung, Göttingen 1886 § 31 S . 363 Anm . 43 ; UBBELODHE, bei GLÜCK , Ausführliche Erläuterung der Pandekten , Serie der Bücher 43 und 41 II Erlangen 1890 S . 539 ; MITTEIS , Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinsen des römischen Kaiserreichs. Leipzig 1891, s . 133 Anm . 34 ; WLASSAK , Zum römischen Provinzialprozess , Sitzungberichte der Akademie der Wissenschaften , Philosophisch -historische Klasse. 190 . Band, 4 . Abhan dlung. Wien 1919 S . 29 Text und Anm . 35 . Mit Unrecht hält MOMMSEN den Kaiser Marcus Aurelius für den letzten Kaiser, dessen Geschworenenadlectionen inschriftlich bezeugt sind ( Römisches Staatsrecht III 13, Leipzig 1887, S. 539 Anm . 1. Ebensowenig ist auch CuQ beizustimmen, der das Verschwinden des Ordo iudiciorum in den Beginn des dritten Jahrhunderts setzt. S . Etudes d ' épi graphie juridiques. De quelques inscriptions relatives à l'administration de Dioc létien (= Bibliothèque des écoles françaises d ' Athènes et de Rome. Fascicule XXI). Paris 1881 p . 117 - 121). (2) C . 3 , 8 , 2 (a. 213); 42, 211- 217 -- . . (a . 222); i, 53, 2 (Caracalla – regierte Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians 295 . keit des Prozessverfahrens nicht die Rede sein kann, so ist die Entwicklung auch in den Provinzen nicht einheitlich . Während sich anfänglich auch im Beamtenprozess die Verwei sung an Unterrichter aufrechterhält, tritt doch an ihre Stelle immer stärker die unmittelbare Eigenkognition der Provinzialstatthalter. Schliesslich wird dieses Verfahren, wie byzantinische Papiri aus Oxyrhinchos (1) uns es zeigen, bereits seit den Zwanziger Jahren des 5 . Jahrhunderts in Aegypten vom Libellprozess abge löst, dem Justinian seine endgültige Gestalt gegeben hat. Das nach klassische Verfahren entfernte sich dabei immer mehr vom For mularprozess, bis sich im Prozessrecht die justinianische Reform auswirkte . Der Kaiser hat auch auf diese Materie seine Neigung zu antiquarischen Restaurationen übertragen und eine Wiederher stellung der litis contestatio versucht. Der römische Zivilprozess war, unter diesem Gesuchtspunkt betrachtet, am Ende seiner Ent wicklung nicht so sehr, als kurz vor der justinianischen Epoche, am weitesten von seiner klassischen Form entfernt. Dieses Verfahren ist im folgenden darzustellen . Doch werden die Teile des Rechtsganges, die im nachklassischen Prozess wesent liche Umgestaltungen nicht erfahren haben , hier nicht gesondert behandelt . ** Dies gilt insbesondere für das Beweisverfahren , das erst durch die Einführung der Beweisregeln unter Justinian eine Erneuerung gegenüber dem Formularprozess erfahren hat. Auch der Reskripts prozess wird eine eigene Darstellung nicht erfahren, da er seiner Entstehung nach noch zur ausserordentlichen Kognition der Zeit des classischen Verfahrens gehört. Auf ihn wird nur an einzelnen Stellen verwiesen werden . Ebenso scheiden die Lehre von der Rechtskraft und der Vollstreckung aus, da es vorzuziehen ist,beide Punkte zusammen mit dem justinianischen Recht zu behandeln . Es kommt in der folgenden Darstellung hauptsächlich auf die Entwick lung der Neuerungen an, die der klassische Prozess erfahren hat: die generelle amtliche Streitansage und die Einführung des Versäumnisverfahrens. - Der nachklassische Prozess ist der Prozess des römischen Welt reichs während der Periode seiner Umformung vom augusteischen ( ) P . Oxy XVI, 1876-1881 ed . GRENFELL-Hunt and BELL, London 1924. S . 69 -83 . 296 Elemér Balogh Prinzipat zur absoluten Monarchie und zum Byzantinertum . Das Zentrum dieses Weltreichs lag nichtmehr in der Stadt Rom . Wenn auch der Sitz der Verwaltung sich dort noch befand, so bernhte doch die Macht des Reiches auf der Blüte der romanisierten und gräzisierten Provinzen , deren Städte die Träger der antiken Kultur waren . In ihnen war aber auch senatorischen Beamten frei, die punkten zu gestalten und die oder zu entwickeln , nach denen die Macht der kaiserlichen und Verwaltung nach neuen Gesichts Regierungsmethoden fortzubilden das Reich sodann verwaltet wurde. Der absolute Staat hat seine Grundlegung nicht so sehr in Rom gefunden , wo noch zur Zeit Trajans die republikanische Tradition lebendig war, wie die taciteische Geschichtsschreibung zeigt, Mass geblich war die Entwicklung in den Provinzen , seitdem Augustus sie davon befreit hatte, Aussaugungsobjekte der römischen Steuer pächter zu sein . In den Provinzen hatten die Statthalter eine viel grössere Macht, auch auf dem Gebiete der Rechtsprechung , als der Prätor in Rom , zumal sie in ihrer Hand die gesamte Gerichtsbarkeit in Zivil - und Verwaltungssachen verbanden. Es war ihnen daher viel eher möglich als dem römischen Prätor, den durch die Römer eingeführten oder schon vor der Eroberung geltenden ( 1) volksrecht lichen Geschworenenprozess durch ihre Eigenkognition , mindestens aber durch das Institut der Unterrichter (judices dati, pedanei) zu verdrängen . Diese übermächtige Stellung des Provinzialstattbalters auf prozessrechtlichem Gebiete machte die Provinzen zum Ausgangs punkt der Entwicklung. Hier konnte sich zuerst die Macht des Beamten restlos durchsetzen , der kraft seines Imperiums das jus vocandi frei betätigen konnte . Es darf uns deshalb nicht wundernehmen, wenn die Provinzen für das Prozessrecht der Kaiserzeit von ausschlaggebender Bedeutung sind. Die Unter tanen dieser unterworfenen Gebiete fügten sich zuerst dem neuen absolutistischen Regime, während Rom selbst noch bis in die späte Zeit Kaiser Konstantins, wie aus der Bestimmung des Cod. Th . II, 4 , 2 (322 Mai 23 ) zu entnehmen ist, an der die Mitwirkung des Privaten betonenden Form , der privata testatio , festhielt. Die Teil nahme der Behörde an der Einleitung des Prozesses und die aus einer Nichtbeachtung dieser Betätigung entstandene contumacia , (1) Vgl. Cic. in C . Verr. Il c. 13 § 33, s. auch Cic. p . Flacco 21, 49. Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians 297 kann nur auf dem Boden der Provinzen erwachsen sein. Diese Er kenntnis wird Wlassak verdankt der in seiner berreits erwähnter Schrift zum römischen Provinzialverfahren (1) zum ersten Male darauf hingewiesen hat. Unter besonderer Bezugnahme auf die Dissertation von Josef Partsch über die Schriftformel im römischen Provin zialprozesse , ( 2) sucht der österreichische Gelehrte für die Pro vinzen den von ihm so genannten “ verstaatlichten Formularprozess , nachzuweisen. Die Zweiteilung des Verfahrens in iure und in iudicio und die von den Parteien angenommene formula seien nicht unbe dingt mit dem von den Parteien frei gewählten Richter verknüpft. Wlassaks Stellungnahme entspricht folgendem Gedankengang : aus Gaius I 6 und IV 109 geht deutlich hervor, das in den Pro vinzen mit Formeln agiert wurde (3). Da wir die Blütezeit dieses Autors in die zweite Hälfte des 2. Jahrhunderts n . Chr. versetzen , so muss also noch zu dieser Zeit diese Verfahrensart im Schwange gewesen sein . Pernice (4) hat darauf hingewiesen , dass wir bis in die Zeit der Severe noch die Verwendung von Formeln in den Provinzen nachweisen können , wobei er sich auf die Ausführung von Mitteis (5 ) berief. Mit dieser Verwendung von Formeln befin det sich nun die Eigenkognition des Statthalters in einem augen scheinlichen Widerspruch . Dies umso mehr, als wir wissen, das der Statthalter ordentliche und ausserordentliche Gerichtsbarkeit in seiner Hand vereinigte (6 ). Aus diesem Konflikt gab es für Wlas sak nur den Ausweg, dass er das klassische Formularverfahren mit der Kognition der Statthalter vereinigte und aus diesen beiden , an sich grundverschiedenen Verfahren , ein neues entstehen liess, sei nen sogenannten verstaatlichten Formelprozess. Er hielt es sogar nicht für ausgeschlossen, dass in einigen Provinzen ein zweigeteilter Amtsprozess stattfand (7 ), in dem den iudices dati oder pedanei eine den alten Volksrichtern immerhin vergleichbare Stellung zukam . ( 1) Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissenschaften , Philosophisch historische Klasse. Wien , Bd. 190 Abh. 4 , 1919 vgl. S . 3 ff. ( 2 ) Breslau 1905 . ( 3 ) WLASSAK a . a . 0 . S . 4 f, insbes. S. 9 vgl. auch unsere späteren Aus führungen über die Ausbreitung des Formelverfahrens. (4 ) Parerga IV , Sav, Z . 13 (1892) S. 284 Anm . 2 . (5 ) Reichsrecht u . Volksrecht in den ösıl. Prov. des röm . Kaiserreichs, Lei pzig 1891 S. 133. (6) D. 1, 16 , 7, 2 ; 1, 18 , 10 ; 11 ; 12. (7 ) S. 24. Roma · II 298 Elemér Balogh Während namhafte Gelehrte wie L .Mitteis( 1) und Koschaker (2 ) der Wlassakschen Schrift weitgehead zustimmten , hat neuestens Boyé (3) die Lehre Wlassaks wieder stark angegriffen . Wir wollen diesem Streit nicht im einzelnen nachgehen . Wlassak hat u . E . aus den schon angeführten Gründen Recht, wenn er den Schwerpunkt der Entwicklung in die Provinzen verlegt. Worin unsere Ansicht von der Entwicklung im einzelnen sich von der seinen unterscheidet, wird sich aus dem späteren Lauf unserer Darstellung ergeben . Hier sei nur auf folgendes hingewiesen : Dass es Formeln gegeben hat, ist aus dem Formelverbot der Söhne Konstantins aus dem Jahre 342 (4) und den anderen zahl reichen Belegen unóestreitbar. Es ist nur die Frage, ob man mit diesen Formeln auch notwendigerweise das alte Formelverfahren in irgend einer Weise konserviert hat (5 ). Vielleicht kann man mit Pernice (6 ) annehmen, dass die Formeln in dieser Zeit materiell rechtlicher Natur sind. Jedenfalls sehen wir uns ausserstande selbst nur einen Lösungsversuch , wie Wlassak dies tat, zu wagen. Wir müssen uns damit begnügen , die Schwierigkeit anzuerkennen . In der Polemik zwischen Wlassak und Boyé wird von diesem grosser Wert auf die Interpretation der bekannten Stelle D . 1 , 18 , 8 und 9 gelegt. Diese Stelle ist in der Tat von Bedeutung, näm lich als frühestes Zeugnis für die Herrschaft des Amtsprozesses in den Provinzen (7). Denn sicher ist der oft wiederkehrende Satz des dort erklärten Reskriptes : “ eum qui provinciae praeest adire potes , (du kannst dich an den Statthalter wenden ) nicht eine Dis pensierung von einem sonst etwa erforderlichen Geschworenenver fahren . Es handelt sich vielmehr nach der ganzen Fassung der Stelle um eine Verweisung vor den auch sonst als Richter tätig werdenden Beamten (8 ). Ob aber in dem Verfahren vor diesem (1) Sav. Z . 40 ( 1919) 362. ( 2) D. L. 2. 1920 S. 365 f. (3 ) La Denuntiatio, introductive d ' instance sous le principat. Thèse de Bordeaux 1922, S . 217 , 284 ff. ( 4 ) C . 2 , 57, 1. (5) Sehr beachtlich die Ausführungen Boyés S . 298 f., insbesondere S. 302 . (6 ) Festgabe für Beseler , Berlin 1887, S . 73. (7) Vgl. über die streitige Frage der Datierung ausführlich Exkurs. (8 ) So schon KIPP , Geschichte der Quellen des röm . Rechts“, Leipzig 1919. S . 75 Text und Anm . 43 Für Schaffung einer besonderen Instanz Boyė S . 293. Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians 299 Beamten mit oder ohne Formel verhandelt wurde, ob dieses Ver fahren ähnlich oder unänlich dem alten ordo judiciorum privatorum verlief, ob in den Worten des Kaisers ausser einer Verweisung noch eine Prüfung der Schlüssigkeit (1) oder nur der Teil eines umfas senden Reskripts zu sehen ist (2), das alles lässt sich aus der Stelle garnicht eindeutig entscheiden (3 ). Die einzigen ganz sicheren Nachrichten über den Provinzial prozess in der römischen Kaiserzeit haben wir aus Aegypten , wo in den Papyri die Urkunden selbst zu uns sprechen . Das dort übli che Verfahren muss uns als Paradigma dienen . Freilich müssen von vornherein dabei zwei Vorbehalte gemacht werden . Einmal steht Aegypten während der gesamten frühen Kai serzeit unter einem besonderen Regiment; es ist nicht in dem Sinne römische Provinz, wie es die andern unterworfenen Gebiete sind . Seine ungeheure finanzielle Kraft liess es den Kaisern wünschens wert erscheinen , die Regelung des Augustus beizubehalten, und dieses in Personalunion mit dem Kaisertum verbundene Königreich von ihren Präfekten d . h . Vizekönigen verwalten zu lassen (4 ). Zum andern aber ist trotz der bereits seit den Jahrhunderten der Pto lemäer bestehenden Beamtenherrschaft durchaus nicht mit Sicher heit darauf zu rechnen, dass etwa grade die Ausbildung des Pro vinzialverfahrens, wie sie in Aegypten stattfand , auf Rom zurück gewirkt hat. Was übrigens den Zusammenhang zwischen dem rö mischen und dem ptolemäischen Prozess in Aegypten betrifft, so ist zu bemerken , dass wenn auch eine gewisse Aehnlichkeit des nachklassischen Provinzialverfahrens ins Aegypten mit dem ptole mäischen Prozess nicht geleugnet werden kann , wohl keine Abhän gigkeit, sondern nur eine Wesensverwandschaft der beiden Systeme vorliegt (5 ). ( 1 ) WLASSAK a . a . 0 . S . 19 -20 . ( 2 ) BOYÉ S , 293 . (3 ) Auch aus der Analogie der in Aegypten vorkommenden Formel: ÉVTV7€ TQ otparnym resp . Ènlotgatnyo , os tà ngoonzovta noivoe lässt sich kaum etwas entnehmen . ( 4) vgl. Cassius Dio 51, 17. (5 ) Die Trennung wird von Steinwenter daher zu schaft betont. Die unmit telbare Ableitung ist nicht das Wesentliche. Siehe « Studien zum römischen Versäumnisverfahren, München 1914 S . 101 ff. Ueber die Fortsetzung ptolemäi Methoden in Aegypthen durch die römische Verwaltung vgl. RostovéZEFF, Wirt schaft und Gesellschaft im römischen WICKERT, II, Leipzig 1931, S . 13 . ff. Kaiserreich . Uebersetzt von LOTHAR 300 Elemér Balogh Der ägyptische Prozess ist reiner Kognitionsprozess, kennt also keine Geschworene. Dagegen begegnen wir in ihm gleichwohl gewissermassen einer Zweiteilung des Verfahrens, die durch die Verweisung des Prozesses an den Unterrichter hervorgerufen wird . Diese konnte sowohl auf einseitigen Antrag an den Präfekten ohne mündliche Verhandlung, oder anch nach Verhandlung der Sache ausgesprochen werden . Selten ist die Verweisung im Termin vor mündlicher Verhandlung ( 1 ). Sie erfolgt durch ein auf die Eingabe gesetzte Únoygarí oder durch eine Èntoin des Präfekten . Diese kann den Auftrag enthalten, die Sache zu entscheiden oder auch nur den Auftrag, die Angelegenheit zu prüfen, mit den Parteien gütlich zu verhandeln und im Falle der Nichteinigung die Sache an den Präfekten zur weiteren Entscheidung zurückzusenden. Die Bestellung zur Entscheidung (noiveiv ) ergeht immer nur an einen höheren Beamten , nämlich den Epistrategen. Er soll die endgiltige Entscheidung treffen (2 ). Die Bestellung des Epistrategen erfolgt stets einseitig. Für die Verweisung ist die Formel ŠVTV7E TO ÉToroa TNyQ mit oder ohne Zusatz og tà ngoonkovta noujoei üblich. Diese Worte muten wie die Uebersetzung der D . 1 , 18, 8 , 9 stehenden lateini scher Worte eum qui provinciae praeest adire potes, wobei auch manchmal hinzugefügt wurde: is aestimabit, quid sit partium suarum . Wir sehen also hieraus eine weitgehende Uebereinstimmung in den Formularen von Kaiser und Präfekten , wie es ja auch der ähnli chen Machtvollkommenheit beider Instanze entspricht. ( 1) MITTEIS , Zur Lehre von den Libellen und der Prozesseinleitung nach den Papyri der früheren Kaiserseit, Berichte über die Verhandlungen der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig . Philologisch -historische Klasse 62. Band 1910, 4. Heft, Leipzig 1910 S. 123. (2) P . Lond. 2 Nr. 358 S. 172-73 (Nach dem 26 . Februar 150, nicht später als 153-154 nach Christus vgl. Z. 1, 17 ). Neudruck : MITTEIS, Chrestomathie Nr. 52 S . 57-58 und Paul M . MEYER , Juristische Papyri Nr. 83 S. 285-287. Nur nebenbei sei hier bemerkt, dass dieser Papyrus zugleich deutlich die Unzustän digkeit des Epistrategen zu eigentlicher Urteilsfällung bekundet (Z . 14 ff.). Denn der Gesuchsteller hatte sich schon an diesen gewandt, aber da derselbe die Sache nicht antscheiden mochte, muss er schliesslich den Statthalter auf dem Convent angehen . Es ist eine andere Sache, dass im gegeben Falle der Epistrateg kraft der ûnoypadý des Statthalters doch wohlzur Entscheidung berufen gewesen wäre. S. auch MITTEIS a . a . 0 . S. 103. Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians 301 Erfolgt die Verweisung an den Epistrategen sofort , so fällt die impetratio actionis vor dem Präfekten fort (1). In dem genann ten Papyrus bittet daraufhin der Beklagte, es solle dem Unterrich ter aufgegeben werden, seine Einreden (ragaygagai) zu prüfen . Diese Bitte ist deshalb auffallend, weil es ja selbstverständlich ist, dass der Beamte, vor dem das Verfahren stattfindet, das Vorbrin gen des Beklagten prüft. Boulard (2 ) hat angenommen , dass es sich um die Bitte um hinreichende Instruktionen zur Begrenzung der seiner Entscheidung zugewiesenen Punkte an den Unterrichter handelt. Hiergegen spricht, dass die Verweisung an den Epistrategen erfolgt, der sonst stets zur selbständigen Prüfung und Zulassung von actio und exceptio berufen ist. Mitteis hat daher den Papyrus Lips. 38 mit einer Restimmung von Theodosius und Valentinian aus dem Jahre 428, nämlich mit C . Th. 2 , 3 , 1 = C . J. 2 , 57 (58), 2 in Ver bindung gebracht. Die Konstitution wurde früher dahin ausgelegt, dass sie das Erfordernis für ein Zulassungsdekret zum Prozesse so wohl im judicium maius als minus regele . Wie die Darstellung der Prozesseinleitung zeigen wird, ist ein solches Dekret im judicium maius als Regel aber nicht bekannt. Der Prozess beginnt mit der Einreichung der Ladungsbitte .Die angeführte Stelle muss daher einen anderen Sinn haben. Mitteis ( 3 ) hat die Konstitution nicht auf die Prozesseinleitung selbst, sondern auf die Klageänderung bezogen. Es soll ein Verbot der Klageänderung bestanden haben , welches durch die Kaiser Theodosius und Valentinian auf die Fälle be schränkt worden sei, in denen sich nicht nur die Rechtsnatur der Klage, sondern auch der Sachvortrag geändert habe. Legt man C . Th . 2 , 3 , 1 = C . I. 2 , 57 (58), 2 in dieser Weise aus, so erhält allerdings die Bitte um Anordnung an den Epistrategen für das judicium maius aber auch für das judicium minus einen Sinn. Aller dings ist im judicium minus denkbar, wenn auch sehr unwahrschein lich, dass die exceptio non impetratae actionis auch in dem Sinn erhoben wird, dass man geltend macht, die editio und datio actionis (1) Pap. Lips. I 38 S. 122-123 s . auch 119-121, 124-125 ( Verhandlung vor dem Präses Thebaidis 390 n . Chr. in Hermupolis magna ) Nachträge von Wilcken Arch . Pap. IV (1908 ), 469-472; Neudruck : MITTEIS , Chrest. Nr. 97 S . 119 -121 u . PAUL M . MEYER , Jur. Pap. Nr. 91 S. 309-313. (2 ) BOULARD, Les instructions écrites du magistrat au juge commissaire dans l' Egypte Romaine. Thèse de Paris 1906 , S. 38, 60 . (3 ) MITTEIS , Libellen , s . 118-121. 302 Elemér Balogh sei vor der Verweisung nicht erfolgt. Die Möglichkeit besteht, da die Verweisung an den Strategen stets nach Verhandlung pro tri bunali erfolgt. Neben der Verweisung an den Epistrategen kommt aber auch die Verweisung an andere Unterrichter, insbesondere den Strategen , oder den ngomohitevóuevos der Stadt vor. Ihm aber wird im Ge gensatz zum Epistrategen Rechtsbelehrung erteilt ; er soll natà tà υπό του κυρίου ηγεμόνος κριθέντα entscheiden ( 1). Auf die Auswahl dieser Unterrichter haben die Parteien auch in Aegypten stets Einfluss (2 ). Die Unterrichter lheissen dann κριτής και μεσίτης. Nach Zwei Papyri scheint sich das Verfahren folgendermassen abgespielt zu haben (3) : der Kläger schlug selbst den koitus vai ședitns vor, die Gegenpartei erklärte ihre Zustimmung. Auf Grund dieser Verhandlung wurde sodann der Unterrichter ernannt. In einem Fall schlägt die Partei jedoch vor, der Präfekt solle von sich aus einen Unterrichter er nennen . Dieses Verfahren gewährt den Parteien praktisch einen grossen Einfluss auf die Bestellung des Unterrichter, soweit es sich um κριται και μεσίται handelt . Aber es handelt sich nicht mehr um das Recht der Parteien auf Geschworenenvereinbarung wie im alten volksrechtlichen Pro zess, sondern um ein aus Gründen der Praxis eingeführtes Verfa ren . In beiden Fällen beginnt die Verhandlung über die Bestellung mit einer Aufforderung des Präfekten, den Unterrichter vorzu schlagen . Es ist daher anzunehmen , dass der Präfekt das Recht hatte , einen anderen als den vorgeschlagenen zu ernennen . Die Ernennung wurde den Parteien durch Dekret mitgeteilt. Wenn C . I. 3 , 1, 2 (a . 210 ) von judice accepto spricht, so ist hiermit nur eine Kenntnisnahme, nicht ein Willensakt gemeint. Eine Ausnahme gilt für Prozesse über Statussachen , in denen die Bestellung von Unter richtern verboten ist. Hier besteht ein Rechtsanspruch der Parteien auf Entscheidung durch den Präfekten selbst. Die Konstitution (1) Pap. Oxy. I 37 II 7, 8 S. 81 (edd. GRENFELL-Hunt 1898 ). Neudruck MITTEIS Chrest. Nr. 79 S. 88 u . PAUL M . MEYER Jur. Pap. Nr. 90 S . 308. (2 ) Abweichend PARTSCH , Schriftformel S . 66 . ( 3 ) Pap. London 2 Nr. 196 (wohl 141 n . Chr.) S . 152 -154 Z . 12 f. Neudruck MITTEIS, Chrest. Nr. 87 S . 96 -97. Vgl. auch PREISIGKE, Berichtigungsliste , S . 255 ; Pap. Oxy. III, 653 S . 289-90 edd . Grenfell-Hunt 1903 aus dem Jahre 160- 162 Neudruck MITTEIS , Chrest. Nr. 90 S. 103-106 . Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians 303 Diocletians ( 1) bestätigt in diesem Punkte nur die bereits bestehende Praxis ( 2 ). Eine weitere Form der Delegation des Prozesses an Unterrich ter soll nicht zur selbständigen Entscheidung oder Vergleichung des Prozessstoffes führen , sondern ist von vornherein Verweisung zur Nachprüfung; sie ergeht auf einseitiges Libell hin an den Stra tegen , aber auch an andere Unterbeamte, avyojétal sogen . Rech nungsprüfer. Ihre Ausgabe 1st begrenzt auf εξετάσαι και αναπέμψαι. Es handelt sich um eine Art delegierter Beweisweisaufnahme. Aber auch die Strategen müssen die ihnen überwiesene Sache zu rückgeben , wenn die Entscheidung des Präfekten nicht ausreicht und eine neue einholen . Diese Form des Kognitionsverfahrens, die durch die zur Regel gewordene Ueberweisung an den iudex pedaneus eine scheinbare Zweiteilung aufrecht erhält, kann nun eingeteitet werden durch die Tagayyelia, das griechische Seitenstück zur römischen Denuntiatio. Mitteis ist es gewesen , der in seiner Abhandlung in den Berichten über die Verhandlungen der Kgl. Sächsischen Gesellschaft der Wis senschaften zu Leipzig , Philologisch -historische Klasse, 62 Band (1910 ), 4 . Heft : Zur Lehre von den Libellen und der Prozes seinleitung nach den Papyri der früheren Kaiserzeit, sich damit beschäftigt hat, die Libelle , die uns in den Papyri vorliegen , zu Gruppen zusammen zu fassen und voneinander zu unterscheiden . Er trennt Eingaben behufs polizeilichen oder friedensrichterlichen Schntzes oder auch zwecks Vormerkung der Streitsache im xata Xoglouis von solchen , die zur Einleitung eines Prozesses dienen sollen . Jene an den Hekatontarchen gerichtet enthalten zwar Bit ten um Vorführung des Gegners, enden aber niemals mit einer zi vilprozessualen Entscheidung, höchstens indirekt (3 ). Die Ver merkung im rata yopiovos hemmt die Verjährung des eingetragenen Anspruchs. Sie wird vor allem da beliebt, wo man den Verpflich teten noch nicht hat identifizieren können . Inwieweit die Hilfe der Behörde zur Auffindung des Verpflichteten in Anspruch genommen wird , ist nicht mit Sicherheit zu erkennen . Die formelmässigen Worte hoog tò ÞÉVELV poi töv hoyov geben dafür keinen Anhaltspunkt. (1) C . 3, 3 , ?, Satz 3. Vgl. Exkurs a . E . (2 ) BGU 114, I, 3. S . 131 ed . WILCKEN. Neudruck MITTEIS , Chrestomathie Nr. 372 S . 419 . (3) Mitteis a . a . 0 . S. 105 . 304 Elemér Balogh Zur Einleitung eines Prozesses dienen hingegen nur zwei For men des Libellus. Einmal die 'nouvnuata das sind den Präfekten während einer öffentlichen Sitzung von den persönlich erschienenen ( 1) Parteien übergebene Eingaben, die von dem Magistrat durch sub scriptio oder subnotatio erledigt werden . Sie sind wohl zu unter scheiden von den Émotohai, mit denen die Statthalter allenthalben überschüttet zu werden pflegten und gegen die sie sich nach Kräf ten zu wehren suchten (2 ). Die Erledigung derartiger Gesuche liegt ausschliesslich im Belieben des Statthalters. Häufig erfolgte die Verweisung auf den ordentlichen Prozessweg. Die Erledigung der únouvnuata erfolgte durch Beauftragung eines Epistrategen oder Strategen seitens des Präfekten . Wie die Ladung dann statt hatte ist nicht mit Sicherheit festzustellen ; Mitteis entscheidet sich für eine hohe Wahrscheinlichkeit der Evocation (3 ). Zweitens kommen wir zu der Gruppe, die für unsere Frage besondere Wichtigkeit hat. Es wird am besten einführen , wenn wir das Petitum eines solchen Papyrus z . B . BGU 226 Fayum anno 99 post Christum (4 ) wörtlich anführen : džuw ,kataympiodÉVTOG napà 000 toútov toŰ ÚnouviMatos, αντίγραφον δι' ενός των περί σε υπηρετών μεταδοθήναι το Σαταβούτι όπως ειδή παρέσεσται ( 1 . παρέσεσθαι) αυτόν... ού εάν ο κράτιστος ηγεμών Πομπήιος Πλάντας τον του νόμου διαλογισμόν ποιήται προς το τυχών με της από του( σου) βοηθείας. Antragsteller ersucht nach Vermerkung zu einer Eingabe zu den Akten des Strategen , an den sie gerichtet ist, eine Abschrift durch einen der Diener dem Satabous übergeben zu lassen , damit dieser wisse , dass er sich einfinden müsse, dann , wenn der erhabene Präfekt Pompejus Planta den Convent des Gaues abhält, damit auf diese Weise Antragsteller von dem Strategen Rechtshilfe erlange. Diese Ladung auf den Convent (ragayyɛaia ) wird in zwei Exemplaren überreicht, eines davon wird von einem Beamten des Strategen zu gestellt. Inhalt dieser Ladungsschrift ist die Aufforderung an den Gegner, zu Beginn des Convents vor dem Statthalter zu erscheinen und während seiner Dauer bis zum Aufruf der Sache und Verhand (1) Suet . Octavian cap. 53, Domitian cap. 17 . ( 2) So ist jedenfalls Libanius, adv. assidentes magistratus c. 11 ( ed . FÖRSTER 4, S . 11), Oratio adv. Eustath, c . 61. (FÖRSTER 4 , S . 97) zu interpretieren , aber auch 2 Stellen des C . Th. 1, 16 , 10 (anno 365) u . ibidem 13 anno 377). (3 ) MITTEIS a . a . 0 . S . 84 , 96 . (4) Ed. VIERECK. Neudruck Mitteis, Chrest Nr. 50 S. 56. Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians 305 lung anwesend zu bleiben . (sta gÉDEOJAI, ngoonagtegeTV TQ Bňuatı, Agooed QEVELV) (1 ). Diese Ladungen auf den Convent sind im Gegensatz zu den &rlotohai und wohl auch zu den únouvnuata die ordnungsmässige Ladungsbitte. Sie unterscheiden sich von dem libellus conventionis der Zeit Justinians entscheidend dadurch , dass sie noch keinerlei Angabe des Streitgegenstandes enthalten , sondern eben nichts weiter als eine blosse Ladungsbitte sind. Das musste auch so sein ; denn sie waren ja nicht an den Richter sondern an einen untergeordneten Verwaltungsbeamten gerichtet. Das Erscheinen auf dem Convent ist Pflicht beider Parteien. Sie müssen sich bei Aufruf der Sache melden . Bei Ausbleiben wird einseitig verhandelt (2 ). Die Parteien können jedoch ihre Verhand lungsbereitschaft feststellen lassen . Da die Conventszeit sehr lange dauert, so bitten die Parteien bisweilen, sie von längerem Warten zn entbinden und in ihre Heimat zu entlassen , die Streitsache aber an den zuständigen Epistrategen zu verweisen (3 ). In späterer Zeit werden die Ladungsbitten auch vom Archidikastes autorisiert, die Vollziehung erfolgt jedoch durch den Strategen (4), dem das die Ladung autorisierten Schreiben mit einem Hypomnema überreicht wird . Diese sogenannte nagayyehia entspricht im wesentlichen der Li tisdenuntiatio der späten Kaiserzeit, ausser dass durch das Fort fallen des Convents die Ladung vor diesen nicht mehr erfolgen konnte. Auch die für die Litisdenuntiatio charakteristische Viermo natsfrist ist hier noch nicht vorhanden . Sonst aber haben wir voll kommen das Bild der denuntiatio , und zwar der ex auctoritate. Es kann keinerlei Rede davon sein , dass diese Ladung privater Natur sei, die Gaubehörde, der Stratege, nimmt sie an und lässt sie durch einen Beamten seines Officiums zustellen , also auch die Zustellung erfolgt durch eine Amtsperson . ( 1) MITTEIS a, a. 0 . S . 83-85 . (2) Pap. Hamburg 29, 9 (89 nach Christ). Neudruck Paul M . MEYER, Jur. Pap. Nr. 85, S. 293. (3 ) Pap. Oxy. 3 , 486 edd. GRENFELL-Hunt. Neudruck MITTEIS, Chrest. 59, S . 65-67 ; und PAUL M . MEYER, Jurist. Pap. Nr. 84, S . 289-290. (4) Pap. Giss J. 34 ed . EGER . Neudruck MITTEIS , Chres. Nr. 75 ( 265-66 n . Chr.) S . 83-85. Elemér Balogh 306 Wichtig ist dabei allerdings die Beobachtung Boyés ( 1) auf Grund des Pap . Hamburg I 29. Dieser Papyrus, zwei Abschriften aus den Amtstagebüchern zweier Präfekten enthaltend, die zur Zeit Domitians amtierten, gibt in seinem zweiten Teile von einer testatio privata Kunde. Die Beweisführung Boyés gegen Paul M . Meyer, der hier eine Verhandlung zwischen dem Präfekten und dem Strategen des Gaues, der in den ersten drei Jahrhunderten nach Christus gewöhnlich lud , sehen wollte, wird vor allem dadurch er härtet, dass für den amtlichen Zusteller, den ÜMNOÉTNS des Strategen ein Zeugenbeweis für seine Zustellung durchaus überflüssig gewesen wäre, und wir hier davon hören, dass der Präfekt die Rechtskraft der Zustellung anzweifelt, weil ein Zeuge verdächtig erscheint. Wir werden also Boyé zustimmen, der in diesem Papyrus einen Beweis dafür sieht, dass in Aegypten die beiden Formen der privaten und amtlichen Ladungszustellung nebeneinander bestanden haben. Die römischen Bürger, wie es hier Salvius Maior und Apronius Celer unzweifelhaft sind, werden sich jener bedient haben , da dies die ihnen gebräuchliche Art der Ladungszustellung war, während für die einheimische Bevölkerung die amtliche Zustellung schon aus der ptolemäischen Zeit her üblich war. Erst der bekannte Erlass Constantins (2 ) hat für Boyé diesem Nebeinander ein Ende ge macht. Uns scheint mit diesen Folgerungen doch noch nicht der ganze Inhalt des Papyrus ausgewertet und erschöpft. Die römische Art, die sich hier unter römischen Bürgern in Aegypten gehalten hat, wird sich ohne Zweifel auch in den Provinzen des Imperiums durchgesetzt haben . Wenn schon in Aegypten, das, wie nicht oft genug betont werden kann, bis Diocletian ausserhalb der römischen Provinzialverwaltung geblieben ist, römische Bürger nach römischem Brauch miteinander zu prozessieren anfingen, so wird dies unzwei felhaft in der frühen Kaiserzeit überall so gewesen sein. Man darf doch nicht vergessen , dass bis zur Zeit Hadrians das römische Bür gerrecht nur sehr schwer verliehen wurde, dass vor allem Augustus in seinem politischen Testamente (3) vor Ueberfremdung gewarnt (1) BOYÉ, I. c. S . 86 ff, gegen PAUL M . MEYER , (Griechische Papyrusurkun den der Hamburger Stadtbibliothek , I 2 , Leipzig 1913. S . 124 -125 ; Juristische Papyri, Berlin , 1920, Nr. 85 . Einführung s. insbesondere S . 88 f. ( 2) C. Th. 2, 4 , 2 (322). (3 ) Dio Cassius 56, 33, 3 . Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians 307 hatte . Wir haben dafür noch in der Zeit Trajans in den Briefen des jüngeren Plinius an Trajan 5 ; 6 ; 11 einen durchschlagenden Beweis. Man war sich also seiner römischen Eigenart noch voll bewusst, wes halb auch grundsätzlich davor zu warnen ist, bereits für das erste Jahrhundert einen Einfluss der Provinzen in Rechtssachen auf die stadt Rom anzunehmen . Der früheste Termin . der dafür in Frage kommt, dürfte das zweite Jahrhundert sein , wo wir mit Kaiser Trajan , einem Spanier, auch den ersten Provinzialen auf dem rö mischen Kaisertron finden . In diesem Zusammenhang muss auch der viel behandelten Stelle des Sextus Aurelius Victor de Caesaribus 16 , 11 Erwähnung getan werden . “ Legum ambigua mire distincta vadimoniorumque sol lemni remoto denuntiandae litis opperiendaeque ad diem commode ius introductum , . Diese viel berufene Stelle hat für uns unter folgen dem Gesichtspunkt Bedeutung : Wlassak ( 1) will aus ihr entnehmen , dass der Kaiser Marcus in den Provinzen die Vadimonien beseitigt und die Prozesseinleitung durch Streitansage eingeführt habe, so dass der uns aus Aegypten bekannte Parangelieprozess bezw . ein âhnliches amtliches Verfahren durch Kaiser Marcus in den Pro vinzen obligatorisch geworden sei, (aber nur für die Fälle wo “ Ersatz durch Denuntiation geboten war , (2) während im übrigen die Vadimonien nur entberhlich geworden sein sollen ), und dort das Vadimonialverfahren verdrängt habe. Durch seine noch zu besprechende Interpretation der Ulpianstelle D . 2 , 12, 1 hat Wlassak ferner zu zeigen versucht, dass dieses aus den Provinzen stammende Verfahren über Italien (juridici) nach Rom gedrungen ist, und so die Prozesseinleitung durch Litis denuntiatio sich durch gesetzt habe (3). Zu diesem Fragenkomplex gilt es, kritisch Stellung zu nehmen . Wlassak ( 4 ) hat sich mit Bethmann - Hollweg (5 ) und Baron (6 ) nur für einen Rückgang des Vadimoniums, nicht wie Kipp (7 ) für (1 ) WLASSAK , Provinsialprozess, S . 37 f. ( 2 ) WLASSAK a . a . 0 . S . 42. (3 ) WLASSAK a . a . 0 . S . 62 -82 . ( 4 ) WLASSAK a . a . 0 . 41. (5) M . von KETHMANN-HOLLWEG. Der römische Zivilprozess. II Bonn 1865 , S . 202 Anm . 33. (6) BARON, Abhandlungen aus dem röm . Zivilprozess. III. Der Denuntiations prosess Berlin 1887 S . 70 . (7 ) KIPP, Die litisdenuntiation , Leipzig 1887 S . 172. 308 Elemér Balogh vollständige Abschaffung entschieden. Ihm folgt Boyé (1 ), er kommt aber insofern über alle seine Vorgänger hinaus, als er das Problem nicht in der Einführung der litis denuntiatio in Rom , sondern in dem mit diesen Worten verbundenen Text “ denuntiandae litis op periendaeque ad diem commode jus introductum , sieht. In der Tat war die denuntiatio seitens der Behörde in der cognitio extra ordi nem neben dem edictum und den litterae eine der drei herkömm licben Formen der amtlichen Ladung, vor allem dann angewandt, wenn der Beklagte im Bezirk des ladenden Magistrats wohnt ( 2 ). Von introducere dabei zu sprechen, wäre also wohl kaum möglich gewesen . So liegt also der Nachdruck auf dem zweiten Teil des Satzes, dem Zwang, bis zum Ablauf einer bestimmten Frist sich auf den Prozess einlassen zu müssen (3 ). Hier ist wohl mehr als ein Grund, der die Bezeichnung commode für dies Verfahren als berechtigt erscheinen lässt. Gegen das alte vadimonium , Bürgschaft seitens des in jus vocatus für sein Erscheinen vor Gericht, musste diese neue Form als Vereinfachung und Erleichterung gelten , zu mal, wenn mit ihr, da sie ja eine amtliche Ladung war, das Ver säumnisverfahren , die contumacia , zwangsläufig verbunden war. In der Tat ist kein zwingender Grund dafür vorhanden, mit Wlassak (4 ) die Geltung der bei Aurelius Victor zitierten Konstitution auf die Provinzen zu beschränken . Boyé (5 ) ist zuzustimmen , wenn er da rauf hinweist, dass Wlassak den Beweis für die tiefe Verwurze lung des vadimonium in dem römischen Provinzialprozess schuldig bleiben musste. Ein solcher Beweis wäre aber von Wlassak zu ver langen , denn die Stelle bei Aurelius Victor von einer Ersetzung der Vadimonien kann sich doch nur dann auf die Provinzen beziehen , wenn dort die Vadimonien überhaupt eine Rolle spielten. Dass Vadimonien in Rom noch nach der Zeit Kaiser Markus nachweis bar sind, braucht uns nicht zu kümmern . Wissen wir doch , dass das römische Recht auch Legisaktionen - und Formularverfahren nebeneinander hat bestehen lassen . Boyé wird weiterhin mit seiner ( 1) BOYÉ, d . a . 0 . S . 273 ff. ( 2) BOYÉ, S . 160. ( 3 ) BOYÉ, S . 276 . (4) WLASSAK Provinzialprozess S. 37.Wie WLASSAK : Mitteis, Sav. Z. XL , 362 f ; KoschAKER DLZ 1920, 366 ; P . M . MEYER Z Vergl R . XXXIX , 273 ; WEN GER, Institutionen des römischen Zivilprozessrecht S . 261 Anm . 7 . (5 ) BOYÉ, C. 278. Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians 309 Vermutung Recht haben , dass hier in Rom der Ort gewesen ist, wo sich die Viermonatsfrist der späteren litis denuntiatio entwickelt hat. Für die Provinzen ist kaum daran zu denken, da ja die Ladung hier in der Regel, wie wir gesehen haben, auf den Convent erfolgte und dieser an bestimmten Daten in den einzelnen Konvents orten seine Gerichtssitzungen abhielt (1). Es ist mir auch viel ein leuchtender, dass man zu Diocletians Zeiten bei der Aufhebung der Konventsordnung die in Rom gebräuchliche Frist einführte, als dass man von ungefähr auf diese Zeitspanne gekommen wäre, Jedenfalls bleibt als Resultat der Untersuchung der Stelle bei Au relius Victor die Ueberzeugung, dass hier zum mindesten eine Ein zelheit aus dem provinzialen Verfahren in das stad trömische über nommen worden ist, nämlich opperiendae litis etc. Es ist aber nicht richtig, dass die gesamte Entwicklung der Denuntiatio , ausgehend von dem verstaatlichten Formularprozess, den wir weiter oben be trachteten , auch eine Denaturierung des Formularprozesses in Rom selbst nach sich zog. Auf diesem Marsch nach Rom sollten nach Wlassak die juri dici in Italien aus dem zweiten Jahrhundert eine Station bilden ( 2). Das Amt der juridici ( 3 ) war von Hadrian geschaffen worden . Antoninus Pius hatte es beseitigt, Kaiser Marcus es bald nach sei nem Regierungsantritt neu eingeführt (um 163 ). Seitdem ist es bis zur Reform Diocletians bestehen geblieben. Italien war in vier Ge richtssprengel geteilt ; an der Spitze eines jeden stand ein juridicus. Das Verfahren vor ihm war das Kognitionsverfahren. Ihre Neuein richtung bedeutet also für Italien das Ende der Prozesseinleitung durch Vadimonien und insbesondere des vadimonium Romam fa ciendum , um den Prozess vor den Praetor zur ziehen . Der iuridicus (1) WILCKEN, Der agyptische Konvent, Arch . f. Pap. IV (Leipzig 1908) S. 366-422 mit weiteren Anführungen . (2) WLASSAK , Provinzialprosess, insbesondere S. 59 ff. ( 3) Vgl. MOMMSEN, Römisches Staatsrecht II 23, Leipzig 1887 S . 1084-1086 ; MARQUARDT, Römische Staatsverwaltunh 1² , Leipzig 1881, S . 224-227 ; 0 . Hirsch FELD : Die kaiserlichen Verwaltnngsbeamten bis auf Diocletian?, Berlin 1905, S . 127 f, 219 f; 350 ff; C . JULLIAN, Les transformations politiques de l' Italie sous les empereurs Romains. Paris 1884, S . 118 -136 . JÖRS, Untersuchungen zur Ge richtsverfassung der römische Kaiserzeit. Leipzig 1892 S . 52-72 mit weiteren Anführungen ; ROSENBERG , Juridicus RE . X 1919 Sp. 1147 ff. Vor allem Wlassak , a. a. 0 . S . 59-62, 73-78 , 82 . 310 Elemér Balogh kommt unter seinem richtigen Namen nur noch einmal in den Di gesten vor: bei Scaevola 1. 4 resp . 287 D . 40, 5, 41, 5 , und hier nich im Munde des Juristen , sondern des Fragestellers, der ein Gutachten erbittet (1). Der in D . 1, 20, 1 und 2 erwähnte iuridicus ist der iuridicus qui Alexandriae agit, ein ägyptischer Magistrat, dessen Amt durch ein besonderes Gesetz unter Justinian geschaffen worden ist Dagegen will Wlassak in D . 2 , 12, 1 an Stelle der praetores die iuridici einsetzen . Nach ihm kann in der Stelle vier mal genannte praetor nicht ursprünglich in ihr gestanden haben . Es läge Interpolation vor. Dass Original hätte jedenfalls von den Iuridici gehandelt, deren Judikatur in der von Ulpian hier kom mentierten Oratio Divi Marci näher geordnet gewesen wäre (2 ). Die angeführte Stelle entstammt dem wierten Buche der Schrift Ulpians, De omnibus tribunalibus. In ihr wird die Ferienordnung Marc Aurels kommentiert. Sie ist nicht vollständig erhalten , vor $ 1 fehlt ein Satz, worin Ulpian von verklagten Parteien sprach , die schon der ersten Landung Folge leisten , obwohl diese gegen die Marcische Ferienordnung verstiess, da $ 1 bereits mit der zweiten Ladung durch den Beamten beginnt. Die kommentierte Stelle der Oratio Divi Marci behandelt die Einführung der Ge richtsferien während der Zeit der Ernte und Wein lese. Die Echtheit dieser Stelle ist zwar in verschiedenen Punkten wiederholt bestrit ten worden ( 3), jedoch hat erst Wlassak angezweifelt, dass der in den Paragraphen 1 und 2 viermals genannte praetor auch in dem ursprünglichen Texte von Ulpian gestanden hätte. Die Beziehung auf den römischen Praetor erscheint hier sehr zweifelhaft, dafür ( 1) WLASSAK, Provinsialprosess S . 60-61. ( 2) WLASSAK , Provinzialprozess Kap. IV . S . 62 ff. (3 ) Vgl. z . B . BESELER, Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen , II, ( Tübingen 1911), 35 ; III ( 1913 ), 44 ; IV (1920), 117 ff; GRADENWITZ, Conjecturen Zeitschrift für das öffentliche- und Privatrecht der Gegenwart. XVIII (Wien 1891) S . 348 Anm . 21 ; HUVELIN , ètudes sur le furtum dans très ancien droit romain , Lyon 1915 ( = Annales de l'université de Lyon N . S . 2 fasc. 29) S. 348 Ayon 1915 ( ed." Der summat; LENEL 198 Anm .5; Siena 190 S . 544 Anm . 1 ; H . KRÜGER , Der summatim cognosere und das klassische Recht Sav. Z . XLV (1925) S . 83 Anm . 1 ; LENEL, Pal. II, Ulp . 2271, Sp. 995-996 ; PERNICE, Parerga V Sav. Z . XIV ( 1893) S . 158 Anm . 5 ; Seckel bei HEUMANN -SeckEL, Handlescicon zu den Quellen des römischen Rechts , Jena 1907 8. v . iudicium 6b S . 297 ; VASSALLI, Miscellanea critico di diritto romano II in Annali della Facoltà di giurisprudenza della Università di Perugia 1914 S . 52 ; WLASSAK , Römische Processgesetze II, Leipzig 1891 S. 44-47 mit Anm . 47 . Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians 311 ihn als einem städtischen Magistrat die Ernteferien doch keine Be deutung hatten, andererseits das vadimonium Romam faciendum durch Kaiser Marcus beseitigt war. Nicht in Frage kommen die Praesides Provinciae, deren Amt Ulpian bereits in dem Werke : De officio proconsulis behandelt hatte. Es muss sich vielmehr um eine Behörde handeln , die mit ländlichen Gerichtsunterworfenen zu tun hatte, und die im Kognitionsverfahren entschied. Die im § 2 nach der Florentiner Handschrift vorkommende Mehrzahl: ad prae tores venire weist auf eine Gruppe von Beamten in gleichen Funk tionen hin . Da wir von Ulpian keine Stelle haben, die die zu seiner Zeit sehr bedeutsamen Juridici behandelt, so findet Wlassak neben den vorher erwähnten Gründen auch hierin einen Grund, der die Beziehung unserer Stelle , in der ussprünglichen Fassung, auf den Juridikat nahelegt (a . a . 0 . S . 73) und die kompilatorische Ver fälschung der iuridici in praetor erraten lässt, worin ihm vor allen Mitteis beipflichtet ( 1). Somit ergäbe sich aus D . 2 , 12, 1 für Italien vom Ende des zweiten bis zum Ende des dritten Jahrunderts ein Kognitiovsverfahren mit Evocationsladung und Versäumnisurteil. Der Beklagte wurde -- wohl nach Einreichung einer Schrift beim Juridicus — geladen , entweder litteris, wenn et nicht im Immediat sprengel des zuständigen Richters seinen Wohnsitz hatte sondern einem andern lokalen Magistrat unterstand (2 ), oder denuntiationibus, wenn er sich im Immediatsprengeldes Gerichtsmagistrates aufhält( 3 ), oder edictis, falls sein Aufenthalt unbekannt war (4 ). Erschien er nach mehrfacher Ladung nicht, so erfolgte Versäumnisurteil. Wlas sak nimmt für dieses nur zweimalige Ladung an (5 ); jedoch könnte “ perseveraverit , in D . 2 , 12, 1, 1 auch auf die übliche dreimalige (1) Sav. 2 ., XL (1919) S . 363. (2) Fragm . Vat. 162, 163, 165, 166 , 210 , s. auch D . 5 , 3 , 20, 60; 40, 5 , 26 , 9 ; 42, 1, 53 : 48, 17, 1, 2 ; 4 pr. (3 ) D . 5, 3, 20, 60, 11 ; 40, 5 , 26 , 9 ; 48, 19, 5 pr. (4) D . 5, 3, 20,60 ; 48, 19, 5 pr.; s. auch D . 26 , 10 , 7, 3; 27, 2, 6 ; 38, 17, 2, 41; 42, 1 , 53; 48, 17 , 1 ; 2 ; 4 pr. ; 49, 14 , 2 , 3 ; 15 , 2 , 4 ; 42, 1 ; vgl. statt aller KIPP, Die Litisdenuntiation als Prozesseinleilungsform im römischen Civilprozess, Leipzig 1887 SS 21- 24 S . 119- 143; STEINWENTER, Studien zum rö mischen Versäumnisverfahren , München 1914 S . 8 ff; WLASSAK , Provinzialpro zess S . 38 -40 Anm . 7, 45, Anm . 18 , 58, Ann. 64, 76 , 78 ; Boyé, La denuntiatio insbesondere S. 155 ff ; WENGER , Institutionen des römischen Prozessrechts, München 1926 . (5) A . a . 0 . S. 78 . 312 Elemér Balogh Versäumnisladung hinweisen (1 ). Während der Ferien war die Evo cation ausgeschlossen ( D . 2 , 12, 1, 1). Doch wurde eine Ausnahme gestattet in solchen Fällen , in denen durch weiteres Hinauszö gern der Prozesseinleituug eine Verjährung eingetreten wäre. In diesen Fällen soll das Verfahren bis zur Litiscontestation be trieben werden (D . 2, 12, 1, 2). Die Litiscontestation ist jedoch im späteren byzantinischen Sinne als ein bestimmter Punkt des Verfahrens, nicht als Vertrag im klassischen Sinne aufzufassen. Eine Pflicht der iuridici, die Entscheidung an Unterrichter abzu . geben , bestand nicht. Diese Tatsache zeigt von neuem Unmöglich keit der sog. zweigeteilten Kognition im verstaatlichten Formu larverfahren Wlassaks. Neue eingeführt wurde dieses Uebergangs verfahren nirgends. So hatte Wlassak ein in seiner Einfachheit bestechendes Bild : Kaiser Marcus erweitert in den Provinzen das Geltunsgebiet der . Denuntiationen in Gestalt des uns aus Aegypten bekannten gräco * aegyptischen Parangelieprozesses . Dieser Prozess wird in Italien durch die iuridici übernommen, dringt so nach Rom und wird schliesslich allgemeines Reichsrecht. Nach Wlassak ist deutlich erkennbar, zunächst für Aegypten vom 2. Jahrhundert ab, das Vorwalten , wenn nicht die Einzigkeit der amtlichen Zustellung, und andererseits die Erhebung eben dieser Ladungsform zum allge meinen Reichsrecht durch einen Erlass Konstantins, der, an den Präfekten der alten Hauptstadt gerichtet, anscheinend nur im Juris diktionsbezirk dieses Beamten noch eine privata testatio vorfand und daher nur in diesem Gebiet eine Rechtsänderung bewirkte (2). Wlassak führt noch aus, dass der amtlichen Landung in Aegypten und seit Marcus in sämtlichen Provinzen die Statthaftigkeit des Kontumazurteils in allen vor die Statthaltergerichte gebrachten Privatsachen entspricht. Spätestens seit Diokletian ist das erweiterte Kontumazverfahren allgemeines Reichsrecht (3 ). Aber die Entwicklung hat bestimmt nicht so gehen können , dass sich das denaturierte Formelverfahren der Provinzen in Rom langsam eingeschlichen hat, sondern wir denken uns die Umwand (1) Paul. Sent. V, 5 a 6 (7); D. 5, 1, 68; 70, 72 ; 42, 1, 53, 1 ; C. 7, 43, 8 ; 9 (a. 290 ). (2) C. Th . 2, 18 , 2 (322 Mai. 23) in Verbindung mit C. Th. 2, 4, 2 (= Brev . II, 4 , 2) (322 Mai. 23). ( 3 ) C . I. 7, 43, 8 (a . 290 ) und dazu auch Wlassak a . a . 0 . S . 46 ff. Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians 313 lung so, dass zwei Prozesse einander in dieser Beziehung entge gengekommen sind, wobei auch eine wesentliche Bedeutung der stadtrömischen Entwicklung zukommt. Einmal wurde auch in Rom die cognitio extra ordinem für immer mehr Gebiete des Zivilrechts zuständig , dann aber nahm das Imperium der altrepublikanischen Beamten in Rom , vor allem unter senatsfeindlichen Kaisern wie Septimius Severus und seinen Nachfolgern , immer mehr ab . Man wurde geneigter, die alten Formen , die man nicht mehr verstand , weil die Idee des Freien , der nur einen gewählten Schiedsrichter über sich dulden kann, mehr und mehr unzeitgemäss geworden war, abzuschaffen und sie durch die aus den Provinzen und Italien bekannte neue Art, die Denuntiatio zu ersetzen . Dass die durch Traditionen unbeschwerte Prozessführung in den Provinzen als Vor bild für römische Einrichtungen wirkte, und dass auch die iuridici in diesem Zusammenhang eine Bedeutung haben , ist klar. Aber man darf sich das nicht als einfache Uebernahme provinzieller In stitutionen vorstellen. Wenn nicht in Rom selbst Ansatzpunkte für eine solche Entwicklung gewesen , wäre sie nicht durchgedrungen . Die iuridici gehören deshalb u . E . weniger in die stadtrömische Entwicklung als vielmehr in eine provinziell italienische. Sie sind nicht weniger, aber auch nicht mehr als die Eroberung des Landes Italien für ein amtliches Verfahren. Der Vorgang der Durchsetzung der litis denuntiatio war doch wohl komplexer als Wlassak anzu nehmen scheint. Gegen die Ueberbetonung des provinziellen Ein flusses spricht doch, dass auch in der frühen Kaiserzeit der primäre Zug der Entwicklung der ist, dass die römischen Einrichtungen überall hindringen . Das zeigt sich auch und besonders deutlich in der Einführung des Furmularprozesses in den Provinzen , auf die wir deshalb und weil sie auch eonst wichtige Aufschlüsse über die Entwicklung des spätklassischen Prozesses zu geben geeignet ist , im folgenden etwas ausführlicher eingehen wollen . Wir müssen dabei, von Aegypten abgesehen , das wir schon vorher behandelt haben, drei Arten von Provinzen unterschei den . Erstens die sogenannten Senatsprovinzen , zumeist die Ge biete, die schon in republikanischer Zeit vom römischen Volke erobert und dem Reiche eingegliedert waren , zweitens die legato rischen Kaiserprovinzen, d . h . Gebiete unter der direkten Verwal tung des Kaisers, der sich durch einen legatus Augusti pro praetore vertreten liess, drittens die prokuratorischen Kaiserprovinzen , kleine, Roma · II Elemér Balogh 314 ebenfalls unter kaiserlicher Obhut befindliche Bezirke, die infolge ihrer geringen Bedeutung nicht von Senatoren, wie es die Statt halter in den legatorischen Provinzen waren, sondern von Rittern regiert wurden. In den senatorischen Provinzen, wie Asia , Cilicien, Macedonien , Sizilien, Baetica und Africa hatten die Römer noch in republikanischer Zeit den Formularprozess eingeführt ( 1). Die Spuren des römischen Formularverfahrens finden wir in diesen Provinzen noch bis in die zweite Hälfte des zweiten Jahrhunderts. Ein Re skript des Kaisers Marcus aus dem Jahre 170, C . I. 3, 31, 1, das an den Prokonsul von Afrika gerichtet ist, spricht noch ven “ lis contestata , . Das Verfahren spielte sich ähnlich wie in Rom ab. Der Statt halter bestellte zur Prozessentscheidung Geschworene, die wie in Rom meist den höheren Schichten entstammten und über die in seinem Officium eine Liste geführt wurde. Wie sich die Reihen folge der Auswahl bestimmte wissen wir nicht. Von den Geschwo renen konnte an den Statthalter appelliert werden (2 ). Nach der früher herrschenden Meinung galt dieses Verfahren in den Provinzen allgemein . Sodann hat Pernice für die kaiserli chen Provinzen Einschränkungen gemacht und behauptet, dass der Formularprozess nur in den Senatsprovinzen sich eingebürgert habe, während in den kaiserlichen Provinzen von vornherein nur das Kognitionsverfahren gehandhabt worden sei (3 ). Pernice vermochte jedoch keine eindeutigen Belege dafür beizubringen. Ebenso wenig gelang es auch Partsch , der eine Anzahl von neuen Zeugnissen zur Bestätigung der Ansicht von Pernice beigebracht zu haben (1 ) Für Sizilien bezeugt durch die Verrinen, besonders durch 2 . u . 3 . Buch. Für die Baetica bezeugt es Sueton , Divus Julius c. 7, für Africa Frontinus, Gromatici Latini I, 36 ; 48-49 ; 52 ; 57. In Asia war das Formelverfahren nach dem Edikte des Q . Mucius Scävola das regelmässige Verfahren , bewiesen durch das S . C. de Asclepiade, BRUNS, Fontes 1' S . 178, Z . 19, sowie Cicero pro Flacco 20, 48 ; 21, 49, Cicero selbst wendet in seiner Prov . Cilicien das Formularver fabren an (ad Att . 6 , ) , 15 ). Für Macedonien vgl. S . C . de Asclepiade Bruns Fontes 17 S . 177, Z . 10 ; vgl. auch Partsch , Die Schriftformel im röm . Provin sialprosesse , (Breslauer Diss. 1905 ) Breslau 1905, S . 59 f. (2) D . 2 , 8, 9 (Gaius ad ed . prov. lib . V). (3) PERNICE, Festhabe für G . Beseler S. 76 und Amoenitates iuris. Sav. Z . VII 1, 109. Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians 315 glaubte (1). Ueberdies stimmt die von Pernice begründete Lehre auch mit den Gajanischen Institutionen nicht überein , wie Wlassak bereits erkannt hat (2 ). Die Meinung Pernices bestätigt sich nur insoweit, als es sich um prokuratorische Kaiserprovinzen handelt, während die legatorischen Kaiserprovinzen, ebenso wie die Senats provinzen den Formularprozess wohl gekannt haben . In den pro kuratorischen Kaiserprovinzen und zwar besonders in Aegypten ist der Schriftformelprozess nichtnachweisbar, während in den Senats provinzen die Geltung des Formelverfahrens noch in der Zeit der Antoninischen Kaiser unangreifbar feststeht (3 ), dieses noch im zweiten Jahrhunderte der Kaiserzeit die Regel bildete wofür die besondere selbständige Erläuterung des Provinzialediktes durch Gaius, die den Procunsul als provinzialen Jurisdiktions magistrat nennt, einen unumstösslichen Beweis liefert (4). Zu den prokuratori schen Provinzen gehören vor allem die kleineren, unter Augustus unterworfenen Alpenstaaten, wie das Reich des Cottius in Oberi talien und Noricum . In Aegypten wissen wir zwar von einem Prä fektus Alexandriae et Aegypti, der sein Album publizierte , aber selbst wenn es Formeln enthielt, so kann dies wegen ihres zivil rechtlichem Inhalts geschehen sein (5 ), der in der Fassung der verschiedenen Eingaben deutlich fortwirkt. Massgeblich für die Frage nach den Prozessen in Provinzen sind Gaius 1, 6 und IV, 109. In der ersten Stelle spricht Gaius von (1) PARTSCH , Die Schriftformel im röm . Provinsialprozesse , Breslauer Diss. 1905, 63-69, 96 . Im Anschluss an Pernice nehmen ausser Partsch noch andre Forscher eine Verschiedenheit des Prozessrechts der Senats, -und der Kaiserpro vinzen an, so u . a . L, BOULARD, Les instructions écrites du magistrat au juge commissaire, dans l' Egypte Romaine, Paris 1906 S . 2 -3 . Anm . 1. GIRARD , Manuel 8 . Aufl. 1138 -39 ff ; WENGER , Formula , in PAULY-Wissowa R . E . VI, Sp . 2868 ; WILCKEN , Arch . Pap. 4 (1908 ), 216 (Bibliographie Nr. 68 ) ; KOSCHACKER , Trans latio iudicii. Graz 1905 , S . 28 - 29 ; R . v . Mayr , Rönische Rechtsgeschichte IV (Sammlung Göschen Nr. 697) Berlin 1913, S. 49. ( 2 ) WLASSAK a . a . 0 . S . 8 -10 . ( 3 ) WLASSAK a . a . 0 . S . 9 . (4 ) 1 , 3, 4, 1, 2, 3 ; 4 , 2, 19 ; 4 , 3, 26 ; 4 , 4, 27, 1 ; 4 , 7 , 1 pr.; u . 3, 4 ; 5 , 3, 41 pr. ; 9 , 2, 32 pr.; 11, 7, 7, 1 ; 14 , 5 , 1 ; 17, 2 , 68, 1 ; 29, 1, 2 ; 29, 2 , 57 ; 29, 3 , 7 ; 38, 8, 2 ; s . auch D . 9, 4 , 15 ; 46, 7 , 7 ; 2 , 13 , 10 , 3 ; 3, 3, 48 ; 5 , 3 , 3 ; 10, 1 ; 10 , 2, 1, 1 ; cf. dazu PERNICE, Festgabe für Beseler S . 75 Ziff. 2 ; PARTsch a . a . 0 . S . 62-63 Text und Anm . 5 . (5 ) WLASSAK a . a. 0 . S. 5 . 316 Elemér Balogh der Jurisdiktion der Praetoren unter Hervorhebung der beiden stadtrömischen (praetor urbanus und praetor peregrinus), quorum in provinciis iurisdictionem praesides earum habent. Ein Unterschied zwischen den verschiedenen Provinzen wird also nicht gemacht. Dies ist aber keine Nachlässigkeit des Autors, wie das Folgende zeigt. Bei der Behandlung des Edikts der kurulischen Aedilen heisst es nämlich , dass dieses in den Provinzen von den Quaes toren erlassen wurde, wobei der Zusatz gebraucht ist: in pro vinciis populi Romani. Dagegen fällt es in den kaiserlichen Pro vinzen (in provinciis Caesaris) weg, weil dorthin keine Quaes toren entsandt werden . Die Bestimmung über das Edikt der kurulischen Aedilen ist die einzige Ausnahme, die von Gaius für die kaiserlichen Provinzen gemacht wird. Auch in 4 , 109 spricht Gaius schlechtweg von dem Formularprozess in den Provinzen ohne Unterscheidung von kaiserlichen und senatorischen . Der Formu larprozess hat also in den Provinzen so allgemein gegolten, dass es verständlich ist, dass Gaius in den angeführten Stellen die Aus nahme Aegyptens und der genannten kleinen Randgebiete nicht erwähnt (1). Zwar kennen wir aus den Provinzen keine Zeugnisse für den Formularprozess, da die von Partsch beigebrachten sich meist auf Verwaltungsverfahren beziehen, aber es ist auch undenkbar, dass jedesmal, wenn eine Provinz aus einer senatorischen zu einer kai serlichen wurde, das Verfahren sich von Grund auf geändert hätte . Diese Konsequenz aus der Ansicht von Pernice lässt sich nicht umgehen , wenn man wirklich an der strengen Trennung des Ver fahrens in kaiserlichen und senatorischen Provinzen festhält. Ein solcher Wechsel erscheint ebenso unpraktisch wie unwahrschein lich. Jedoch hat sich das Formularverfahren in den Provinzen auf die Dauer nicht gehaltev . Zunäshst in den kaiserlichen , dann auch in den senatorischen Provinzen ist der Schriftformelprozess durch die Kognition ersetzt worden. Diese Reform hat etwa in der ersten ( 1) Für die Gegenmeinung ausser PERNICE . PARTSCH , Die Schriftformel im röm . Provin zalprosess S . 63-69, 96 . GIRARD, Manuels pp. 1138 -1139 ; BOULARD, In structions S . 2-3 . Anm . 1 ; WENGER , RE VI, 2868 ; WILCKEN , Arch. Pap. 4 , 216 ; KOSCHAKER, Translatio S . 28, 29 mit Anm . 3 ; R . v. MAYR, Röm . Rechtsge schichte IV 49. Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians 317 Hälfte des zweiten Jahrhunderts begonnen. Um die Jahrhundert mitte war bereits in der Mehrzahl der Provinzen der Umschwung vollzogen . Girard, der die Zwischenstufe der zweigeteilten Kognition ablehnt, hat dieses neue Verfahren als Verwaltungsverfahren , jus tice administrative, bezeichnet ( 1). Doch ist dieser Ausdruck nicht zutreffend. Die ägyptischen Papyri zeigen uns mit aller Deutlichkeit, dass es sich um ein Ver fahren in festen Formen und Zuständigkeiten handelt, und dass keineswegs der Magistrat “ use de ses pouvoirs ordinaires pour at teindre le but qui lui parait désirable ,. Im Gegenteil ist der Uebergang vom Kognitions- zum Libellprozess gerade durch ein Uebermass an hemmenden Formen der Prozesseinleitung in der Cognition hervorgerufen worden. Ausserdem übersieht eine derar tige Meinung den starken Nachklang, den zunächst noch die Zwei teilung, dann aber auch die Formeln des klassischen Verfahrens, wenn auch in abgewandelter Funktion , gehabt haben. In den wichtigsten Provinzen hat sich also der römische For mularprozess zunächst durchgesetzt, ist aber dann bereits in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts von der Eigenkognition der Statthalter verdrängt worden . Der Zeitpunkt ergibt sich aus D . 1, 18 , 8 und 9 , die wir oben schon in anderem Zusammenhang be nutzt haben . Die Datierung ist strittig ( 2). Der Kommentar von Julian und Callistratus zu dieser Stelle ist in beiden Fragmenten der gleiche. Das Reskript zwinge die Provizialstatthalter nicht zur Ei genkognition, zu der sie natürlich berechtigt bleiben , sie hätten viel mehr das Recht zur Bestellung von Unterrichtern . Offenbar war also die Auffassung weit verbreitet, dass , wenn der Kaiser jemanden an den praeses provinciae verwies, dieser selbst entscheiden müsse . Aus dem Kommentar ergibt sich also, dass Fragm . D . 1, 18 , 8 u . 9 nicht etwa eine Vorschrift enthalten, die die Sonderzuständigkeit der Statthalter begründen , wie wir schon hervorzuheben Gele genheit hatten. Dass es sich um eine regelmässige Zuständigkeit der Statthalter handelt, ergibt sich auch aus dem häufigen Erlass der Reskripts, das formularmässigen Charakter getragen zu haben ( 1) Manuel, 8 Aufl. S . 1140. ( 2 ) Siehe darüber ausfürlich Exkurs. Elemér Balogh 318 scheint, sagt doch Julian ausdrücklich “ saepe audivi Caesarem nostrum , Die Aufgabe des Prozessformel des klassischen Rechts war es, das Programm des Prozesses abzustecken . Sie wurde zwischen den Parteien unter Mithilfe des Prätors vereinbart und bildete die Grund lage der richterlichen Entscheidung. Im Kognitionsverfahren ist für eine derartige Formel kein Raum . Gleichwohl aber sind die For meln nicht verschwunden , wie schon die Existenz eines praefecto ralen Albums in Alexandria zeigt ( 1). Doch hat sich, wenn auch nicht so sehr die Form , so doch die sachliche Bedeutung geändert. In der Form konnten die Formeln in der Tat unverändert bleiben ; nur die Bestimmung: Titius iudex esto , der Vorschlag für die Be stellung des Geschworenen, musste wegfallen. Die Formel hat jetzt eine doppelte Bedeutung ; sie ist Instruktion an den Unterrichter; sie dient aber auch der Partei für die Edition der Klage. Die An weisung an den Unterrichter ist aber nicht mehr Formel im Sinne des klassischen Verfahrens, also Rechtsbelehrung für den Geschwo renen , sondern Anweisung an den untergebenen iudex datus, Befehl der übergeordneten Behörde. Zwei prozessual ganz verschiedene Dinge erscheinen also in der gleichen Form . Die Anweisung ist hierbei aber manchmal sehr allgemein gefasst, der Angewiesene solle das Passende tun, wenn sich ihm der Sachverhalt in der an gegebenen Weise darstelle (2 ). Partsch in seiner Schrift über die Schriftformel im röm . Provinzialprozesse (3 ) und Boulard (4) haben die Verbindung dieser Instruktionen mit der Formel des klas sischen Verfahrens geleugnet. Boulard hat sie auf den ptolemäischen Prozess zurückführen wollen (5 ). Aber für eine Instruktion wie in der zitierten Urkunde mit den Worten käv pavāOl... ist der Zusam menhang mit der römischen Formel: si paret....unverkennbar. Wlas sak hat diese Anweisungen als Judikationsbefehl bezeichnet (6 ). Das (1) Darüber, ob es wirklich Formeln enthielt, WLASSAK a. a. 0. S. 5 (sch wan kend !) . (2) BGU I , 136 (130 nach Christ.) ed. WILCKEN, Nachdruk Mitteis, Chresto mathie Nr. 86 S . 95 f. ( 3) Vgl. insbesondere S . 73-78 . ( 4 ) Les instructions écrites etc . S . 53 ff. (5 ) A , a . 0 . S . 89 ff. (6 ) WLASSAK , Der Judikationsbefehl der röm , Prozesse, Sitzungsberichte der Akademie d. Wissenschaften Philolosoph .-historische Klasse, 197 Band, 4 . Abh. Wien 1921, vgl. 2 . B . S. 69. Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians 319 Fortleben dieser formelartigen Anweisungen ist bis in das 4. Jahr hundert gesichert (1) : Gleichzeitung mit dem Judikationsbefehl erging das bereits behandelte Dekret, das den Parteien die Richter ernennung mitteilte. Im provinzialen Kognitionsprozess mit Ueberweisung an Un terrichter blieb also die Formel noch in einer ihrer alten Bedeu tung ähnlichen Weise, wenn auch in veränderter organischer Stel lung, bestehen . Aber auch im nicht mehr zweigeteilten Kognitions prozess blieb noch Raum für die Formel, nämlich bei der Edition. Das scheint uns besonders wichtig , weil uns die Verweisung an die doch ganz abhängigen Unterrichter keine allzugrosse systematische Bedeutung zu haben scheint, während die Edition durch Formeln gerade eines der charakteristischsten Unterscheidungsmerkmale ge genüber dem späteren Libellprozess ist. Die Erhaltung der Formeln zeigen uns C . J. 8, 38 (39), 3 (a. 290 ); 4, 49, 4 (a. 290); 4 , 52, 3 (a . 293 ?). Am deutlichsten spricht die Consultatio V , 7 : quotiescunque ordinatis actionibus aliquid petitur, ideo petitor cogitur specialiter genus litis edere. Das petere ordinatis actionibus setzt den Gebrauch der Formeln voraus. Die Parteien sind verpflichtet, die Klagen zu be zeichnen , aber die Vereinbarung der Formel ist kein Vertrag auto nomer Parteien mehr, sondern es wird über sie vor dem Magistrat verhandelt und von ihm entschieden, ob die Formel gegeben wird oder nicht (2 ) (1) C . J. 2 , 57 (58 ), 1 (a . 372). (2) So heisst in dem Papyrus-Protokoll über eine Verhandlung vor dem Stattbalter M . Rutilius Lupus (a. 114.117) die am 5 . Januar 117 stattfand . P . Cattaoni Recto. (edd . GRENFELL -Hunt, Arch . f. Pap. III, 1900 , 57-61, Neudruck MITTEIS, Chrestomathie Nr. 372 S . 418-423) I 5 -13 = BGU I (Aegyptische Urkun den aus den Kgl. Museen su Berlin . Herausgegeben von der Generalverwaltung Griech. Urkunden. I. Berlin 1895) I, 5 -13 : (" Etovs)ı Deon Toatavoù Tößt derátõ Λουκίας Μακρίνας διά Φανείου ρήτορος ειπούσης απαιτείν παρακαταθήκην εξ υπαρχόντων 'Αντωνίου Γερμανού στρατιώτου τετελευτηκότος Λούπος είπεν. Νο ούμεν ότι αι παρακαταθήκαι προϊκές εισιν. ' Εκ των τοιούτων αιτιών κριτην ου δίδωμι. Ου γαρ έξεστιν στρατιώτην γαμείν. Ει δε προίκα απαιτείς, κριτήν δίδωμι, SotW NENETOjal võuluv keval tov yauov. Wie aus dem eben angeführten Pro tokoll ersichtlich , erhebt Lucia Macrina gegen den Nachlass des verstorbenen Soldaten Antonius Germanus eine Klage aus den Verwahrungsvertrage. Der Statt halter erklärt das Depositum für eine verschleierte Mitgift, die zwischen Ma crina und Germanus geschlossene Verbindung sei keine Ehe, denn Soldaten dürfen nicht heiraten, die dos falle also als caduca an den Fiskus. Die Klage aus dem Verwahrungsvertrage wird abgewiesen . Wenn aber Klägerin die Mitgift zurück verlangt, so wird der Statthalter für diesen Anspruch eine Klage geben , indem er die Fiktion gelten lassen wird , dass eine gesetzliche Ehe vorliege. 320 Elemér Balogh Wir haben auf diese Weise zwei Stränge der uns bekannten Entwicklung so eingehend als in diesem Abriss möglich, verfolgt : einmal die gräco -ägyptische Parangelia , andererseits den Formular prozess in den römischen Senats - und legatorischen Kaiserpro vinzen , die allmählich der Eigenkognition der Statthalter weichen mussten . Jetzt ist zu fragen , ob es nicht in Rom selbst Ladungs möglichkeiten gab, die zum mindesten Aehnlichkeit mit der spä teren litis denuntiatio (Prozesseinleitung ) des Theodosianischen Codex hatten . Boyé hat in seiner Dissertation sich mit besonderem Nach druck dieses Problems angenommen und die in den Quellen vor kommenden Denuntiationen, gleichgültig , ob sie es mit Ladung oder nicht zu tun haben, daraufhin geprüft. Es würde uns zu weit füh ren , wenn wir die nicht zu einer Ladung führenden Denuntiatio nen hier der Reihe nach durchnehmen würden wir verweisen dafür auf die Arbeit Boyés (1 ). Wir begnügen uns mit den eine Ladung enthaltenen Denuntiationen . Zuvor aber sei noch auf zwei Stellen in Ciceros Reden hin gewiesen , die, ohne dass man behaupten könnte , dass hier ein Pro zess wirksam eingeleitet werde, auf einen scheinbar alten römischen . Brauch hinführen. In seiner Verteidigungsrede pro Quinctio XVII, 54 sucht Cicero nachzuweisen, dass sich der Kläger Naevius auf unregelmässige Art und Weise die missio in bona gegen Quinctius hat zusprechen lassen . Wie es aus dem Zusammenhange dieser Rede offenbar hervorgeht, hatte der Bruder des P . Quinctius mit dem P . Naevius, dem Kläger in unserem Prozesse , eine Societas über Verwaltung von Acker- und Weidewirtschaften in Gallien geschlossen. Nach dem Tode des C . Quinctius geriet P . Quinctius, der Erbe seines Bruders, mit Naevius in Differenzen bei der Abrech nung des beiderseitigen Anteils an der Societas. Zu einer Einigung kam es nicht, auch nicht als man den Prozessweg beschritt. Schliess lich reiste P . Quinctius wieder nach Gallien , versäumte aber in folgedessen ein Vadimonium , dass er dem Naevius versprochen hatte . Dieser forderte infolgedessen vom Praetor Burrienus die Einweisung in den Besitz der Güter des Quinctius, erhielt sie auch , besass die gallischen Güter und einen Teil der Besitzungen des Quinctius zu Rom , wurde aber an der vollständigen Possessio, Pro scriptio und Venditio von Alfenus, dem Freunde des Quinctius gehindert, der sich als Procurator erklärte, die libelli proscriptionis , (1) La denuntiatio etc. S. 123 ff. Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians . 321 die Naevius ausgehängt hatte, herabwarf und einen Sklaven , den dieser mit Beschlag belegt hatte, ihm wieder entriss ( 1). In einem Teil seiner Ausführungen , die vornehmlich den Mangel der edictmässigen Voraussetzungen jener Einweisung in die Güter des Quinctius darzutun bezwecken ,unterstellt nun Cicero in seiner Verteidigungsrede, der es an Entstellungen , Auslassungen und Uebertreibung nicht fehlt, dass das Vadimonium wirklich ge leistet und nicht eingehalten sei. Er sucht darzulegen , dass Naevius trotzdem die Einweisung nicht hätte erwirken dürfen und sagt in diesem Zusammenhange (XVII, 54) : Vadimonium mihi non obiit quidam socius et affinis meus, quicum mihi necessitudo vetus, contro versia de re pecuniaria recens intercedit. Postulone a praetore, ut eius bona mihi possidere liceat, an cum Romae domus eius, uxor , liberi sint, domum potius denuntiem ? Quid est, quod hac tandem de re vobis possit videri ? Profecto , si recte vestram bonitatem atque pru dentiam cognovi, non multum me fallit, si consulamini, quid sitis re sponsuri: primum expectare; deinde si latitare ac diutius ludificare videatur, amicos convenire, quaerere quis procurator sit ; domum denuntiare. Dici vix potest, quam multa sint, quae respondeatis ante fieri oportere, quam ad hanc rationem extremam necessariam devenire. Wie der klare Wortlaut der eben angeführten Stelle es offenbar bekundet, sucht Cicero hier wieder nur auf das Gefühl des Geschwornen und seiner Beisitzer zu wirken , indem er zeigt, wie gehässig Nävius gehandelt, indem er nicht, wie vorsichtige und wohldenkende Männer selbst nach wiederholt erfahrener Täuschung zu tun pflegten , erst die Freunde des Abwesenden angegangen, sich erkundigt, wer sein Bevollmächtigter sei, endlich Anzeige in seinem Hause gemacht, sondern sofort die gerichtliche Einweisung in den Besitz, und zwar gegen einen Verwandten und Socius, durch welche dessen Vermögen und ganze Persönlichkeit aufs Spiel gesetz werde, verlangt habe. Das domum denuntiare in unserer Stelle ist nur ein von Cicero geforderter Act der Freundlichkeit nach versäumtem Vadimonium vor Geltendmachung der Folgen dieser Säumnis. Die Denuntiation , von der hier Cicero spricht, ist eine rein private. Ihre Vornahme wurde nur durch den Austand, nich durch das Recht dem Kläger geboten. Wie bereits Kipp sehr richtig betont ( 1) KÜBLER , Der Prozess des Quintius und C. Aquilius Gallus, Sav. Z . XIV (1893) S . 55 f. 322 Elemér Balogh hat, hätte Cicero sich für die Notwendigkeit des domum denuntiare auf einen Satz des prätorischen Edikts berufen können , so würde er, zuinal, da er vor einem berühmten Rechtsgelehrten – Aquilius Gallus – plädirte, denselben angeführt haben , wie er gerade in der Rede für Quinctius die massgebenden Ediktsklauseln anzuführen nicht versäumt (1). Man würde zweifelsohne fehl gehen, wenn man in den durch unsere Stelle mit viel Pathos vorgetragenen Worten domum denuntiare eine rechtliche Verpflichtung des Klägers Naevius (1) Litisdenuntiation S . 162. Die Ansicht, dass Cicero hier nur von einer seitens eines billig denkenden Klägers zu beobachtenden Rücksicht, nicht von einem Rechtsgebot spricht, kann als die herrschende bezeichnet werden . Vgl. statt aller Fr . L . KELLER , Semestrium ad M . Tulluim Ciceronem libri sex . I. Turici 1842 S. 177 ; BETHMANN -HOLLWEG , Der römische Civilprozess, II, Boon 1865, S . 795 ; M . Voigt, Ueber Vadimonium , Abhandlungen der Königl. Sächs. Ge sellschaft der Wissenschaften zu Leipzig . Philologisch -Historische Klasse. No. III. Leipzig 1881 S. 345 Aum . 128 ; Kupp a . a. 0. S . 161- 164 ; derselbe, Denuntiatio RE . V (1905 ) Sp. 224 ; E. Costa, Cicerone giureconsulto, 112, Bologna 1927, S . 24 Anm .; Boye , La denuntiatio S . 136 . Mit Unrecht erblickte Baron in dem « do mum denuntiare » die prozesseiuleitende Litisdenuntiiation (Geschichte des rö mischen Rechts. I: Institutionen und Civilprosess, Berlin 1884 S . 380 Anm . 35 ). Später hat er diesen Standpunkt aufgegeben und die Ansicht vertreten , dass die domum denuntiatio eine Erkundigung sei, ob kein Procurator vorhanden sei, ein Hinweis an Frau und Kinder, vielleicht auch an Nachbarn , dass es dem Hausherrn schlecht ergehen könne, wenn kein Defensor für ihn auftrete ; und diese Erkundigung, dieser Hinweis sei nicht ins Belieben gestellt, sondern eine Voraussetzung für die Beantragung der missio in bona (Abhandlungen aus dem römischen Civilprocess. III. Der Denuntiationsprocess . Berlin 1887 . S . 86 -89). Dieser Auslegung von Baron , der zur Unterstützung seiner Ausicht auf D . 4 , 6 , 22 pr, und 43, 24, 5 , 2 sich beruft, wiederspricht der klare Wortlant unserer Stelle. Er will in die domum denuntiatio auch Sachen hineininterpretieren , die unsere Stelle besonders hervorhebt. Entschieden unbegründet ist die Annahme von WIEDING , der in dem domum dcnuntiare eine denuntiatio ex auctoritate sieht, welche vor der Erwirkung der missio in bona gegen denjenigen, qui absens iudicio defensus non fuerit, auf Grund eines Ediktssatzes : dum ei qui aberit prius domum denuntiari iubeam notwendig gewesen sei (Der lustinianische Li bellprocess. Wien 1865 S . 310 ff., 554 ff., 665 ff.). Die Unhaltbarkeit der An nahme von WIEDING hat bereits Kipp mit triftigen Gründen bewiesen (Lilis denuntiation S. 51 ff, 162 f ). Cicero sagt von einer Denuntiatio ex auctoritate praetoris kein Wort. Der Ausdruck domum denuntiare ergibt keinerlei Grund für eine solche zu halten . Ebenfalls bieten die Quellen keinerlei Anhalt, den Ediktssatz, auf den WIEDING diese denuntiatio ex auctoritate praetoris zurück führen will, auzuerkennen . Gegen WIEDING auch BARON (Der Denuntiation process S . 86 ff) und Boyé (a. a 0 . S. 136 ). Beiträge zur Zivilprozessordnung Jnstinians 323 erblicken wollte. Läge ein Rechtsgebot vor, dann hätte Cicero mit viel weniger Emphase sein Ziel erreicht. Wir haben es hier nur damit zu tun , was der Ehrenmann in Rom seinem Freunde und Verwandten gegenüber zu tun gehalten war. Man nimmt nicht gleich zum Prätor seine Zuflucht, sondern man sucht erst auf eine weniger gewaltsame Weise zu seinem Recht zu kommen. Vor allen Dingen stellt man bei einem vadimonium desertum erst fest, ob hier eine Absicht, also latitatio und ludificatio , vorliegt, oder ob irgend welche dringende Abhaltungen an dem Versäumnis des Termins schuld sind. Boyé (S . 137) vermutet mit Recht, dass man ähnliche Schritte auch vor der in jus vocatio zu ergreifen durch die Sitte verpflichtet war, wie es uns auch in der Stelle Cicero pro Caecina VII 19 ( 1) entgegentritt. Der eigentliche Streit betrifft hier (1) In possessione bonorum cum esset et cum iste sexlulam suam nimium exaggeraret, nomine heredis arbitrum familiae herciscundae postulavit, atque iste (ille ) paucis diebus, posteaquam videt nihil se ab A , Caecina posse litium terrore abradere, homini Romae in foro denuntiat fundum illum de quo ante dixi, cuius istum emptorem demonstravi fuisse mandaru Caesenniae, suum esse seseque sibi emisse. quid ais ? iste ille fundus est, quem sine ulla controversia quadriennium , hoc est ex quo tempore fundus veniit, quoad visit possedit Cae sennia ? « usus enim » inquit « eius fundi et fructus lestamento viri fuerat Cae senniae » Vgl. dazu XXXII 95 : postea cur lu , Aebuti, de isto potius fundo quam de alio si quem habes Caecinae denuntiabas, si Coecina non possidebat ? Bereits Ch . G . SCHÜTZ hat in seiner Ausgabe ( 1815 - 1816 ) in VII 19 iste an Stelle ipse und iste oder ille an Stelle illis gesetzt . Diese offensichtlich gerechtfertigten Be richtigungen sind unter anderen von Fr. L. KELLER ( Semestria , I, 279-80), Momm SEN (Gesammelle Schriften , I. Abt: Juristische Schriften III, Berlin 1907 S . 558 ), Kipp (Litisdenuntiation S . 160 Anm . 4 ), BETHMAN -Hollweg ( Der römische Civil prosess, II, S . 830 Anm . 12), Baron ( Der Denuntiationsprozess S . 95 Anm . 1 und 2 ), KOSCHAKER (Sav . Z . XXVIII (1907) S. 450 -452) und Boye (a . a . 0 . S . 137 Text und Anm . 23) gebilligt worden . Mit Unrecht lehnt Bögli die Lesart von Ch . G . Schütz ab und nimmt gegenüber der herrschenden Ansicht nach dem Vorgange von WIEDING ( Der Justinianische Libellprocess S . 596 ) den Standpunkt ein , dass Aebutius, nicht Caecina, die Teilungsklage angestellt habe (Ueber Ci ceros Rede für A . Caecina, Beilage zum Jahresbericht des Gymnasiums Burgdorf 1905 - 1906 , Burgdorf 1906 , insbesondere S , 10 - 23 ; Beiträge zur Lehre vom ius gentium der Römer, mit einem Nachtrag zu des Verfassers Abbandlung über Ciceros Rede für A . Caecina, Bern 1913 S . 69-71). Gegen die Auffassung von Bögli, der auch das fr . 37 D . 10 , 2 entgegensteht, habeu auch KoscHAKER (a . a .. O ), CHABRUN (La « Deductio quae moribus fit » , Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, XXXII (1908 ) S. 7 Anm . 4 ) und Boy. (a. a . 0 .) aus triftigen Gründen Stellung genommen , während G . CORNIL (Revue de droit inter national et de législation comparée, XXXIX ( = II Série IX ), Bruxelles 1907, S. 593) und MANIGK ( Berliner philologische Wochenschrift, 1907, Nr. 2, S. 44-45) ihr zugestimmt haben . 324 Elemér Balogh den Besitz eines Grundstückes, des fundus Fulcianus. Die Caesennia hatte dieses Grundstück durch ihren Mandatar Sex. Aebutius an kaufen lassen , hatte es hierauf in Besitz genommen und verpachtet. Dann hatte sie den A . Caecina, Bürger von Volaterra , von einer angesehenen Familie Etruriens, den Kläger in dieser Sache gehei ratet und war darauf mit Hinterlassung eines Testaments gestorben . In dem Testament war Caecina zu 11 '/, Unzen (zu 23/24), ein ge wisser M . Fulcinius zu / Unze (zu ?/<,) und Aebutius zur Abfindung seiner Bemühungen zu '%. Unze (zu /12 ) zu Erben eingesetzt (1 ). Aebutius will bei der Erbteilung möglichst viel für sich heraus schlagen und daher die gerichtliche Teilung, bei welcher er vor aussichtlich schlecht abschneiden wird, vermeiden . Daher sucht er Caecina durch die Drohung, dass er ihm das Bürgerrecht bestreiten wolle, vom Prozesse abzuschrecken . Er behauptet eben , Caecina könne gar nicht erben, weil er als Volaterraner durch Sullas Gesetz des römischen Bürgerrechts und somit der Erbfähigkeit beraubt sei (2 ). Caecina liess sich aber nicht einschüchtern , gab dieser Behauptung nicht nach , trug vielmehr als Erbe und Besitzer des Nachlasses gegen Aebutius, der seinen Erbteil über Gebühr aus zubeuten bestrebt war, auf gerichtliche Erbteilung durch einen arbiter: familiae erciscundae an (3 ). Dieser Prozess und sein Fort gang kommt nicht weiter in Betracht (4 ). Als Aebutius sah , dass seine Drohung nicht fruchtete und Caecina sich zur Erhebung der Erbteilungsklage entschloss, änderte er seinen Standpunkt und wollte das Fulcianische Grundstück dem angestellten Erbteilungsprozess entziehen, indem er wegen dessen Caecina mit der Eigentumsklage belangen wollte. Im Einklange hiermit trat nach wenigen Tagen Aebutius den Cäcina in Rom auf dem Forum mit der Anzeige an (homini Romae in foro denuntiat), jenes Grundstück, das er in der Versteigerung der Erbschaft des jüngeren M Fulcinius gekauft, sei damals von ihm zum Eigentum erworben worden , Cäsennia habe daran nur aus dem Testament ihres Mannes, wie an dessen übrigen Gütern , bis zu ihrem Tode den Niessbrauch gehabt (5 ). Caecina, um diesem neuen Anspruch ( 1) Veber alles dieses Cicero pro Caecina V 15 , VII 16 -17 . ( 2) Cicero pro Caecina VII 18. (3) Cicero pro Caecina XII 19. (4 ) S . auch BETHMANN-HOLLWEG a. a . 0 . II S . 830 Z . 2. (5 ) Cicero pro Caecina VII 19. Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians 325 zu begegnen, verabredet auf den Rat seiner Freunde, auch des Juristen C . Aquilius, in einer zweiten Besprechung der Sache mit Aebutius einen Tag, wo sie sich an Ort und Stelle treffen und die herkömmliche deductio moribus vornehmen wollen (1). Sehr richtig findet Bethmann -Hollweg in unserer Stelle Cic. pro Caec. VII 19 nur einen Beleg für die Sitte anständiger Leute zur Zeit Ciceros, nicht gleich mit der in ius vocatio zu beginnen , sondern erst eine einfache Anzeige des Anspruchs vorangehen zu lassen , also eine lediglich prozessvorbereitende Handlung, oder einen Prozessab wendungsversuch (2). Ihm schlossen sich unter anderen Kipp (3) und Costa (4 ) an (5 ). Wenn die eben gennante vorläufige Anzeige bei Cicero nur als Sitte der gebildeten Stände Roms erscheint, so dürfen wir daran erinnern , dass das Abkommen der ursprünglichen Ladungsart der 12 Tafeln “ si in jus vocat ito , der in jus vocatio nur durch die milder gewordene Sitte zu erklären ist , denn sicherer als jedes vadimonium ist der uralte Brauch bestimmt gewesen . Trotzdem ist hier der erste Ansatz (6 ) zu der Vorschrift des Prä tors, die Lenel (Z . Sav. 15 , 1894, S . 385 -88) zuerst hervorgehoben hat, dass der in ius vocatio eine aussergerichtliche edictio actionis (1) Cicero pro Caecina VII 20 . (2) Der römische Zivilprocess II S. 831 Anm . 13. (3 ) A , a . 0 . S. 160 . (4 ) A . a . 0 . 112 S . 24 Anm . (5 ) Mit Unrecht führt Baron unsere Stelle, Cic. pro Caec. VII 19 als einen Beleg für die Existenz der Litisdenuntiation als Prozesseinleitung von M . Aurel an (Institutionen S. 380 Anm . 35 ). Völlig ungerechtfertigt sicht er in den Worten homini Romae in foro denuntiat eine echte Denuntiation , d . b . eine Ladung znm Prozess (Der Denuntiationsprocess S. 96 ). Ebenso unbegründet erblickt WIEDING hier die denuntiatio eo iure actoris nach seiner Konstruktion , die hier ausnahmsweise eingetreten sei, weil man vor dem Erscheinen in iure erst die deductio quae moribus fit habe vornehmen müssen (Der Justinianeische Libell process, S . 596 , 599). Andererseits können wir auch KELLER nicht beipflichten , der gegen die Annahme kämpft, dass Aebutiusüberhaupt durch die Denuntiation die Absicht gezeigt habe , den Caecina wegen des Grundstücks zu verklagen , vielmehr habe er sich nur gegen die Einbeziehung desselben in die von Caecina angestellte Erbteilungsklage verwahren wollen ( Semestria I p . 354 sqq ) Arg . Cic . pro Cuec. VII 20, XXXII 95, wo Cicero behauptet, dass debutius durch die Denuntiation den Besitz Caecinas an dem streitigen Grundstück anerkannt habe. S , Kipp a. a . 0 . S . 160. (6 ) Vgl. auch Boyé a. a . 0 . S . 139. 326 Elemér Balogh vorauszugehen habe die den Zweck hatte (1), den zu Beklagenden , schon vor der in ius vocatio auf den Prozess vorzubereiten , damit er vorbereitet zur Verhandlung komme (2 ). Von dieser denuntiatio , die rein privat, ursprünglich nur dem guten Ton entsprechend, dann dem Geheiss der Prätors folgend , an den Gegner erging , führt ein direkter Weg zur denuntiatio ad domum . In D . 39, 2, 4 , 5 , 6 wird gesagt : Praetor ait : “ dum ei, qui aberit, prius domum denuntiari iubeam , . abesse autem videtur et qui in iure nun est: quod et Pomponins probat : verecunde autem praetorem denuntiari iubere, non extrahi de domo sua , sed “ domum , in quam degit, denuntiari , sic accipere debemus, ut et si in aliena domo habitet, ibi ei denuntietur, quod si nec habitationem habeat, ad ipsum praedium erit denuntiandum vel procuratori eius vel certe inquilinis. 6 . Totiens autem praetorem exigere denuntiationem intelle gendum est, si sit cui denuntietur : ceterum si non sit, veluti quod hereditaria insula est nec dum hereditas adita , vel si heres non extet nec inhabitetur, cessat haec pars edicti. est tamen tutius libellum ad ipsas aedes proponere : fieri enim potest, ut ita monitus defensor exi stat (Ulpiani ad edictum lib . I De damni infecti cautione). Diese Form der Ladung erging in dem besonderen Fall der cautio damni infecti. Bevor der durch das in Gefahr des Verfalls befindliche Gebäude bedrohte Nachbar in dessen Besitz eingewiesen wurde, musste dem abwesenden Eigentümer Meldung des Zustandes seines Hauses und Aufforderung zur Abstellung der Uebelstände zugehen. Erst der Nachweis der denuntiatio ad domum veranlasst den Prätor zur Ein weisung. Dieses Vorgehen des Prätors, für welches auch Boyé (S. 241) die Stelle pro Quinctio XVII 54 zum Vergleich heranzieht, hat u . E . durchaus den Charakter einer Erzwingung förmlicher Ladung mittels einer Art denuntiatio . Vom Prätor veranlasst, der nicht mehr ohne weiteres die missio in possessionem erteilt , wendet hte n m PFormularproces, on , 45 , Iver Dieim S. 27Litiskontestation (1) LENEL, Die Form der Sav. Z . XIV ( 1894) S . 385 -388 ; vgl. bereits RUDORFF, Die Prosesseröffnung nach dem Edict, Zeitschrift für Rechtsgeschichte , IV (Weimar 1864) S. 26 IV ; s. auch DE FRANCISCI, Evválaayua II S . 274275 Anm . 2 . (2) D. 2, 13, 1 pr.: Qua quisque actione agere volel, eam edere debet : nam aequissimum videtur eum qui acturus est edere actionem , ut proinde sciat reus, utrum cedere an contendere ultra debeat, et, si contendum putat, veniat in structus ad agendum cognita actione qua conveniatur (Ulpiani ad edictum lib . IV De edendo ). Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians 327 sich jetzt der durch den drohenden Einsturz seines Nachbarhauses gefährdete Grundstückseigentümer mit einer denuntiatio an den ab wesenden Eigentümer desselben . Diese vom praetorischen Edikt vorgeschriebene denuntiatio wird bei Abwesenheit desjenigen , von dem die cautio damni infecti be gehrt wird, ad domum gerichtet, wobei unter 4 abwesend , verstan den werden soll et qui in iure non est, auch derjenige, welcher vor der Gerichtsstätte nicht erscheint. Aus dem Hause (extrahi) soll er aber nicht herausgezerrt werden, sondern nur domum d . h . in seiner Wohnung, sei es im eigenen , sei es in einem fremden Hause soll die Meldung an ihn persönlich, und falls er nicht ange troffen wurde, zweifelsohne an seine Hausgenossen erstattet werden. Hatte er eine Wohnungnicht, oder, was wir dem gleichstellen müssen , wurde niemand in derselben angetroffen, so erfolgte statt des domum denuntiare eine Denuntiation auf dem schadendrohenden Grundstück selbst an den Procurator d . h . an den Geschäftsführer des Kautionspflichtigen oder au Bewohner des Grundstücks. Dem gemäss wird die Denuntiation von dem Praetor so oft gefordert , als jemand da ist, an den sie gerichtet werden kann . Waren solche Personen nicht vorhanden , so erfolgte gar keine Denuntiation ; die bezügliche Vorschrift des prätorischen Ediktes fand dann keine Anwendung. Dies war zum Beispiel der Fall, wenn das schaden drohende Haus zu einer Erbschaft gehörte und die Erbschaft noch nicht angetreten war, oder wenn kein Erbe da war, auch das Haus nicht bewohnt wurde. Der Zweck der eben geschilderten Denuntia tion geht offenbar dahin , dem Eigentümer des mit Einsturz drohen den Gebäudes Gelegenheit zu geben, die ihm drohende Teilexekution in sein Vermögen abzuwenden . Von entscheidender Bedeutung ist dabei der Umstand, dass von einer in ius vocatio nicht die Rede ist. Für unsere Begriffe wäre doch diese Regelung die einfachste ge wesen . Es muss aber doch wohl dem Rechtsempfinden der Römer nicht entsprochen haben , für einen noch nicht entstandenen Schaden die in ius vocatio gelten zu lassen, zumal wir stets bedenken müssen , dass dieser Schaden in unserem Fall nicht auf das Verschulden des Eigentümers zurückgeführt werden kann . Dieses Verschulden muss erst festgestellt werden . Es tritt ein , wenn er trotz der denuntiatio keine Abhilfe schafft. Die Umständlichkeit, mit der bei dieser Be nachrichtigung alle möglichen Fälle von Abwesenheit berücksichtigt werden, entspricht der römischen Gründlichkeit. Dabei ist noch der 328 Elemér Balogh Werdegang dieser Prozedur deutlich erkennbar. Ursprünglich nur für den Fall gegeben , dass der Bedrohte den Nachbarn nicht an traf, ist es dann durch die Interpretation der Juristen, der auch Pomponius sich anschloss, auf den Fall der Abwesenheit vor der Ge richtsstätte ausgedehnt worden . Sehr wichtig für die weitere Ent wickelung ist es auch, dass wir in diesem Akt die erste denuntiatio ex auctoritate, der schon im Einklange mit der Dringlichkeit, die das Verfahren wegen drohenden Schadens beherrscht (1), keinerlei Ladung voranging (2 ), vor uns haben ; denn was ist auctoritas anderes, als die vom Prätor erfolgte Gutheissung dieser Mitteilung an den Nachbarn ? Ob dabei der Prätor in eigener Person oder durch Vermittlung der örtlichen Obrigkeit eingriff, ist für die aucto ritas unerheblich . Es handelt sich hier um eine so genannte halbamt liche Ladung (3 ) Unser besonderes Augenmerk müssen wor der Absonderlich keit schenken , dass bei dieser denuntiatio der Praetor nach der Fassung von D . 39, 2, 4 , 5 in das Formularverfahren kraft seines Imperiums eingreift. Denn wenn wir schon mit Boyé (4) das Auf kommen dieser denuntiatio in den Anfang des II. Jahrunderts , spätestens in die Zeit der Kodifikation des Julianischen Ediktes he runtersetzen , so bleibt es doch dabei, dass diese denuntiatio ex aucto ritate nicht in die cognitio extra ordinem fällt (5 ). Die Römer haben vielmehr die Fälle, in denen der Prätor kraft seines Imperiums ein greift, unter die Herrschaft des ordo judiciorum privatorum ge ( 1 ) D . 39, 2 , 1 . (2) A . A . mit Unrecht WIEDING a. a. 0 . S. 304 ff ; BETHMANN-Hollweg a. a. 0 . II S . 733 f; BURCKHARD bei Glück : Ausführliche Erläuterung der Pandekten. Serie der Bücher 39 und 40 , Th . II, Erlangen 1875 S . 485 ; gegen sie vgl. statt aller Kipp a. a. (). S . 166 -167 ; BARON, Der Denuntiationsprocess S. 102 ; Boyć a . a . 0 . 242 f. (3) So auch Boye a. a. 0. S. 242. Ungerechtfertigterweise sieht Brinz im domum denuntiare hier überhaupt keine Ladung, sondern die Zustellung des Dekrets, durch welches die Kaution auferlegt wird (Lerbuch der Pandekten. 19, Erlangen 1873, § 172 S . 677 . (4 ) Boyé a . a . 0 . S . 243 f. Entschieden ungerechtfertigt ist die Annahme von Baron, nach dem diese Denuntiation bereits der repubblikanischen Zeit angehören würde (Der Denuntiationsprocess S. 100).Gegen Baron vgl. bereits Bore a. a. 0 . (5) Mitt Unrecht behauptet WIEDING , dass bei dem Verfahren wegen dro henden Schadens es sich um eine causa extraordinaria handelt (a. a. 0 . S . 307). Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians 329 rechnet. Boyé löst diese Schwierigkeit, indem er den Gegensatz zwi schen Ordo und cognitio extra ordinem als einen der Instanz auffasst und den Unterschied der Ladung in das Gebiet des Ordo selbst hinein verlegt. Das Trennende will er in dem Formularverfahren einerseits, der cognitio des Magistrats andererseits sehen. Der Grund dieses Verhaltens der Römer soll nach Boyé (1) die Gewöhnung gewesen sein . Der Unterschied secundum ordinem und extra ordinem sei erst in der Kaiserzeit aufgekommen, als man reine Verwaltungs beamte über Zivilprozesse entscheiden sah. Wir müssen gestehen , dass uns diese Auffassung nicht möglich erscheint. Das Eingreifen des Prätors bei der cautio damni infecti ebenso wie bei den übrigen denuntiationes ex auctoritate ( 2 ) ist stets hervorgerufen durch ein unmittelbares Staatsinteresse. Die private causa , hier der Einsturz des Hauses, geht nicht nur den Nachbarn, sondern die ganze Stadt an – das Haus kann ja auch auf die Strasse zusammenstürzen – so ist die unmittelbare Mitwirkung des Magistrats gefordert. Es wirkt auch bei Boyé nicht überzeugend, wenn er einerseits die denuntiatio ex auctoritate auf Grund der cautio damni infecti mit dem Verfahren des Ordo zusammenbringt und dann doch zugeben muss, dass die Ladung entsprechend der cognitio extra ordinem er folgt . Wir möchten deshalb diese formale Begrenzung von ordo und .cognitio ablehnen und zu einer materiellen zurückkehren .Nicht alles was der Prätor anordnet, muss deshalb notwendigerweise secundum ordinem sein , sondern nur das, was er im Prozesse im Interesse einer Partei tut, bis zu diesem Fall eine noch nichtdagewesene Erschei nung. Darum ist auch für uns diese denuntiatio domum von so ausserordentlicher Wichtigkeit. Wir sehen in ihr deutlich das Zu sammenwirken beider Teile , des privaten Bedrohten und der Obrig keit, die im Interesse der Allgemeinheit sich einmischt, wir sehen , wie bereits hier eine denuntiatio erfolgt ex auctoritate wie später, wir sehen den Ursprung dieser Beiteiligung des Magistrats. Der Fall der in ius vocatio ist noch nicht gegeben , der Einsturz droht, Gefahr ist im Verzuge, da greift der Prätor ein , er stattet den Privaten mit seiner auctoritas aus, aber er hat doch auch gleich zeitig das Interesse des Eigentümers des baufälligen Gebäudes im Auge. Erst denuntiatio, dann erst missio in possessionem . ( 1) Boyé a. a . 0 . S . 246 . (2) D . 16 , 3, 5 , 2 und 43, 5, 3, 9. Roma · II 22 330 Elemér Balogh Hier können wir auch den Unterschied zu der graeco -ägypti schen nagaryɛhia mit Händen greifen . Während in Rom im wesent lichen doch die Betätigung des Privaten vorherrschend ist, die auctoritas praetoris nur hinzukommt und hinzukommen muss, um der sonst formlosen uud rechtlich unerheblichen denuntiatio Gewicht zu geben , ist das Verfahren der ragayyenia von vornherein durch den Jurisdiktionsmagistrat bestimmt. Das drückt sich am besten im Zustellungsmoment aus, das in Rom durch privata testatio erfolgt (1 ) (auch in Aegypten , wenn römische Bürger miteinander in Streit geraten (2)), in Aegypten – nachweisbar seit 99 n . Chr. – durch den delegierten orgatnyóg erfolgt, der seine ÚnnoĖTaL dazu verwen det (3). In Rom entwickelt sich die denuntiatio ex auctoritate aus einem Falle drohender Gefahr, wird als Ausnahme erfunden, in Aegypten ist es die übliche, durch den Beamtenstaat der Ptolemaer vorgebildete Einleitungsart. Kaum irgend etwas vermöchte uns so gut wie diese kleine Einzelheit den Unterschied zwischen Rom und Aegypten zu illustrieren. Diese Art der denuntiatio mit testatio privata ist dann in die cognitio extra ordinem , auch abgesehen von den dringenden Fällen , eingedrungen . Wir müssen zu diesem Zweck auf die sonst übliche Ladung im administrativen Verfahren eingehen. Die evocatio , zu der jedem Magistrat kraft seines Imperiums das Recht zusteht, wird durch drei verschiedene Akte bewirkt, die jeder für sich ihr besonderes, streng begrenztes Anwendangsgebiet haben, wie wir es bereits vorher angedeutet haben. Die evocatio denuntiatione kommt in An wendung, wenn der Beklagte in dem Immediatsprengel des Magis trats, der die Ladung erlassen hat sich aufhält, sod ass durch dessen Organe die Ladung ausgerichtet werden kann . Litterae (1) C . Th. II 4 , 2 (= Brev. II, 4, 2) (322 Mai. 23). Hier wird die privata testatio von Konstantin als gefährlich bekämft. Er will sie durch Zweckmässi geres ersetzen . ( 2) P . Hamb. I 29 B (26 Febr. 94 ). Neudruck MEYER , Juristische Papyri Nr. 85 S . 293. Vgl. dazu Wlassak , Provinsialprozess S . 56 ; Boyć a . a. 0 . S . 55 Anm . 2, 75 , 86 , 91 f, 108, 112, 114 Anm . 14 , 117, 324. ( 3) Vgl. 2 . B . BGU I 226 (a . 99), Neudruck Mirteis, Chrestomathie Nr. 50 S . 56 ; P . Teb. II 434 (a . 104), Neudruck Mitteis a . a . 0 . Nr. 51 S . 56-57 ; P . LOND II p. 171, Nr. 328 (a. 150-154 ), Neudruck Mirteis a , a . 0 . Nr. 52 S. 57-58 ; MEYER, Juristische Papyri Nr. 83; P . Teb. I 303 (a . 176 -180), Neudruck MITTEIS a . a . 0 . Nr. 53 S . 58 ; P . AMh . II 81 (a . 247), Neudruck Mitteis a . a . 0 . Nr. 54 S . 58 -59. Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians 331 werden benutzt, wenn der Beklagte einen bekannten Wohnsitz in ei nem anderen Bezirk als dem des ladenden Magistrats hat, während die dritte Form der Evocation die edicta angewandt werden, wenn der Wohnund Aufenthaltsort des zu Ladenden unbekannt ist und jede direkte Mitteilung dadurch unmöglich wird . Alle drei sind gleicherweise streng amtlicher Natur (1 ). Man begreift ohne Schwie rigkeit, dass die edicta dem Zutritt der privaten Beteiligung schon durch ihre Form entzogen waren , nur bei den litteris, dadurch, dass der Kläger sie an die ordentlichen Behörden übermittelte (2) und vor allem bei der denuntiatio konnte sich die private Initiative geltend machen und zwar bei dieser durch testatio privata . Das Schicksal des bei der Behörde eingereichten Parteianliegens ist je nach der Form der prozesseinleitenden Evokation verschieden wie nach derselben auch der Anteil, den der Beamte und den der beikommende Private an der Ausführung der Ladung hat, sich verschiedenartig gestaltet. Beim edictum bleibt davon nichts übrig , die Obrigkeit spricht in eigener Person . Die Ediktalladung ist eine in Form des Anschlages an der Amtsstelle an eine bestimmte Person oder Personenmehrheit gerichtete Aufforderung eines Magistrates, sich bei ihm einzufinden (3 ). Bei der Ladung durch litterae wird das Requisitionsschreiben, das der Magistrat an die Ortsbehörde des Wohnortes des zu Ladenden erlässt, damit diese die Ladung bewerkstellige, an die Libellexemplare, die der Kläger zur Erwir (1) Vgl. auch Boyé a. a. 0 . S . 161. (2 ) Vgl. Vat. fr. 162- 163, dazu P . London II S . 152 f. Nr. 196 Z . 4 .6 (a . circa 141 n . C . ed . Kenyon), Neudruck MITTEIS, Chrestomathie Nr. 87 S . 96 ; P . Giss. I (a . 265- 266 n . C . ed. Eger), Neudrnck Mitteis a . a . 0 . Nr. 75 S . 84. (3) Vgl. C . Th . X 10 , 29, 2 (421 lul. 8) in Verbindung mit C . I. 9, 40, 3 (421 lul. 8 ). Mitt Unrecht wird von WIEDING , dem hierin auch WETZELL (Sys tem des orilentlichen Civilprozesses3, Leipzig 1878 S. 909) und BARON ( Der De nuntiationsprocess S . 53 und 238 ) beipflichten , bestritten , dass im römischen Prozesse die edicta an der Gerichtsstätte proponiert wurden . Nach ihm hätte das edictum nicht den heutigen Sinn einer Ediktalladung, vielmehr würde es den Ladungsbefehl des Magistrats bedeuten , der vom Kläger dem Beklagten zu behändigen wäre , so dass der Kläger eine denuntiatio ex auctoritate vornähme (a . a . 0 . § 21 insbesondere S . 323 ff, § 29 S . 637 ff ). Mit triftigen Gründen hat Kipp, dem hierin auch STEINWENTER beipflichtet (a . a. 0 . S . 34), die Unhalt barkeit der Ansicht von Wieding bewiesen und dessen Argumente unwiderlegbar entkräftet (Die Litisdenuntiation S. 120 ff. Zur Ediktalladung vgl. nun STEINWENTER a. a . 0 . S . 33-43 mit weiteren Anfürungen ). 332 Elemér Balogh kung der Ladung seines Gegners bei dem Magistrate einreicht, in der Form einer Subscription gesetzt und vom Kläger selbst der Ortsbehörde des Wohnortes des zu Ladenden überbracht, der dann durch ihre Organe die Ladung ausrichten lässt (1). Noch erheblicher ist die Rolle des Klägers bei der dritten Form der Evokation , bei der denuntiatio (2). Bis vor kurzem nahmen die Gelehrten hier einen lediglich privaten Akt an . Ihnen trat auch Steinwenter bei, der aber überdies eine “ offizielle , Denuntiation anerkannt wissen will (3 ). Gegen diese Ansicht nahm Wlassak zunächst Stellung ( 4), dem auch hierin Wenger völlig zustimmt (5). Auch nach Wlassak wird die Ladung hier vom Kläger ausgeführt, jedoch erst nachdem der Magistrat, den er um Ermächtigung zu ihrer Vornahmemittels schriftlicher Eingabe angegangen hat, sei Vollwort hierzu erteilt hat, worauf eben die rechtsverbindliche Kraft dieser Einladung beruht. Nach dieser Wlassakschen These wäre demnach die denun (1) Vgl. fragm . Vat. 162-163 ; D . 48, 17, 1 , 2 ; 4 pr.; s. auch Paul. Sent. 5 , 5 a, 6 (7) ; D . 40, 5 , 26 , 9 ; C . 7 , 43, 8 (a . 290 ) ; lost . I 25 , 16 ; P . London II S. 153 Nr. 196 Z. 4 -6 (circa a . 141 n . Chr.), Neudruck MITTEIS , Chrestomathie, Nr. 87 S . 96 ; P . Giss. 1 34 (a. 265 - 266 u . Chr.), Neudruck MITTEIS a . a . 0 . Nr. 75 S . 84 ff; vgl. noch fragm . Vat. 164- 167, 210 . Nach frg . Vat. 167 und 210 sollen vier oder fünf Exemplare des Libells dem Prätor überreicht werden , je nachdemn ob dies in einer Sitzung pro tribunali geschieht oder nicht. Davon dürften ein bezw . zwei Exemplare bei den Akten des Praetors geblieben sein, eines bekommt die Ortsbehörde, eines der Gegner und schliesslich das letzte, die litterae rescriptae, mit dem Originale oder der Abschrift der Zustellungsur kunde der Kläger. Vgl. hierzu auch 0 . EGER , Agnitio bonorum possessionis vom Jahre 249 p . C ., Sav. 2 . XXXII (1911) S . 381; STEINWENTER a . a . 0. S . 16 Anm . ). Andere Erkärungs versuche: Huschke in seiner Ausgabe der fragm . Vat. Anm . zu 167 (HUSCHKE-SECKEL-KÜBLER, Iurisprudentia Anteiustiniana II 26, Lipsiae 1927, S . 259 Anm . 5 ), WIEDING a . a . 0 . S . 328 f, 503 ff, KIPP a . a . 0 . S. 129 Anm . 25 . (2 ) Vgl. Paul. Sent. 5 a , 6 (7 ); Fragm . Vat. 167, 217 ; D . 5 , 3, 20, 60 ; 40, 5 , 26 , 9 ; s. auch D . 16 , 3, 5 , 2, 43, 5, 3, 9 ferner D . 5, 3, 20, 11; 5 , 2, 7; 39, 2 , 4 , 5 ; C . 7 , 43, 7 ; 9 (a. 290 ) ; vgl. hierzu auch WIEDING, a . a . 0 . S . 303 ff'; BARON , Der Denuntiationsprosess SS 3 , 4 S . 16 - 32 ; KIPP , Die Litisdenuntiation $ 21 S . 119 ff ; s . auch § 22 S . 135 ff'; STEINWENTER a . a . 0 . S . 17 ff, 26 ff, 124 f; WLASSAK , Provinsialprozess S . 38 Anm . 7 , 40 Anm . 7 ; Boyť a . a . 0 . S. 157- 269. (3 ) A . a . 0 . S . 18 , 20 - 22, 25 f. (4) A . a . 0 . S. 38-40 Anm . 7. (5 ) Institutionen des römischen Zivilprozessrechts, München 1925, S. 263 Text und Anm . 14 . Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians 333 tiatio diejenige unter den drei Formen der evocatio , wo die Rolle des Magistrats am weitesten zurückgedrängt ist , die Tätigkeit der privaten Partei am meisten sichtbar wird. In seinem System gibt es demnach weder eine rein amtliche, noch eine ausschliesslich private denuntiatio . Die denuntiatio Wlassaks (1) ist stets ein halb amtliches Rechtsinstitut auf der privaten Initiative ebenso sehr wie auf der behördlichen auctoritas aufbauend. Nach der Auffassung von Wlassak wäre die denuntiatio also ein analoges Rechtsinstitut zur graeco -aegyptischen ragayyeżia , die bekanntlich eine amtlich zugestellte Privatladung war, bei welcher der Stratege nur eine die Ladung beurkundende Funktion hatte. Durch Annahme der die Ladung erbittenden Eingabe zur Zustellung einer Abschrift verlieh der Stratege der nagayyelia amtlich Nachdruck (2 ). Wurde aber in Rom die denuntiatio ex auctoritate statt von der Obrigkeit vom Kläger ausgeführt, so war es dessen Sache, den Beweis durch pri vata testatio, die erst von Konstantin als gefährlich bekämpft wurde ( C. Th. II 4, 2 (a . 322)) zu sichern. Die nagayyežia weich demnach von der denuntiatio in Wlassakschem Sinne insofern ab, indem bei ihr die Mitwirkung des Magistrats sich nicht auf den Augenblick beschränkt, in dem ihm der Libell des Klägers überreicht wird , sondern sich bis zur vollendeten und bestätigten Mitteilung an den Beklagten fortsetzt. Nach der Lehre Wlassaks über die Denuntia tion hätte der viel besprochene Erlass des Kaisers Konstantin über die Prozesseinleitung durch Streitansage in C . Th . JI 4, 2 (322 Mai. 23), der die privata testatio als unzureichend , ja, indem sie Gelegenheit zu Betrügereien bot, als gefärlich bekäinpft und die Bezeugung des Vollzugs der Ladung, der jetzt immer Amtssache (1) WLASSAK a . a . 0 . S. 38 -40 Anm . 7 . (2) Vgl. 2. B. BGU I 226 (a. 99 n. C. ed . Viereck), Neudruck MITTEIS , Chrestomathie , Nr. 50 S, 56 ; P . Teb . Il 434 (a . 104 1 . C ., ed . Grenfell -Hunt), Neudruck MITTEIS a . a. 0 . Nr. 51 S. 56 f; P . Lond . II S. 171 Nr. 358 (a. un gefähr 150 0 . C . 150, ed. Kenyon ), Neudruck MITTEIS a . a. 0 . Nr. 52 S . 57 f; gefiteb.Il 303 . Amb. 1998 ; P. Lipo 39 t – Mhen papyrused. Gre P . Teb . Il 303 (a . 176 -180 n . C ., ed. GRENFELL-Hunt), Neudruck MITTEIS a . a. 0 . Nr. 53 S. 58 ; P . Amb. II 81 (a. 247 n . C . edd. GRENFELL-Hunt), Neudruck MIT TEIS a . a . 0 . Nr. 54 S . 58 f ; P . Lips. I 33 Col. II (a . 368 n . C . ed . Mitteis) , Neudruck MITTEIS a . a. 0. Nr. 55 S . 59 ff = MEYER , Juristische Papyri Nr. 88 , S . 300 f 8 . auch Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Ae gypten I, Berlin 1922, S. 206 ; P . Oxy. I 67 (a . 338 n. C ., ed. Grenfell -Hunt), Neudruck MITTEIS , Chrestomathie, Nr. 56 S. 63 f = MEYER, Juristische Papyri Nr. 87, S. 296 f. 334 Elemér Balogh sein soll, der Behörde zuweist, nur eine verhältnissmässig gering fügige Aenderung. Durch ihn wird nach der Wlassakschen Auffassung die Natur der Ladung im wesentlichen nicht gewandelt, nur der letzte Teil, das abschliessende Stück des Denuntiationsverfahrens d . h. die Zustellung der Ladung die bisher noch privaten Charakter trug, hat diesen verloren . Stimmt auch Boyé den Ausführungen Wlassaks über die Denuntiation vielfach überein , so bestreitet er jedoch die von Wlassak behauptete Einbeitlichkeit der Denuntia tion , die nach Wlassak mit Ausnahme des Falles, wo der Kläger ein Unfreier ist wie im Falle des S. C . Rubrianum (1), als die Ladung durchaus in der Hand des Bearnten liegt, stets ein halb amtliches Rechtsinstitut gewesen wäre. Nach Boyé bestünden Zweierlei Denuntiationen. Zunächst hätte es eine rein amtliche De nuntiation gegeben, neben der aber auch eine halbamtliche im Laufe der klassischen Zeit sich entwickelt und stets wachsende Bedeutung erlagt hätte (2 ). Uns vermag auch der Versuch Boyés, auf zwei Ladungen , eine offizielle und eine halboffizielle, zurückzukommen , nicht ganz zu befriedigen . Leider fehlt der Raum zu genauerer Auseinandersetzung an diesem Orte. Wir wollen hier nur folgendes hervorheben . Einerseits ist es gewiss unbestreitbar, dass in dem Verwaltungsstreitverfahren der cognitio extra ordinem (3) eine rein (1) D . 40, 5 , 26 , 7, 9 . ( 2) A . A . 0, S. 187 f, 195 8, 205 . (3 ) So bereits PERNICE, Volksrechtliches und amtsrechtliches Verfahren in der römischen Kaiserzeit, Festgabe für Georg Beseler, Berlin 1885, S . 51- 78 . Die Ausführungen von PERNICE haben einen würdigen Verteidiger in dem scharfsin nigen französischen Gelehrten Girard gefunden (Manuels s . 1132 ff ). Mit Unrecht erblickt Samfer im Gegensatze zu Pernice in der Nicht-Förmlichkeit das Wesen dieses Verfahrens (Nichtförmliches Gerichtsverfahren , Weimar 1911. Vgl. dazu die Besprechungen von A . Berger in Grünhuts Zeitschrift für das Privat- und offentliche Recht der Gegenwart, XL, Wien 1914 S . 311- 321 und A . STEINWENTER in Kritische Vierteljahrsschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, LII (3 F . XVI) München 1914, S. 59-69, die der Auffassung von Samter nich bei pflichten . Mit Recht hat bereits Steinwenter nachdrücklich betont, dass Samter in seinen Ausführungen nicht immer die beiden Antithesen Formular- und Kog nitionsprozess wie ordentliches und ausserordentliches Verfahren genügend auseinandergehalten hat, so dass seine Lehren bald nur für den ausserordentlichen , bald für den Kognitionsprozess überhauptzutreffen ( Studien sam römischen Ver säumnisverfahren S. 5 -6 . 335 Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians offizielle Ladung geherrscht hat (1), die zweifelsohne aus dem ius vocandi der Imperienträger abzuleiten ist (2), aus deren Koer zitionsgewalt auch die Zwangsmassnahmen gegen Ungehorsame fliesen (3 ). Andererseits ist es aber für unser Empfinden nicht ohne weiteres annehmbar, dass nur von hier aus die Entwicklung durch eine Milderung der Formenstrenge sich vollzogen hat. Man muss doch auch dem Zug der damaligen Entwicklung : private denuntiatio als Sitte unter anständigen Leuten , Einmischung des Prätors bei drohender Gefahr und denuntiatio ex auctoritate Rech nung tragen . Es ist durchaus wahrscheinlich , dass mit der Aus dehnung der Kognitionsverfahren in der Kaiserzeit - und das wohl in der Tat ausgehend von den römischen Provinzen - die ursprünglich rein private denuntiatio in die evocatio denuntiatione Einlass zu finden gewusst hat. Zudem wird man den Eifer des Klägers, der sich sicher dazu angeboten hat, die Klageschrift zu übermitteln , nicht gerne ungenutzt haben vorübergehen lassen wollen . Diese evocatio denuntiatione ist ein vielgestaltiges Verfahren und je nachdem , von welcher Seite man sie im Augenblick be trachtet, verändert sie ihren Charakter. Die Bezeichnung halboffi ziell gibt vielleicht am klarsten Rechenschaft darüber, dass hier von beiden Seiten die Entwickelungsstränge zusammengestossen sind, und vielleicht findet man in der Anerkennung dieser Eigenart die beste Möglichkeit zu einer Erklärung. In der Tat sind private und amtliche Ladung in dieser evocatio denuntiationes so innig mit einander verschmolzen , dass es nur zu erklärlich ist, dass sich viele Generationen von Gelehrten solange fruchtlos über den Ur sprung gestritten haben. Leider fehlt der Raum an diesem Orte (1) Vgl. z. B . D. 2, 12 , 1; 4, 4, 29, 2 ; 25 , 4 , 1, 2 ; 26 , 10, 7, 3 ; 34, 1, 3 ; 40, 5 , 26 , 7 ; 9; 48 , 19, 5 pr.; 49, 14 , 2, 3; 15, 4 und dazu BETHMANN HOLLWEG a, a . 0 . II S . 773 f ; Kipp, Litisdenuntiation SS 21-22 S. 119- 143 ; der selbe Contumacia IV, 1166 f; Perrot, L'appel dans la procédure de l'ordo iu diciorum , Thèse de Paris 1907 S . 100 ; Steinwenter a . a . 0 . S . 8 ff. (2) Gellius Noct. Att. 13 , 12; s. auch Tac. Ann . XIII, 28 und dazu LEFÉVRE, Du rôle des Tribuns de la Plèbe , Thèse de Paris 1910 S. 190, 250. Bereits MOMMSEN hat mit besonderem Nachdruck hervorgehoben, dass der römische Oberbeamte das Recht habe, seine Befehle durch den berechtigten Vermittler , der der Lictor oder in der Regel der viator ist, dem Bürger zugehen zu lassen, d . h . er die Ladung habe, wofür die vorher angeführte Gellius- Stelle einen unumstösslichen Beweis liefert (Römisches Staatsrecht 13 S . 144-145). ( 3) Gell. Noct. Att. 13, 12, 6 . 336 Elemér Balogh zur Auseinandersetzung mit den modernen Theorien über die Natur der Ladungsdenuntiation, die eine überaus dankbare Aufgabe wäre, da diese Denuntiation auch bei dem gegenwärtigen Stand der Li teratur mit zudem am wenigsten aufgeklärten Teil des römischen Zivilprozesses gehört. Wir verweisen einstweilen auf die einschlä gige Literatur (1), vor allem auf die sorgfältigen Ausführungen von Boyé, der jedoch die Frage zunächst nur für die Prinzipatszeit. ins Auge fasst, andererseits aber die Quellen und die Literatur in weitgehendem Masse berücksichtigt (2). Wir können die Erörterung der stadtrömischen Entwicklung der Prozesseinleitung nicht abschliessen, ohne noch einmal auf die berühmte Aurelius Victor-Stelle de Caesaribus 16 , 11 einzugehen, die von der Gelehrtenwelt überaus verschieden bewertet worden ist (3 ). Wir neigen nämlich zu der Ansicht, dass die dort erwähnte (1) Vgl. statt aller WIEDNIG , Der Justinianische Libellprocess, insbesondere SS 18 -31 S. 260 -686 , BETHMANN -HOLLWEG , Der römische Civilprosess, III ( 1866 ). S . 233-292, 303, s. auch II (1865) S . 606, 771-774 ; BARON , Der Denuntiations process (1887) insbesondere S. 1 f., 6 , 16 f, 32 f, 49 ff, 56 ff, 94 ff, 103 ff, 109 ff, 120 ff ; KIPP, Die Litisdenuntiation , insbesondere SS 21-22 S . 119-143 , SS 26 -27, S . 159- 170, derselbe, Denuntiatio in : RE. V (1905), Sp. 223 # ; EISELE, Zur Ge schichte der Ladungs- Denuntiation , in Beiträge zur römischen Rechtsgeschichte, Freiburg i. B . 1896 S . 268-284; STEINWENTER a . a . O ., insbesondere S . 17 ff, 46 , 112 ff; 115f; WLASSAK , Provinzialprosess, S . 38-40 Ann . 7 , 45, 56 f, 58. 78 f; BERTOLINI, Appunti didattici di diritto romano, Serie seconda. Il proeesso civile III, Torino 1915, S 38 S . 129 ff ; Costa, Profilo storico del processo civile romano, Roma 1918 S . 151 ff ; DE FRANCISCI, Evvákaayua ll, Pavia 1916 , S. 264 ff ; Boyè a. a. 0 . S . 168 ff ; WENGER n . a. 0 . S. 261 ff, s. auch S. 269 f.; MITTEIS , Zur Lehre von den Libellen und der Prosesseinleitung nach den Pa . pyri der frükeren Kaiserseit, Sitz- Ber. Sächs. Ges. Wiss. S . XII (1910 ), 4 Heft S . 61-126 ; derselbe bei MITTEIS -WILCKEN , Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde II 1 (Juristischer Teil. Grundzüge) Leipzig 1912 S. 32 ff. (2) A . a . 0 . (3) Im Gegensatze zu der älteren Literatur, von deren Vertreter wir hier nur auf GoTHOFREDUS (Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis Jacobi Gothofredi ed . Ritter. I. Lipsiae 1736 , Comment. ad C. Th. 2, 4, 1 S. 112), Fr. L . KELLER ( Der römische Civilprocesso ed . Adolf Wach (1883), § 48 S. 245 f) und SAVIGNY (Ueber das Interdict quorum bonorum , in Vermischte Schriften II (Berlin 1850) S. 259 f. Zur älteren Literatur vgl. weitere Angaben bei KIPP, Die Litisdenuntiation S . 7 -9 ; BARON, Der Denuntiation process S. 72 f) himweisen wollen, hat Lenel die Bedeutung des angeführten Berichtes von Aurelius Victor bestritten (Beiträge zur Kunde des Edicts und der Edictcommentare, Sav. 2 . Il (1881) S. 45 Anm . 83). Lenels Ansicht fand in der Literatur grossen Anklang . Wie Lenel so unter anderen auch KIPP (a . a . 0, S. 175 f), NABER (Observatiun Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians 337 Regelung des Kaisers Marcus sich nicht nur nicht, wie Wlassak meint, auf die Provinzen beschränkt, sondern gerade für die Stadt Rom galt. Von Vadimonien als von einem grundlegenden Rechts institut wissen wir nur aus Rom selbst. Dass solche auch in den Provinzen vorkamen und zwar nicht nur im Prozess von Römern untereinander, ist unbestreitbar und passt auch vortrefflich zu unserer Auffassung, dass sich römisches Rechtsdenken auch in den Provinzen weitgehend durchgesetzt hat. Cicero bekundet das vadi monium als eine Einrichtung des sicilischen Zivilprozesses, jedoch war sein Anwendungsgebiet hier sehr eng begrenzt (1). Zur Zeit culae de iure Romano. (LVII. De actione edenda, Mnemosyne N . S. XXII ; Lugduni-Ratavorum 1894 S. 261), MARIA (Le vindes dans la legis actio per ma nus injectionem et dans l' in ius vocatio, Thèse de Paris 1895 S . 237 Anm . 13 ), FILIPPO MESSINA VITRANO (La mala fede con l' inizio della lite nella « heredi talis petitio » , Bullettino dell' Istituto di diritto romano, XX, Roma 1908 S . 232 Anm . 1), FLINIAUX (Le vadimonium , Thése de Paris 1908 S . 107-108 ; Vadimo nium in : DAREMBERG , SAGLIO , POTTIER , Dictionnaire des antiqués grecques et romaines, V, Paris 1917 S. 621), SAMTER (Nichtförmliches Gerichtsvsrfahren , Weimar 1911 S . 104- 109), BERTOLINI (Appunti didattici didiritto Romano. Serie seconda. Il processo civile 1, Torino 1913 S. 245), STEINWENTER (a . a . 0 . S. 163 164) und CORODEANU (Sur la fonction du Vindex , Bucarest 1919 S . 45 Anm . 3) ANDERS BARON (Der Denuntiationsprocess S . If, 68 ff) und neuestens WLASSAK ( Provinsialprosess S . 37 ), dem sich unter anderen auch MITTEIS ( Sav . Z . XL 1919 S . 362 f), KOSCHAKER (Deutsche Literatur -Zeitung XLI, 1920 S . 366 ), PAUL M . ME YER (Zeitschrift für vergleichende Restswissenschaft XXXIX 1921 S . 273) und WENGER ( Institutionen des römischen Zivilprozessrechts, München 1925 S . 261 Anm . 5 , 265, Anm . 17) angeschlossen haben . WLASSAK will, wie er es nach drücklich betonte der gemeinhin als unglaublich verworfenen Nachrichtdes Au relius Victor, De Caesaribus 16 , 11, dass schon Kaiser Marcus die Vadimonien beseitigt und die Denuntiation eingeführt habe, durch die Beschränkung der selben aufs provinzielle Prozessrecht zum Ansehen verhelfen . Hienach mag die Ladungsreforin Marc Aurels sich keineswegs auf das ganze Reich bezogen, son dern unter Ausschaltung Italiens, das die Vadimonienladung hatte, für den Provinzialprozess mit seiner dort längst bestehenden Denuntiationsladung ein heitliche Neuordnung und Unifizierung etwaiger bis dahin bestehender provin zialer Verschiedenheiten bezweckt haben . Stimmt auch Boyė, nach dem der Nachricht des Aurelius Victor ebensowenig ein übermässiges Ansehen wie eine völlige Verachtung gebühren würde, mit den Ausführungen von Wlassak nicht durchweg überein , so ist sein Standpunkt jedoch im Grunde zu dem von Wlas sak vertretenen äbnlich (A . a. 0 . S . 271 ff). (1) In dem angeführten Bericht des Aurelius Victor bedeutet der Ausdruck vadimoniorum sollemni remoto keineswegs die völlige Beseitigung der Vadimo nien, wie dies gewöhnlich, so unter anderen auch von KIPP (a . a . 0 . S . 172), SAMTER (a . a . 0 . S . 104 ). FLINIAUX (Le Vadimonium , Thèse de Paris 1908 S . 338 Elemér Balogh des Kaisers Marcus konnte doch wohl eine gesetzliche Zurückdrän gung der Vadimonien nur für die Stadt Rom einen Sinn haben (1). 107), WLASSAK (a. a , 0. 37) und WENGER (a . a . 0 . S. 261 Anin . 5) angenom men wird, vielmehr wollen diese Worte nur besagen dass infolge des Gesetzes des Kaisers Marc Aurels das Vadimonium seine bisherige Allgemeingiltigkeit verlor und nur noch selten (z. B . unter solchen Anwesenden, welche einander ein rücksichtsvolles Benehmen schuldeten ) angewendet wurde, d . h . im wirkli chen Gebrauch beschränkt wurde (So schon BETHMANN -HOLLWEG a . a . 0 . II S . 202. Text und Anm . 33). Denn wir haben unumstössliche Belege dafür, dass Vadimonien auch nach Marc Aurel vorkommen (Coll. Leg. Rom . et Mos. II 6 , I (Paulus) ; Ammianus Marcellinus XXX , 4, 9), selbst wenn wir auf den Stand punkt stellen, dass in den Ediktskommentaren die cautio iudicio sisti der klas sischen Juristen echt und nicht für vadimonium interpoliert wäre, wie Lenel meint (Vgl. D . 2, 11, 9 (Ulp. 1694 Lenel Pal. II Sp. 868 ; LENEL, Das edictum perpetuum3, Leipzig 1927 S. 515 ] 44, 2, 5 [Ulp. 1658 Lenel Pal. II Sp. 85). Nach Lenel wäre das Wort vadimonium auch in den folgenden Stellen durch andere Ausdrücke ersetzt: D . 45, 1 , 81 [Ulp. 1695 , Lenel Pal. II Sp . 869-870 ; Das edic tum perpetuum3 S. 515 ]; 2, 10, 1 [Ulp. 299, Lenel Pal. II Sp. 446 ; Das Edic tum perpetuum3 S. 80) ; 2, 8, 16 [Paulus 150, Lenel Pal. I Sp. 975 ; Das Edic tum perpetuum S. 80 ]; 2 , 9, 2 [Paulus 153, Lenel Pal. Sp. 976 ; Das Edictum perpetuum3 S . 80 ]). Nach Lenel hätten die Kompilatoren das Wort vadimonium aus zahlreichen Stellen getilgt und durch Ausdrücke ersetzt, die auf die stipu latio iudicio sisti des späteren Rechts beziehen ( Das Edictum perpetuum insbe. sondere S. 80 ff, 515 f). Hierin pflichten unter anderen KIPP (a. a . 0. S . 178 ), FLINIAUX ( Vadimonium , in Daremberg, Saglio , POTTIER, Dictionnaire des An tiquités Grecques et Romaines V S . 621. Er fügt zu den von Lepel als interpo liert bezeichneten Stellen noch D . 2, 5, 3 ([Ulp .] zu ), STEINWENTR (a, a, 0 . S. 163 Text und Anm . 4 ), KRÜGER (bei MOMMSEN KRÜGER , Digestalt in den von Lenel angeführten Stellen , zu denen er noch diel, D . 2, 5 , 3 hinfügt vgl. S . 49 Anm . 14 ), CUQ (Manuel des institutions juridiques des Romains, Paris 1928 S. 869 Anm . 2) uud Boyè (a . a. 0 . S. 273 Text und Anm . 8) bei. (1) Cic. in Verrem II, 3, 15 , 38 ; II, 3, 20, 51; II 3, 34, 78 ; II, 3, 40 , 92 ; II 5 , 54, 141. Entschieden irrig ist die Annahme von Voigt, dass die von Cicero als Vadimonium bezeichnete Einleitungsform des sicilischen Civilprozesses nicht ein wahres Vadimonium sei, sondern eine Citation, welche sich zu der von dem Kläger und unter Mitteilung des Klaggrundes vor Zeugen bewirkten Ansage des künftigen Termins für das scribere dicam , als der Einreichung der Klagschrift beinn Magistrate gestaltet. (Oeber das Vadimonium a . a . 0 . S . 345 ). Ebenso ent behrt jedes Grundes die weitere Behauptung von Voigt, dass dieses Vadimonium nicht das in den sicilischen Prozess übertragene römische Citations- Vadimonium sondern ein aus vorrömischer Zeit beibehaltenes hellenisches Citationsverfahren gewesen wäre (a . a . 0 . S . 340) Mit überzeugenden Gründen haben KIPP (a . a. 0 . S. 157) und FLINIAUX (Le vadimonium S . 144-145 Anm . 1) dies bekämpft. Zu den angeführten Cicero-Stellen vgl. die gediegenen Ausführungen von FLINIAUX ( a. a. 0 . S . 142-148, bei DAREMBERG , SAGLIO, POTTIER a . a . 0 . S.622) Dagegen Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians 339 Und die Einführung der litis denuntiatio hätte in den Provinzen nicht solch einen Eindruck gemacht, dass Aurelius Victor noch eine Erinnerung an das Ereignis bewahrte. War doch dort ein amtliches Verfahren schon lange im Zuge der Entwicklung. Dagegen war für Rom eine offizielle Zurückdrängung der Vadimonien zur Zeit des Kaiser Marcus sowohl Bedürfnis wie Ereignis. Auch das oppe riri ad diem war nur für Rom etwas Neues und dürfte mit der Konventsrechtssprechung garnichts zu tun haben , sondern eher eine Einlassungsfrist bedeuten, vielleicht die Vorläuferin der späteren Viermonatsfrist. Wenn Wlassak meint, die von ihm angenommene Beschränkung der Vorschrift des Kaisers Marcus auf die Provinzen habe Aurelius Victor deshalb übersehen können , weil zu seiner Zeit das Provinzialrecht eben längst auch stadtrömisches Recht geworden sei, so ist das insofern eine petitio principii, als eben, wenn das Dekret von Kaiser Marcus auf die Stadt Rom bezüglich ist, daraus folgen würde, dass gerade die stadtrömische Entwicklung für das gemeine römische Recht der Spätzeit entscheidend ge worden ist. Im übrigen ist das Zeugnis des Aurelius Victor, da es ganz allein steht und wir ja leider infolge der grossen Lücke zwischen den Historikern Tacitus und Ammianus Marcellinus von der Zeit der Antonine so wenig wissen , nicht geeignet, als Grund lage umfassender Theorien zu dienen und wir sind uns auch der Fragwürdigkeit des eigenen Versuches der Ausdeutung dieser Stelle voll bewusst. Bei der Erörterung der Viermonatsfrist, binnen welcher die Parteien nach dem Recht des 4. Jahrhunderts zur Prozesseröffnung zu erscheinen hatten und die mit der denuntiatio ( C . Th. II 4 ), durch deren Zustellung ihr Lauf ausgelöst wird, verknüpft ist (1) konnen wir WENGER (Rechtshistorische Papyrusstudien , Graz 1902 S. 64 ff) und FLINIAUX , (Le vadimonium S . 148-154 ) nicht beipflichten als obder P . Oxy II 260 (Neudruck bei MITTEIS , Chrestomathie Nr. 74 S . 83) aus dem Jahre 59 n . Chr. für Agypten eine zum vadimonium analoge Einrichtung bekunden würde. Ihre Gründe sind nicht überzeugend . Wir schliessen uns vielmehr Lenel an , dass die in dieser Urkunde erwähnte zveiseitige Uebereinkunft sicher kein Va dimonium ist ( Das Edictum perpetuums S . 81 Adm . 5 , 515 Anm . 10 . (1) C. Th . II 6 , I (316 Mai 6 ); Symmachus, Relationes 32 (epp. X 45, al52) § 1 (ed . SEECK in Monumenta Germaniae Historica, Auctores antiquissimi VI 1 Berolini 1883 S . 305) (a . 384-385 ) ; 39 (epp. X 52 al. 58 ) (a . 384-385 ) SS 3-4 (ed . Seeck a . a. 0 . S . 311) P . Lips. 33 (Neudruck MITTEIS, Chrestomathie Nr. 55 S . 60 ff. ; MEYER , Juristische Papyri Nr. 88 S. 300 f) Col. Il Z. 5 -6, 8 -11, 13- 14 . 340 Elemér Balogh wurde die Wichtigkeit des Versäumnisverfahrens wiederholt her vorgehoben . Dieses Versäumnisverfahren ist kein Versäumnisver fahren im Sinne etwa der heutigen deutschen Zivilprozessordnung, in dem der abwesende Kläger ohne weiteres abgewiesen, der aus gebliebene Beklagte indessen nur als geständig angesehen wird , sondern ein Verfahren , in welchem so gut es ging, ohne die weg gebliebene Partei verhandelt und auf Grund der Verhandlung geurteilt wurde. Erst im Formularprozess kam jedoch dieser Ge danke einer sachlichen Verhandlung ohne Mitwirkung beider Par teien im Verfahren bei Ausbleiben einer Partei nach der Litiskon testation (deserere litem Papinianus in D . 3, 5, 30 (31) 2 ) s. hier auch Paulus Sent. I 13 , 1 f = D . 42, 1, 54, 1 .....litem inchoatam deseruit, ferner Paulus in D . 46, 7, 11 ....litem deseruerit...), das vor Justinian (C . 3, 1, 13, 3, 4 [a. 530]. Nov.69 c. 3 pr. [a .538 ]) bereits von Ulpian als eremodicium ( 1) bezeichnet wird ( 2), zur Anwen Zu der viel umstrittenen Viermonatsfrist vgl. statt aller Kipp . a. a . 0 . S . 281 ff; BETHMANN-HOLLWEG a. a. 0 . III S . 236-237 ; MITTEIS , Griechische Urkunden der Papyrussamlung zu Leipzig 1, Leipzig 1906, Einleitung zu P. 82 S. 90 ff ; Chrestomathie Nr. 55 S . 59 ff, vor allen aber in Sav. Z . XXVII (1906 ) S. 35 ) f, XXIX (1908 ) S. 471 f ; Zur Lehre von den Lübellen und der Prozesseinleitung a . a . 0 . S . 113 ff ; STEINWENTER a . a . 0 . S. 116 , 122 ff ; WLASSAK a . a . 0 . S. 40 Anm . 7 ; MEYER, Juristische Papyri N . 88, S. 299 f; ARANGIO -Ruiz , Rivista di papirologia giuridica per l' anno 1910 , Bullettino dell' Istituto di diritto Romano XXIV ( 1912) S. 271-272 ; BERTOLINI a . a . 0 . S . 131-132 ; DE FRANCISBI a . a . 0 . S. 270 f; Cum a. a. 0. III, S. 890 ; Boyé a. a. 0 . S. 214; GIRARD a. a. 0. 1142 Anm . 1 ; WENGEB, Institutionen des römischen Zivilprozessrechts S . 195 f Text und Amn. 68. (1) " Eonuos dinn, dazu MOMMSEN, Römisches Strafrecht (= Binding' s Sys tematisches Handbuch der Deutschen Rechtswischenschaft i 4 ), Leipzig, 1899 S . 332 Amn. 5 ; Voigt, Römische Rechtsgeschichte , II, Stuttgart, 1899, § 76, S . 83 Amn. 17 , § 80 S . 125 Amn. 6 . (2) D . 4, 4, 7, 12 ; 46, 7, 13 pr. Ohne hinreichende Gründe behauptet STEIN WENTER, dem hierin auch WENGER (a.a. 0. S. 195 Anm . 68) und GIRARD (Manuel8 S . 1100 Anm . 2 ) beipflichten, dass eremodicium für Versäumnisverfahren erst dem justinianischen Rechte angehören würde und in den eben angeführten Ulpian -Stellen interpoliert wäre a . a . 0 . S . 95 ff; vgl. dazu auch S . 69 Anm . 49, 192). Zur Auseinandersetzung mit Steinwenter fehlt der Raum mir hier leider. Uebrigens hat bereits Petot di Frage nach Interpolation des Ausdruckes eremo dicium in D . 46 , 7, 13 pr. aufgeworfen, sie aber mangels an sicheren Merkmalen sehr richtig verneint (a. a. 0. S. 48 Anm . 1). Zu eremodicium vgl. statt aller : BETHMANN-HOLLWEG a.a. 0 . I S. 187, II 603 ff, III S. 397 ; KELLER-WACH , Der Römische Civilprocesso, Leipzig 1883, 8 69 S. 365 ; PERNICE, Parerga V , Sav, Z. XIV (1893) S. 160-162 ; KIPP, Eremodicium Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians 341 dung (1). Nach den 12 Tafeln war es bekanntlich noch so, dass bei unentschuldigtem Ausbleiben (2 ) einer Partei im iudicium der Streit zu Gunsten des Anwesenden entschieden wird (3). Wäh rend nach den Zwölftafeln beim Ausbleiben einer Partei bis zum Mittag gewartet wurde (4 ), war später die zehnte Tagesstunde die entscheidende Stunde und zwar scheint dies schon zur Zeit der lex Fannia von Jahre 161 v. Chr. so gewesen zu sein (5 ). Nach der richtigen, früher allgemein herrschenden Auffassung hat dieses RE VI (1909) Sp. 417 -419 ; derselbe, Römisches Recht in Das gesamte deutsche Recht hrsg . von RUDOLF STAMMLER, I, Berlin 1931 S. 155-156 ; DUQUESNE, La contecture générale de la cautio iudicati solvi, Mélanges Fitting, I, Montpellier, 1907 S . 340 Aum . 2 ; derselbe, La translatio iudicii dans la procédure civile ro maine (Annales de l' université de Grenoble, XXII, Paris, 1910 S . 278 Anm . ; Petor, Le defaut in iudicio dans la procédure ordinaire romaine. These de Paris 1912, insbesondere S . 38-49 ; STEINWENTER a . a. 0 . S . 92 ff, s. auch S . 69 Anm . 4 , 141 ; WLASSAK , Eremodicium , in Sav. Z . XXXV (1914) S. 334 ; derselbe, Absentia , RE I ( 1894) Sp. 119-121; Costa, Profilo storico del processo civile ro mano, Roma, 1918 S . 101 mit weiteren Anführungen auf S . 101 Anm . 1. (1) Vgl. C , 7 , 43, 1 : Imp. l'itius Aelius Antoninus Publicio , Non semper compelleris, ut adversus absentem pronunties, propter subscriptionem patris mei, qua significavit etiam contra absentes sententiam dari solere. id enim eo pertinet , ut absentem damnare possis , non ut omnimodo necesse habeas ; 3 , 1, 13, 3 (a. 530 ) . .. etiam absente eo ( sc . reo) eremodicium contra hatur et iudex ( secundum quod veteribus legibus placuit) es una parte cum omni subtilitate causam requirat, et si obnoxius fuerit inventus, etiam contra absentes promere condemnationem non cesset; Ulp . D . 5 , 1 , 73 pr. ; 17 , 2, 52, 18. Vgl. dazu BETHMANN -HOLWEG a. a. 0. II S. 903 Text und Anm . 96 ; KELLER WACH a . a . 0 . S . 354 Anm . 825 . Ohne hinreichende Gründe bestreitet die Beweis kraft der eben angeführten Stellen KIPP, Eremodicium RE. VI (1908) Sp. 418 ; s . auch Römisches Recht, in Das gesamte Deutsche Recht, hersg . von RUDOLF STAMMLER , I (1931) S . 156 . (2) Entschuldigungsgründe : schwere Krankheit, ein mit einem Fremden verabredeter gerichtlicher Terinin (Leges XII tabularum , tab . II 2), Behinderung durch Elementarereignisse und andere (Vgl. auch Festus (290) v. sonticum ; Gell. 20, 1, 27 ; Fest. (P. III) v, insons; (344) v. sontica ; D. 50, 16 , 113 ; 42, 1, 60 ; Cic. de off. 1, 12, 37 ; cf. Festus v. status; D . 50, 16 , 234 pr; Gell, 16, 4 , 4 ; Plaut. Curc. 1, 1 , 4 Festus (273) v . reus ; D . 2, 11, 2, 3, cf. leg. Urson . c. 95 tab. III 2 , 21- 36 , s. BRUNS-MOMMSEN-GRADENVITZ, Fontes iuris Romani antiqui I (1909) S . 20 Anm . ). (3 ) Leges XII tabularum , tab . I 8 . (4 ) Cic . Verr. Il 25, 41. (5 ) Macrobius Sat. 3, 16, 15 ; s. auch KIPP, Römisches Recht a. a. 0. S. 156 . 342 Elemér Balogh Versäumnisverfahren aber mit der Zeit einen milderen und mehr prozessualischen Charakter angenommen, indem im späteren For mularprozess für den Fall des Ausbleibens des Beklagten nicht ohne weiteres Verurteilung eintrat, sondern zuvörderst der Kläger Beweise seines Rechtes beizubringen hatte . Denn in der Formel wird der iudex zur Verurteilung des Beklagten durch die Worte si paret nur dann angewiesen, wenn der Kläger den Grund seiner Klage bewiesen hat und diese ihm daher gerechtfertigt schien . In Abwesenheit des Beklagten wird der Kläger also zur einseitigen Ausführung seiner Sache und zum Beweise zugelassen, und wenn er ihm gelingt, was bei dem Wegfall des Gegenbeweises leichter ist, indem der iudex die Rechtsmittel nicht berücksichtigen durfte , die der Beklagte hätte geltend machen können , so wird der Be klagte verurteilt. Aber auch der entgegengesetzte Erfolg ist möglich und dann wird dieser absolviert, der Kläger mit seiner Klage, die der iudex für unbegründet fand, abgewiesen ( 1). Unsere Quellen bieten nicht den geringsten Anhalt für die Existenz eines Rechts satzes, nach dem im Falle der Versäumnis das paret als gege ben anzusehenist. Der schroffe Standpunkt des Zwölftafelgesetzes durfte auch dem kultivierteren Rechtsempfinden bald derart wi dersprochen haben, dass nicht anzunehmen ist, dass er sich gegen den Wortlaut der Formel gehalten hat. Wir haben aber auch in den Quellen keinen Anhalt dafür, dass man den Abwe senden auch nur als geständig fingierte, um dem Anwesenden den Beweis zu ersparen . Vielmehr musste dieser allem Anschein nach sämtliche Tatsachen, für die ihn die Beweislast traf, auch bei Abwesenheit des Gegners beweisen . Dabei wird allerdings der Beklagte in der Regel besser gefahren sein , da er ja auch nach römischer Auffassung gemäss dem bekannten Spruch von Paulus, wonach der Beweis demjenigen obliege, welcher eine Tatsache behaupte , nicht dem der sie leugne (2), erst nach Beweis der den Anspruch des Klägers rechtfertigenden Tatsache seinerseits für seine Exzeptionen usw . beweispflichtig wurde (3 ). (1) Vgl. die bereits oben angeführten C . 7, 43, 1 ; 3 (Titus Aelius Antoninus); 3 , 1, 13, 3, (a. 530) ; Ulp . D . 5 , 1, 73 pr. ; 17, 2, 52, 18 . (2) Vgl. D . 22, 3, 2. (3 ) Vgl. D . 22, 3 , 19 pr. ; 44, 1, 1. Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians 343 Die eben dargestellte Auffassung , die in der älteren Literatur vor allem von Bethmann-Hollweg (1) näher begründet und unter anderen auch von Keller (2), Rudorff (3), Walter (4 ), Baron (5 ), Puchta (6 ) und Accarias (7) vertreten worden ist und zu deren Vertretern in der neueren Zeit auch Rispoli (8 ) und Wenger (9) gehören, wnrde zunächst von Pernice bekämpft ( 10 ), nach dem der oben angeführte Satz der Zwölftafeln, dass bei unentschuldigtem Ausbleiben einer Partei im iudicium der Streit zu Gunsten des Anwesenden zu entscheiden sei, ach für den Formularprozess gälte. Die von ihm angeführten Stellen (11) bieten aber m . E . keinen Anhalt für seine Annahme. Zur Auseinandersetzung mit Pernice fehlt mir hier der Raum . Ich werde im einer besonderen Abhand lung dies tun . Pernice schlossen sich unter anderen Eisele (12), Wlassak (13), Kipp (14 ), Girard (15 ), Fliniaux ( 16 ), Perrot (17), Duquesne (18), Petot (19) und Costa (20) an. ( 1) A . a . 0 . I. S . 187; II 603 f. ( 2 ) A . a . 0 . S . 354. (3) Römische Rechtgeschichte II Leipzig 1859, § 96 S . 318. (4 ) Geschichte des römischen Rechts, 113 Bonn, 1861 S. 374. (5 ) Geschichte des römischen Rechts, I, Institutionen und Civilprozess, Berlin 1884 S. 429, (6 ) Cursus der Institutionen 10 . Auflage besorgt von PAUL KRÜGER 1 Leipzig 1893, 8 74 S. 537. (7) Précis de droit romain Il", Paris 1891 S. 743. (8 ) La contumacia in procedura civile, I, Diritto romano, Roma, 1904, S. 64. (9) A . a . 0 . S. 196 . ( 10 ) Parerga V , Sav. 2 . XIV ( 1893) S. 160- 162. (11) Cic. Verr. 2 , 17, 41; Livius 39, 18 , 1 ; Sueton Cal. 39 ; Hermog. D . 4 , 4 , 8 ; D . 5 , 2 , 17 , 1 ; Ulp. D . 17 , 5 , 52, 18 ; Ulp . D . 42, 8 , 3, 1 ; D . 46, 7, 13 pr. (12) Abhandlungen zum römischen Civilprozess, Freiburg 1889 S . 187 Anm . 54 . (13 ) Absentia RE I (1894) Sp . 121. (14) Ereinodicium RE VI (1909) Sp. 418 , Römisches Recht, in Das gesamte deutsche Recht hersg. von RUDOLF STAMMLER | (1931) S . 155 -56 Ohne hinrei chende Gründe bestreitet er zugleich die Beweiskraft der von Bethmman -Hollweg zur Unterstützung seiner Ansicht angeführten Quellen. ( 15 ) Manuel8 S. 1000 Anm . 3 . ( 16 ) Le vadimonium S . 110 Anm . 1 . (17) L 'appel dans la procédure de l' ordo judiciorum . Thèse de Paris 1907, S . 74 und 100 Anm . 1. (18) La contexture générale de la cautio judicatum solvi, Mélanges Fitting I S. 340-343, insbesondere S. 342 . (19) A . a. 0 . S . 28-38 . (20 ) Profilo storico del processo civile romano (1918) S. 70 Text und Anm . 1, 103 Text und Anm . 1. 344 Elemér Balogh Die eben geschilderte eiuseitige Verhandlung mit dem Kläger konnte aber im Formularprozess nur bei unentschuldigtem Ausbleiben des Beklagten nach der Litiscontestation stattfinden . Lag hingegen ein Umstand vor, der dem Kläger die Möglichkeit entzog , seinen Gegner zur Einlassung in einen Prozess zu bringen , sei es, dass der zu Belangende zwar am Gerichtsorte gegenwärtig ist , aber um der Klage zu entgehen , sich verborgen hält (1), sei es, dass er von dem Gerichtsorte abwesend ist, ohne für seine Vertretung durch einen Procurator gesorgt zu haben (2 ), so kann de Kläger (1) Ulp . D . 42, 4, 7, 1 ; Vgl. auch Gai. III, 78 ; Cic . pro Quinct. 19, 60 ; 23, 74 ; Prob . Einsidl. 66 F . C. L . = Fraudationis causa latitat (HUSCHKE-SEC KEL -KÜBLER , Turisprudentia Anteiustiniana 16 (1908) S. 91) ; D . 15 , 1, 50 pr. (Pap.) ; 4, 6 , 21, 2 (Ulp .); 42, 5, 36 (Ulp .) ; 2, 4, 19 (Ulp.) ; C . 7 , 72, 9 (a. 299) ; cfr , auch LENEL Das Edicium perpetuum3 (1927), Tit. XXXVIII 8 205 (204) Qui fraudationis causa latitabit, S . 415 . (2) Cic . pro Quinct. 19, 60 s. auch Gai. III 78 ; ferner Ulp . D. 42, 4, 7, 17; 43, 29, 3 , 14 ; Paul. D . 42 , 4 , 6 , 1 ; C . 2 , 12 (13 ), 3 (a . 204 ) 2 , 50 (51), 4 (a . 239 ) s . noch Ulp. D. 5, 1, 19; 42, 4, 2 pr. SS 1, 2 ; 7, 17; 10 ; 42, 5, 5 ; s. dazu LENEL a. a. 0 . tit. XXXVIII § 206 (205 ) S. 415 , 416 . Zu Cic. pro Quinct. 19, 60 statt aller KÜBLER , der aber mit Unrecht die Worts si absens iudicio etc . der KLAUSEL Qui fraudationis causa latilabit, anhängen will (Der Process des Quinctius und C. Aquilius Gallus, Sav . Z . XIV S . 63 f.). Hierdurch schloss sich KÜBLER vor allem MOMMSEN (Recension zu Kellers Semestrium ad M . T . Ciceronem libri sex Gesammelte Schriften III, Juristische Schriften III, Berlin , 1907, S. 552 f.), BA CHOFEN (Recension cu Kellers Semestrium ad M . T . Ciceronem libri sex , Neue Kritische Jahrbücher für deutsche Rechtswissenschaft 1. Jahrg . Bd. 2, Leipzig 1842 = Kritische Jahrbücher für deutsche Rechtswissenschaft. 6. Jahrg. Bd . 12 , Leipzig 1842, S. 982 ; Das römische Pfandrecht, 1, Basel 1847 S. 285 ) ; DERN BURG (Ueber die emptio bonorum , Heidelberg 1850 , S . 68 ), HARTMANN ( Ueber die römische Contumacialverfahren , Göttingen 1851 SS 3-12 S. 8-74 insbesondere S. 37 ff.) und BIONDI, (Bulletino dell' Istituto di diritto romano, XXIX (1916 ) S . 233) an , die die Selbständigkeit einer selbständigen Ediktsklausel qui absens iu dicio defensus non fuerit bestritten . Diese Ansicht müssen wir entschieden ableh nen . Denn die Kommentare beweiseu unbestreitbar die Selbständigkeit unserer Klausel, für die sich erklärt haben , um nur einige Namen anzuführen ; BETH MANN-HOLWEG (a. a. 0 . II, S. 560), KARLOWA ( Beiträge zur Geschichte des rö mischen Civilprocesses, Bonn 1865, S. 116 ), WIEDING (Der Justinianeische Libell process , Wien 1865 , S . 671), RUDORFF ( Edicti perpetui quae reliqua sunt, Leipzig 1869, S . 188 ), KIPP (Die Litis denuntiatio als Processeinleitungsform im römi schen Civilprocess, Leipzig 1887 S. 116 ), LENEL (a . a . 0 . Tit. XXXVIII S 206 (205 ) 8 . 415-416 ), J. Böhm (Die missio in bona cum effectu venditionis als Folge der einfacheu absentia sine defensione, Heidelberger Diss 1908 , Berlin 1908, insbe sondere s. 52 ff. Zur Rede Ciceros pro Quinctio s. 63 -105) FLINIAUX (Les effels de simple absence dans la procédure de l' ordo à l' époque de Cicéron , Etudes Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians 345 kraft eines prätorischen Ediktes die Beschlagnahme des Vermögens des Beklagten (missio in bona, und später, wenn der Indefensus sich nicht besinnt, sogar den Verkauf (venditio bonorum ) begehren , falls kein Dritter in ausreichender Weise dessen Verteidigung (de fensio iudicis) übernimmt, es sei denn, dass der Indefensus ein Un mündiger (1) oder ein in Staatsgschäften Abwesender (2) oder ein in Kriegsgefangenschaft Geratener (3 ) ist, die während der Dauer des sie privilegierenden Grundes nur Besitznahme ohne Verkaufs gefahr zu gewärtigen haben . Bereits in der klassischen Zeit gab es aber bekanntlich eine beträchtliche Zahl von Rechtssachen , die nicht im ordentlichen Prozess mit Geschworenen verhandelt wurden, in denen vielmehr das Urteil in dem so genannten amtlichen Kog nitionsverfahren durch das Beamtengericht gefällt wird . Im amt lichen Kognitionsverfahren ( cognitio extra ordinem oder extraordi naria cognitio) wird die private Ladung, bei der man die Stellung des Gegners vor Gericht der Partei überliess, durch die amtliche Ludung ersetzt; an Stelle des von den Partein in der Litiskon testation mit Schriftformel zustandegebrachten Prozessrvertrages, d 'histoire juridique offertes à P . Fr. Girard, I (Paris 1912) 43 ff.) und WENGER (a . a . 0 . s. 234). Wie es aus den eben vorher angeführten Quellenstellen offenbar bervorgeht, bleiben die Gründe der Abwesenheit des Beklagten von dem Gerichtsorte für die Beschlagnahme und Verkauf seines Vermögens ausser Betracht. Welche Absichten der zu Belangende bei seiner Entfernung im Sinne hat, ist es völlig gleichgültig , da ohne den Beklagten die Litiskon testation keinesfalls zustandekommen kann . Ueberzeugend haben besonders BÖHM ( Die missio in bona cum effectu venditionis als Folge der einfachen ab sentia sine defensione etc. Heidelberg Diss . 1908, Berlin 1908) und SOLAZZI ( L' editto « qui absens iudicio defensus non fuerit », Studi giuridici in onore di Vincenzo Simoncelli, Napoli 1917 S . 311-431 ; La minore età nel diritto romano, Roma 1913 S . 226 -231) näher ausgeführt, dassim klassischen Recht bereits die einfache Abwesenheit des Beklagten zur Beschlagnahme und zum Verkauf sei Des Vermögens geführt hat. Ihnen schloss sich auch WENGER an (a . a . 0 . S . 234 Anm . 14 ). (1 ) Paul. D . 42, 4, 6 , 1 (Die gegensätzliche Ulpian -Stelle D . 42, 5 , 5 ist interpoliert, wie Solazzi es überzeugendbewiesen hat, La minore età S . 226 ff.; L 'editto « qui absens iudicio defensus non fuerit » a . a . O ., S . 421 -424) ; s . auch Lex tabulae (VII Heracleensis dicta ) Tulia municipalis a . 709 ( = 45) 1. 116 f. BRUNS-MOMMSEN -GRADENWITZ, Fontes 17 S . 108 . (2 ) Paul. D . 42, 4 , 6 , 1 ; 1. 2 , 50 (51), 4 a . 239 ; s . auch Lex lulia muni cipalis I. 116 f . a . a , 0 . ( 3) Paul Sent. V 5 B , 2 = D . 42, 5 , 39, 1 ; D . 42, 4 , 6 , 2 . Roma · II 23 346 Elemér Balogh wodurch der Privatgeschworene zum Urteil berufen wird , steht nunmehr das Gericht als staatliche Einrichtung, dem sich die Parteien fügen müssen , mag es ihnen passen oder nicht ( 1). Hier durch fiel die Beschlagnahme des Vermögens des Beklagten weg, durch die man im ordentlichen Prozessmit Geschworenen der Schutz losigkeit des Gläubigers zu Hilfe kam , wenn ein Umstand vorlag, der dem Kläger die Möglichkei entzog, seinen Gegner zur Ein lassung in einen Prozess zu bringen und wurde zugleich dem Kläger der umständliche und dabei für den Beklagten unnötig ruinöse Web der venditio bonorum erspart. Im amtlichen Kognitionsverfahren fiel das Ausbleiben des geladenen Beklagten unter den Gesichtspunkt der contumacia , des absichtlichen Ungehorsams gegen ein Gebot der Obrigkeit und zog auch deren Folgen nach sich . Durch den Gedanken der contumacia wird im Kognitionsver fahren der Mangel der litis contestatio für das Versäumnisverfahren ausgeglichen . Bezeichnend für den ursprünglichen Sinn von contumacia ist eine Stelle bei Sextus Julius Frontinus, Strategematon I 1, 1: M . Porcius Cato devictas a se Hispaniae civitates existimabat in tempore rebellaturas fiducia murorum . scripsit itaque singulis, ut diruerent munimenta , minatus bellum , nisi confestim obtemperassent, epistulasque universis civitatibus eodem die reddi iussit: unaquaeque urbium sibi soli credidit imperatum ; contumaces conspiratio potuit facere, si omnibus idem denuntiari notum fuisset (2 ). Hier handelt es sich um einen Befehl des römischen Statthalters an die unterworfenen Städte Spaniens. Contumax ist der, der sich um diesen Befehl, der hier de . nuntiert wird, nich kümmert . Diese Verbindung von contumacia und denuntiari muss also schon frühzeitig üblich gewesen sein, denn Sextus Julius Fortinus (40 - 103 n . C .) schreibt dieses militär wissenschaftliche Werk , welches Beispiele von Kriegslisten zusam menstellt; in der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts nach Christus. Ueber den Unterschied von Folge- und Einlassungspflicht (3), die peremptorische Ladung als Voraussetzung des Versäumnisver ( 1) S. auch WENGER a . a . 0. S. 246 -247. (2 ) Bibliotheca Teubneriana , Iuli Frontini Strategemaaton libri quattor edidit Gottholdus Gundermann. Lipsiae 1888, S. 4 . (3) Zur Würdigung von Folgepflicht und Einlassungspflicht und zur Not wendigkeit des Auseinanderhaltens dieser Begriffe vgl. statt aller WLASSAK , Der Gerichtsmagistrat im gesetzlichen Spruchverfahren , Sav. 2 . XXV (1904) S . 158 ff; Provinsialprocess S. 42 ff ; Costa, Profilo storico del processo civile Ro mano S . 187 ff; WENGER a . a . 0 . S. 271 ff. Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians 347 fahrens (1) und seine Folgen herrscht völlige Klarheit, so dass wir auf die Fragen nicht weiter eingehen wollen , zumal ein anderer Punkt uns noch nicht genügend geklärt scheint, der von mindes tens ebenso grosser Wichtigkeit ist. Es handelt sich um das Ver hältnis der Versäumnisstrafen (multae) zum eigentlichen Versäum nisverfahren. Von diesen Strafen ist in den Quellen an verschie denen Stellen die Rede (2). Man sieht bisher in ihnen eine beson ders charakteristische Folge für die ungehorsame Partei. Es muss aber das Nebeneinanderbestehen von Versäumnistrafen und Ver säumnisverfahren Bedenken erwecken . Wozu noch eine Strafe, wenn die ausbleibende Partei schon dadurch benachteiligt wurde, dass ohne sie verhandelt wird. Mann kann auch nicht sagen, die Strafe treffe den Ungehorsam im Interesse des Staates und ein seitig verhandelt werde im Interesse der anwesenden Partei; denn es ist ja gerade das Charakteristische des Versäumnisverfahrens im Kognitionsprozess , dass sein Rechtsgrund auch nur der Ungehorsam gegen die Behörde ist und dass die juristische Auffassung im Ver säumnisverfahren keinen Schutz für den Anwesenden , sondern eine Strafe fiir den Abwesenden sieht (3). Wenn wir uns nun die Quellenstellen ansehen , in denen die nach den Gesagten völlig überflüssige Versäumnistrafe vorkommt, so gewahren wir, dass es eine solche Versäumnisstrafe überhaupt nicht gegeben hat (4 ). Die für die Versäumnisstrafe meistzitierte Paulus- Stelle, D . 2, 5 , 2 lautet folgendermassen Ex quacumque causa ad praetorem vel alios, qui iurisdictioni praesunt, in ius vo catus venire debet, ut hoc ipsum sciatur, an iurisdictio eius sit. Si (1) Vgl. Paul. V 5a, 6 (7); D. 5, 1, 68-73; 42, 1, 53, 1; C. 7, 43, 8-9 (a. 290). Wie aus den eben angeführten Stellen offenbar hervorgeht, wird die Ladung gewöhnlich, wenn der Beklagte nicht erscheint, dreimal ohne Androbung von Nachteilen mit Zwischenfristen von mindestens 10 Tagen vorgenommen. Die vierte Ladung ergeht dann als preremptorisch , d . h . mit der Androhung, dass beim Ausbleiben des Geladenen in seiner Abwesenheit werde verhandelt und entschieden werden . Paul. V 5a, 6 ( 7), D . 5 , 1, 72 und C . 7, 43, 8 (a . 290) bringen andererseits zum unzweideutigen Ausdruck , dass nach Ermessen des Magistrats die Zahl der peremptorischen vorangehenden Ladungen verringert, ja selbst die erste Ladung als peremptorische erlassen werden kann . (2 ) So vor allem D . 2, 5 , 2 ; C . Th . 2. 18, 2 (322 Mai, 23). (3 ) D . 42, 1 , 53, 2 . ( 4 ) A . A . STEINWENTER S . 62. 348 Elemér Balogh quis in ius vocatus non ierit ex causa a competenti iudice (1) multa pro iurisdictione iudicis (2) damnabitur : rusticitati enim hominis parcendum erit : item si nihil intersit actoris eo tempore in ius ad versarium venisse, remittit praetor poenam , puta quia feriatus dies fuit. Wenn diese Stelle sich überhaupt auf das Kognitionsver fahren bezieht, was wegen des Satzes vel alios qui iurisdictioni praesunt wahrscheinlich , aber nicht mit Sicherheit zu erweisen ist (3 ), so besagt sie doch für diesen nur folgendes : jemand, der vor einen unzuständigen Richter (4 ) gerufen wird, hat die Pflicht (5 ) zu kommen . Kommt er nicht, so ist er zwar nicht contumax (6) aber doch strafwürdig . Doch fügt Paulus ausdrück lich hinzu, dass man mit der Geschäftsunknde dieses Mannes milde verfahren und unter Umständen die Strafe ganz streichen soll. Die mit dieser Auslegung in Widerspruch stehenden Worte compe tenti iudice und iudicis sind offenbar interpoliert 7 ). Justinian hat (1) competenti iudice ] duomviro Paul. LENEL Pal. I Sp. 967 Anm . 2. Das Edictum perpetuum3 S . 52. (2) iudicis ] eius Paul. LENEL Pal. I Sp. 967 Anm . 3; Das Edictum per petuum3 S . 52 . (3) A . A . STEINWENTER I. c. S. 58, 62. (4 ) Es kann sich vor allem um örtliche Unzuständigkeit handeln . ; vgl. WENGER a . a. 0 . S . 42. (5 ) Cf. Ulpian D . 5 , 1 , 5 . (6 ) Die Legaldefinition des contumax gibt Hermogenian in D. 42, 1, 53, 1 : Ungehorsam ist derjenige, der nach Erlassung dreier Ladungen, oder anstatt der drei, einer , die gewöhnlich eine peremptorische genannt wird (Vgl. auch Paul. V 5a , 6 (7) ; D . 5 , 1, 72 ; C . 7, 43, 8 (a . 290 ), der peremptorischen Ladung sich persönlich zu stellen verschmäbt. Es sei hier zugleich angedeutet, dass in der späteren Kaiserzeit contumax der gewöhnliche Ausdruck für den mit einer öffentlichen Geldstrafe zu Belegenden ist (Vgl. C . Th . VI 27, 10 [396 Febr. 27 ]). (7) Die Echtheit dieser Stelle ist übrigens schon von verschiedener, überaus zuständiger Seite in Abrede gestellt worden , so von LENEL a . a , O . ; KRÜGER , Dig . Nova Suplementa S . 988 (ut - fin ); BESELER, Beiträge sur Kritik der rö mischen Rechtsquellen , IV (1920) S. 117 [ut - fin .], 165 [ ex causa - item ]; LEIFER , Die Einheit des Gewaltgedankens im römischen Staatsrecht,München 1914 S . 89 , Anm . 1, 139 schliesst sich LENEL an (iudice [duumviro] ; iudicis [duumviri]) ; SECKEL bei HEUMANN -SECKEL, Handlexikon su den Quellen des römischen Rechts9, Jena 1907 s. v. iudex 3 a S. 293 (iudicis [eius]); WLASSAK, Der Judi cationsbefehl der römischen Prozesse , Akademie der Wissenschaften in Wien , Phil.-hist. Klasse , Sitzungsberichte, 197. Band, 4 . Abhandlung S . 181 schliesst sich 1.ENEL an . Den Paragraphen I unserer Stelle bält auch SIBER für interpo lationsverdächtig , Schranken der privaten Rechte , Leipziger Rektoratsrede 1926 S . 29 Anm . 3. 349 Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians nämlich in der Tat auch für Unfolgsamkeit gegenüber dem kompe tenten Richter Strafen (1). Bei Paulus selbst hat die Stelle mit dem Versäumnisverfahren nichts zu tun und es kann nur zwei felhaft sein , ob dort auch der in Wahrheit zuständige Richter gezwungen oder ermächtigt wird , die multa zu verhängen , statt das Versäumnisverfahren einzuleiten, wenn die ausgebliebene Partei sich auf Unzuständigkeit berufen hat oder noch kein Termin zur Geltendmachung prozesshindernder Einreden stattgefunden hat. Die andere Quellenstelle C . Th. 2, 18 , 2 (322 Mai. 23) ist so kurz und undeutlich , dass man aus ihr überhaupt nichts entnehmen kann, das Wort multabit will wenig besagen ( 2). Im übrigen ist es durch aus möglich, dass zur Zeit des C . Th . schon eine Versäumnisstrafe existierte , aber nicht neben dem Versäumnisverfahren, sondern an stelle desselben . Mit dem Verbreiten des Christentums beginnt jene Verweichlichung des römischen Rechtes, die sich vor kräftigem Zugreifen und der Uebernahme einer entsprechenden Verantwor tung scheut. So erscheint es auch nicht ausgeschlossen , das die Richter von dem zur Zeit des Kognitionsprozesses ausgebildeten Versäumnisverfahrens ungern Gebrauch machten. Auch die anwe sende Partei wird wegen der Umständlichkeit und Kostspieligkeit der dreimaligen Ladung oft lieber eine Mult des Gegners ge sehen haben . So durfte nicht neben , aber anstelle des Versäum nisverfahrens oft eine Versäumnisstrafe getreten sein . Eine Stütze für unsere Auffassung ist auch die Reform des Versäumnispro zesses durch Justinian C . III, 1 , 13 (3 ). Dort ermahnt der Kaiser seine Richter, die Prozesse nicht zu verschleppen und ruhig auch in Abwesenheit einer Partei zu verhandelu, vorausgesetzt, dass seit der Litiskontestation bereits 2 "), Jahre verstrichen sind. u . Bei Säumnis des Klägers soll der Richter je nach Aktenbefund ein Endurteil fällen oder den Beklagten von der Instanz entbinden und kläger in die Kosten verurteilen. Entsprechend ist auch das Verfahren bei Säumnis des Beklagten . Hier wird nach der rich terlichen Sachprüfung und einseitigem Anhören des Klägers ein ( 1) C . 3, 1, 13, 26-2c. (2 ) Anders STEINWENTER a . a . 0 . S. 118 f. (3 ) Vgl. stutt aller P. Tuor, Die mors litis im römischen Formularverfah . ren, Leipzig 1906,insbesondere S. 4 ff mit weiteren Anführungen ; Hugo K KÜGER, Besprechung der Schrift von Tuor , Sav. 2. XXVII (1906 ) S. 370 f; WENGER a . a . 0 . S . 292. 350 Elemér Balogh absolutorisches oder kondemnatorisches Versäumnisurteil erlassen und gegen den Abwesenden in dessen Vermögen vollstreckt.(C . 3, 1, 13 , 2 - 3 ). Daraus ergibt sich doch mit einer gewissen Wabrschein lichkeit, dass vor dieser Constitutio überhaupt keine, oder doch nur höchst selten Versäumnisurteile ergingen. Man scheint sich mit Multen geholfen zu haben. Auf die zahlreichen Zweifel, die sich auf dem Gebiet des Versäumnisverfahrens trotz mancher, mi tunter hervorrragender Arbeiten (1) infolge der Lückenhaftigkeit der Quellen noch finden , können wir aber hier leider wegen Raum mangels nicht eingehen. Exkurs . Zur Natierung der Verstaatlichung des provinzialen Formelprozesses. Für die frühzeitige Verstaatlichung des provinzialen Formel prozesses haben wir unwiderlegbare Beweise . Wir haben klassische Zeugnisse dafür, dass in den Provinzen frühzeitig schon statt der Volks-und Privatrichter amtlich beauftragte Unterrichter gewirkt haben . Aus zwei aufeinander folgenden Pandektenstellen , aus D . 1, 18 , 8 und 9 ( 2) geht die frühzeitige Verdrängung des unerlässli (1) Vgl. statt aller 0 . E . HARTMANN, Uber das römische Contumcialverfah ren , Göttingen 1851, F . FILOMUSI-GUELFI, Processo civile contumaciale Romano, Napoli, 1873; A . RISPOLI, La contumacia in procedura civile I Roma 1904; STEINWENTER, Studien zum römischen Versäumnisverfahren , München 1914 (Auf das nachklassische Versäumnisverfahren beschränkt); Petot, Le defaul in iu dicio dans la procédure ordinaire romaine, Thèse de Paris 1912; WIEDING , Der justinianische Libellprocess, Wien 1865 passim ; BARON, Der (römische) Denuntia tionsprocess Berlin 1887 passim ; KIPP, Die Litisdenuntiation ( 1887) passim ; Con tumacia RE IV (1901) Sp. 1166 ff ; Eremodicium RE VI (1909) Sp. 417 ff; SAM TER , Nichtförmliches Gerichtsverfahren Weimar 1911, insbesondere S . 24 -25 , 99 -102, 138 - 140 ; Boyé, La denuntiatio introductive d ' instance sous le principat, Thèse de Bordeaux 1922, passim ; COLLINET, La procédure par libelle (1932 ), ins besondere S . 17, 19, 145, 160, 223, 225 , 243, 252, 269, 270, 373-384, 469 ; BETHMANN -HOLLWEG a . a . 0 . II S. 226 , 289, 770, 775 , III S. 300 : KELLER -WACH a . a . 0 . S . 354, 356 , 367 ; Costa , Profilo storico del processo civile romano ( 1918 ) S . 102 ff, 187, 191 ; WENGER a . a . 0 . S . 183 Anm , 6 , 195 f, 196 Anm . 68, 267 Anm . 26 , 271 , 327. (2 ) S . D I , 18 , 8 : Saepe audivi Caesarem nostrum dicentem hac rescriptione : « eum , qui provinciae praeest adire potes (potest F . S . MOMMSEN D15 p. 44 Anm . 16 ) non imponi necessitatem proconsuli vel legato eius vel praesidi provinciae susci piendae cognitionis, sed eum aestimare debere, ipse cognoscere an iudicem dare Beiträge zur Zivilprozessordnuug Justinians 351 chen Privatrichters in den Provinzen – und zwar durchaus nicht nur in den kaiserlichen – hervor. Diese Stellen bekunden, dass in den Provinzen bereits in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts anstelle der Volks- und Privatrichter amtlich beauftragte Unterrich ter getreten sind, als sich zugleich die Eigenkognition der Statt halter weitgehend durchgesetzt hat. Von den eben angeführten beiden Stellen ist die zweite , wie es sich aus dem Vergleich der beiden Fragmente auf das unzweideutigste ergibt, die jüngere, und sie bietet im wesentlichen nichts anderes wie nur eine etwas erwei terte Neufassung des zuerst angeführten älteren Fragments. Wie bereits der Wortlaut der 1. D . 1, 18 , 9 deutlich erkennen lässt, lag dem Callistratus offenbar der in der 1. D . 1, 18, 8 enthaltene Ju lianische Text vor. Es ist strittig, ob es der Kaiser Hadrian oder sein Nachfolger war, der im Gespräch mit Julian eine Aeusserung 4 häufig , wiederholte , die der Jurist schon in seinem ersten Di gestenbuch anführen konnte, und daher herrscht auch Meinungs verschiedenheit über das genaue Datum , wann in den Provinzen an Stelle der Volks- und Privatrichter amtlich beauftragte Unter richter getreten sind. Während nach Fitting in der vorher ange führten Julianischen Stelle von Hadrian (1) die Rede ist, auf dessen mündliche Aeusserungen unverkennbar Bezug genommen wird, so dass die Stelle in merkwürdiger Weise auf die engen persönlichen Beziehungen Julians zu Hadrian als Mitglied seines Rates und als quaestor Augusti hinzudeuten ist (2), misst Appleton die von Julian hier herangezogenen kaiserlichen Aeusserungen Antoninus Pius zu (3). Wir schliessen uns der Ansicht Fittings an, der überzeu gend dargestellt hat, dass Julian zur Zeit der Abfassung des 6 . Buches seiner Digesten, in dem er über die Erbschaftsklage han debeat 9 . Generaliter quotiens princeps ad praesides provinciarum remitlitnegotia per rescriptiones veluli « eum qui provinciae praeest adire poteris > vel (vel sim pliciter vel MOMMSEN cf. MOMMSEN D15 p . 44 Aom . 17) cum hac adiectione « is ae -stimabit, quid sit partium suarum » non imponitur necessitas proconsuii vel legato suscipiendae cognitionis, quamvis non sit adiectum « is aestimabit quid sit partium suarum » : sed is aestimare debet (cognitionis, sed , quamvis .... suarum , is aest. debet MOMMSEN cf. MOMMSEN D16 p . 44 Anm . 18 ) utrum ipse cognoscat an iudicem dare debeat. ( 1 ) Regierungszeit 11. Aug . 117 bis 10 . Juli 138. (2 ) Alter und Folge der Schriften römischer Juristen von Hadrian bis Ale candera. Halle 1908 . S . 26 . (3 ) La date des Digesta de Julien , N . R . H . XXXIV ( 1910 ), Nr. 29 S . 790. 352 Elemér Balogh delt (1 ), das sogenannte S. C . Juventianum vom 14 März 129 n . Chr. noch nicht gekannt hat, wofür insbesondere spricht, dass er ihn hier nirgends erwähnt hat. Denn hätte dieser wichtige Senatsbe schluss, durch den die Haftung des mit der Erbschaftsklage Be langten geregelt worden ist, zu jener Zeit bereits bestanden , so hätte Julian in jenem Buche notwendig näher auf ihn eingehen müssen. Einen weiteren Beweis dafür, dass Julian bei der Abfas sung des sechsten Buches seiner Digesten das SC . Juventianum noch nicht gekannt hat, liefert die 1. D . 5 , 3, 33, 1, in der Ulpian einen Ausspruch Julians offenbar auch aus dem sechsten Buche von dessen Digesten ( 2) mitteilt (3 ). Hier äussert Julian nämlich Bedenken, die bei Andwendung des SC. Juventianum auf die Erbschaftsklage nach dessen ausdrücklicher Bestimmung (4 ) ausge schlossen waren. Nach der Aeusserung Julians hätten einige die Ansicht vertreten, dass der Nachlassbesitzer, der einen für die Erb schaft notwendigen Sklaven , der noch vor der Anstellung der Erb schaftsklage verstorben ist, verkauft hat, dem obsiegenden Erben zuweilen den Verkaufspreis nicht erstatten müsse, während nach ihm der die Untersuchung und Entscheidung leitende Richter nicht gestatten dürfe, dass der Besitzer den Erlös profitiere. Wäre das SC. Juventiarum zur Zeit dieser Aeusserung vorhanden gewesen, so hätte Julian diese Bemerkung angesichts der klaren Vorschrift des genannten Senatsbeschlusses nicht machen können , und um so mehr, da ihm , wie wir gesehen haben, die Erstattung des Preises (1) S . Lenel Pal. I fr . 76 -89 Sp. 328-331. Si hereditas pelatur. (2) Fehlt auch die ausdrückliche Hervorhebung , dass Ulpian diesen Aus spruch Juliaus dem sechsten Buche der Digesten desselben entnommen hat, so kann dies jedoch nicht bestritten werden . Denn in der 1. D . 5 , 3 , 31 pr. & 5 , die gleich der in Rede stehenden 1. D . 5 , 3 , 33, 1 dem 15 . Buche seines Edikts . kommentars entnommen worden ist und einen ähnlichen Gegenstand behandelt wie diese, hebt Ulpian ausdrücklich hervor. dass er die hier herangezogenen Aussprüche Julians aus dem 6 . Buche der Digesten von ihm mitteilt. (3 ) Julianus scribit, si hominem possessor distraxerit, si quidem non neces sarium hereditati, petitione hereditatis pretium prestaturum : imputaretur enim ei. si non distraxisset: quod si necessarium hereditati , si quidem vivit, ipsum praestandum , si decesserit, fortassis nec pretium : sed non passurum indi cem qui cognoscil possessorem pretium lucrari scribit, el verius est. (4 ) Vgl. D . 5 , 3, 20, 6b : Item placere, a quibus hereditas petita fuisset, si adversus eos iudicatum esset, pretia , quae ad eos rerum ex hereditate venditarum pervenissent etsi vae (ea F . MOMMSEN , cf. MOMMSEN D16 p . 114 Anm . 9) unte pe titam hereditatem deperissent detminutaeve fuissent, resituere debere. Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians 353 innerlich gerecht erschien. Im SC . Juventinianum wurde bekannt lich ausdrücklich festgesetzt, dass diejenigen , von denen eine Erb schaft gefordert werde, wenn gegen sie erkannt worden, den Erlös ersetzen müssen , der an sie für verkaufte Erbschaftssachen gelangt sei, auch wenn dieselben vor Anstellung der Erbschaftsklage ver loren gegangen und vermindert worden wären (1). Auch die 1. D . 5 , 3, 30 bekundet, dass Julian im sechsten Buche seiner Digesten , wo er über die Erbschaftsklage handelt, dem Grundgedanken des SC. Juventianum noch nicht Rechnung trägt. Hier berichtet Paulus über eine Ansicht Julians mit der Beifügung, es sei ihr nicht ihrem ganzen Umfange nach zu folgen, weil sie bei gutgläubigen Be sitzern dem SC . Juventianum zuwiderlaufen würde ( 2). Weitere Be lege wollen wir hier nicht dafür anführen, dass Julian bei der Abfassung des sechsten Buches seiner Digesten das SC. Juven tianum noch nicht gekannt hat, vielmehr verweisen wir diesbezüg lich auf Fitting (3 ). Sind nun aber das 6 . Buch der Julianischen Digesten, und mithin natürlich auch die vorhergehenden Bücher vor 129 abgefasst, so ergibt sich zugleich, dass in der oben ange führten Julianischen Stelle D . 1, 18 , 8, die dem ersten Buche der Julianischen Digesten entnommen worden ist, die kaiserlichen Aeus serungen, auf die Julian hier Bezug nimmt nur von Hadrian herrüh. ren können . Diese Ansicht war auch früher, durchaus herrschend (1) vgl. D . 5 , 3 , 20, 6 b. ( 2 ) Julianus scribit actorem eligere debere, utrum sortem tantum an el usuras velit cum periculo nominum agnoscere. atquin secundum hoc non observabimus quod senatus voluit, bonae fidei possessorem teneri quatenus locupletior sit : quid enim si pecuniam eligat actor, quae servari non potest ? dicendum itaque est in bonae fidei possessore haec tantummodo eum praestare debere, id est vel sortem et usuras eius, si et eas percepit, vel nomina cum eorum cessione in id facienda, quod ex his adhuc deberetur, periculo scilicet petitoris. Ohne annehmbare Gründe behauptet Beseler dass unsere Stelle von « atquin » ab interpoliert wäre. (Bei träge zur Kritik der römischeu Rechtsquellen . II, Tübingen 1911 S . 22 ; III (1913) S . 105). Die stilistischen Unebenheiten beweisen bei Paulus nichs, weil seine Sprache überhaupt weder frei von Fehlern noch gewandt im Ausdruck war. Ueberdies mit « atquin » fängt die Beifügung von Paulus an, mit der er die Ansicht Julians corrigiert, der noch auf das SC . Juventianum nicht Bezug nehmen konnte. Der Satz ist geradezu erforderlich. Dagegen stimme ich Fritz Schulz bei, dass der Satz id est.... facienda interpoliert ist. Seine Argumente sind überzeugend (S . Klagen-Cession im Interesse des Cessionars oder des Ce. denten im klassischen römischen Recht. Sav. 2 . XXVII. Weimar 1906 . S . 113-114). (3 ) S , I. c. S . 25 -26. , 354 Elemér Balogh und es folgten ihr unter anderen auch Mommsen (1), Buhl (2 ), Bou lard (3 ), Karlowa (4 ), Girard (5 ), Landucci (6 ) und Costa (7 ). Stimmt auch Kipp den Ausführungen von Fitting darin nicht bei, dass das 6 . Buch der Julianischen Digesten vor 129 abgefasst worden ist , so neigt er andererseits zur Ansicht, dass das genannte Werk schon unter Hadrian begonnen worden ist (8 ). Haben auch die gelehrten Untersuchungen von Appleton, die in dem Ergebnis gip . feln , dass die Abfassung der Julianischen Digesten ganz in die Zeit des Antoninus Pius gehört (9), die bisherige allgemeine Anerken nung des vorerwähnten Fittingischen Satzes, dass das 6 . Buch der Julianischen Digesten und mithin natürlich auch die vorhergehen den Bücher vor 129 abgefasst worden sind , erschüttert, so dass sich diesbezüglich manche Schriftsteller, wie unter anderen Krüger (10), Rabel (11), Kübler (12), Bonfante (13), Girard (14) und Cuq ( 15 ), (1) Veber Julians Digeslen ZRG IX . Weimar 1870. S. 89. (2) Salvius Julianus I. Heidelberg 1886 . S. 100-103. (3) L . Salvius Julianus, son oeuvre, ses doctrines sur la personnalité juri. dique. Thèse de Paris 1902. Thèse de droit . Paris 1902. S . 108 . (4 ) Römische Rechtsgeschichte 1. Leipzig 1885 S . 108 . (5 ) La date de l' édit de Salvius Julianus N . R . H . XXXIV (1910 ) p. 11 = Me. langes de droit romain I Paris 1912, p . 219 Text u . Anm . 2 ; 220 Text u . Amn. 1. (6 ) Storia del diritto romano dalle origini fino a Giustiniano. I, Padova, 1908 S. 206 Anm . 12. ( 7) Storia delle fonti, Milano 1909, p . 92. (8 ) Geschichte der Quellen d . Römischen Recht4. Leipzig 1919. § 19 . S . 123 . Test u . Anm . 100. (9 ) La date des Digesta de Julien , N . R . H . XXXIV (1910 ) pp . 751-793 ; derselbe : Les pouvoirs du fils de fumille sur son pécule castrans et la date des Digesta de Julien N . R . H . XXXV pp. 593-623, s . insbesondere p . 594, p . 622 Anm . 2, p . 623. (10 ) Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts2 = BINDING : Handbuch der Deutschen Rechtswissenschaft I 22. München 1912 . $ 122 S. 185 Test u . Anm . 42. (11) Besprechung des vorher angeführten ersten Aufsatzes von APPLETON Sav . Z . XXXII, S. 412-413. (12) Geschichte des römischen Rechts . Leipzig 1925 . $ 32, S . 267 . Text und Anm . 5 . (13) Storia del diritto Romano 13, Milano 1923, p . 385 Text und Anm . 5 . (14 ) Manuels pp. 57-58 Anm . 3; 1138 -1139 Anm . 3. Wie wir oben gesehen haben , billigte Girard früher Fittings Standpunkt. (15) Manuel2. Paris 1928, p . 21. Anm . 5 . Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians 355 Appleton , dem auch Wlassak beizupflichten neigt (1 ), angeschlossen haben , so haben diese Untersuchungen von Appleton, wie es aus ihrer näheren Betrachtung hervorgeht, doch keinerlei sicheren Anhaltspunkt dafür, dass die Abfassung der Julianischen Digesten ganz unter Antoninus Pius erfolgt wäre, zutage gefördert, selbst Wahrscheinlichkeitsgründe haben sie nicht geboten . Die Ausfüh rungen von Appleton gegen den Satz von Fitting, dass Julian zur Zeit der Abfassung des 6 . Buches seiner Digesten den sc . Juventianum vom 14 März 129 n . Chr. noch nicht gekannt hat ( 2), können nicht standhalten . Nach Appleton hätte Julian bei der Ab fassung des 6 . Buches seiner Digesten das SC. Juventianum gekannt, verkannte aber das darin enthaltene neue Prinzip und blieb zu Unrecht bei der alten Theorie der Haftung jedes Erbschaftsbesitzers als negotiorum gestor. Nach Appleton wäre es möglich, dass Julian auf die private Erbschaftsklage das SC. Juventianum garnicht für anwendbar hielt , da noch Marc Aurel a . 170 den Zweifel eines pro consul Africae, Nachfolger Julians in dieser hohen Stellung , ent scheiden musste, ob es sich nicht bloss auf Fiskalsachen beziehe (3 ). Julian , dem hervorragenden Juristen , dem berühmten Redactor des Hadrianischen Edictum perpetuum , der bei Zeitgenossen , wie bei Valens, Pomponius, Gaius und Maecian , die ihn häufig anführen und auch bei Späteren bis auf Justinian , in dessen Digesta sowohl unmittelbar als mittelbar ein grosser Teil seiher Schriften überge gangen ist, mit vollem Rechte im höchsten Ansehen war (4) und dessen Digesten derart weitgreifenden Einfluss auf die spätere Li teratur ausgeübt haben, worauf bereits der Umstand hinweist, dass sie mit Notae von Marcellus, Scaevola und Paulus neu herausgegeben worden sind , einer solchen Leuchte der Rechtswissenschaft können wir nicht zumuten , dass er einen derart wichtigen Senatsbeschluss, wie das S. C . Juventianum , nicht genau gekannt oder geradezu verkannt hätte, um so mehr, dass dieser Senatsbeschluss zu seinen ( 1) Provinsialprozess S. 16 , 18. (2) S . La date des Digesta de Julien , N . R . H . XXXIV (1910) pp. 747-771. (3 ) C . 3, 31, 1. (4 ) C. 6 , 61, 5 (a . 473); 3, 33, 15, 1 (a . 530 ); 4 , 5, 10, 1 (a . 530) ; Dig . Const. Tanta (Aėdokev) 18 : ...Julianus legum et edicti perpetui suprilissimus conditor . Elemér Balogh 356 Lebzeiten entstanden ist, beantragt von den Konsuln Q . Julius Balbus und einem der genialsten römischen Juristen P . Juventius Celsus, der sich ebenso durch Reinheit und Klarheit der Sprache wie durch Selbständigkeit in der juristischen Konstruktion ausge zeichnet hat und Vorsteher der proculianischen Schule war, während Julian im Vorstand der Sabinianischen Schule war. Der Vollständig keit halber sei hier nur nebenbei erwähnt, dass Appleton bereits in Leinweber (1) seinen Vorläufer gehabt hat und die Ideen Lein webers, Ruhstrats und seine eigenen kombiniert. Bereits (2) Lein weber glaubte, dass Julian das SC. Juventianum kannte und es anders auslegte als die späteren Juristen (3 ). Was die Ideen Ruh strats anbelangt, auf die Appleton Bezug nimmt, so sind hier dessen Ausführungen gemeint, in denen er gegen die Auffassung der älteren römischen Juristen, insbesondere die von Labeo , Javolen und Julian Stellung nimmt, die jedweden, daher auch den gutgläubigen Erb schaftsbesitzer, als freiwilligen Verwalter der Erbschaft betrachteten . Diese Auffassung muss nach Ruhstrat als durch das SC . Ju ventianum verworfen angesehen werden, so dass nach ihm aus dem Umstande, dass die Justinianischen Gesetzbücher noch manche Spuren jener älteren Auffassung enthalten , nicht geschlossen werden darf, dass das Verwaltungsprinzip auch nach dem SC . Juventianum für die Rechtsverhältnisse des gutgläubigen Erbschaftsbesitzers massgebend war, obgleich dies mitunter behauptet wurde. Nach den Ausführungen Ruhstrats lassen sich verschiedene in den Quellen enthaltene, insbesondere von Julian herrührende Aussprüche nur aus dem alten Verwaltungsprinzip erklären, die Festhaltung an diesem Prinzip würde aber zu unrichtigen Konsequenzen führen (4). Bis zum Auftreten Appletons hat aber die Ansicht Leinwebers keinen Anklang gefunden, wie auch den Ausführungen Ruhstrats in Bezug auf unsere Frage keinerle Beachtung geschenkt wurde. Aus den bisher Gesagten ergibt sich daher, dass gemäss der l. D . 1, 18, 8 und 9 in den Provinzen bereits vor dem Jahre 129 n . . ( 1) S . Die Hereditatis patitio . Berlin 1889, insbesondere S . 54, 72-74, 88-91. ( 2 ) S. Ueber die Rechtsverhältnisse des Erbschaftsbesitzers, Archiv für die Civilistische Praxis LXVII. Freiburg 1884, S . 366 -439, s, insbesondere S . 366 369. ( 3 ) S . a . a . 0 . 72 -74 , 88 -91 . (4 ) S. a . a. 0 . Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians 357 Chr. an Stelle der Volks- und Privatrichter amtlich beauftragte Un terrichter getreten waren . Der aus den angeführten Julian – und Callistratus — Stellen erkennbare Rechtszustand , dass in den Provinzen die durch einen kaiserlichen Bescheid an den Statthalter verwiesenen Streitsachen bereits seit den Zeiten Hadrians entweder durch Eigenkognition des Statthalters oder durch amtlich beauftragte Unterrichter, die vom Statthalter gegebenenfalls bestellt anstelle der Volks- und Privat richter getreten waren, erledigt wurden, hat sich bis zum Justinia nischen Verfahren erhalten . Die früher herrschende Meinung (1) , die Vollendung der zum Kognitionsverfahren führenden Reform , derzufolge der Vertreter der Staatsgewalt , das staatliche Organ selbst zwischen den Streitteilen ohne Beachtung der ordentlichen Formen des Verfahrens in bürgerlichen Rechtssachen Recht schafft, sei einer in der 1. C . 3 , 3 , 2 enthaltenen Konstitution Diocletians aus dem Jahre 294 zuzuschreiben, ist schon längst als falsch erkannt, denn diese Konstitution hat ihrem klaren Wortlaute nach nur das Recht der Statthalter die Streitsachen auf amtlich beauftragte Un terrichter zu delegieren mehr als früher beschränkt (2 ). Es handelt sich hier also nicht um ein Reformgesetz Diocletians von durch greifender Bedeutung, wodurch erst, wie mann es früher gewöhn lich annahm , die iudicis datio des Ordinarverfahrens, die Civilge schworenen abgeschafft und den Statthaltern gestattet worden sein soll, selbst Sachen zu entscheiden , die sie bisher an Geschworene hatten überweisen müssen . Die eben angedeutete, früher herrschende Auffassung ist weder mit dem Wortlaute der fraglichen Konstitu tion Diocletians, noch mit der Entwicklung des Staatsrechts und Gerichtsverfahrens vereinbar. Aus dem Zusammenhange und klaren ( 1) Vgl. statt aller : BETHMANN -HOLLWEG , R . Civilprozess II. S . 781-782 ; NII S. 116 ; WIEDING, Libellprosess S . 115 - 116 ; BEKKER , Aclionen II S. 224-226 ; ACCARIAS, Précis de droit romain 11%, Paris 1891, s. 779 ff. ; G . F . PUCHTA : Kursus der Institutiones 10. Nach dem Tode des Verfassers besorgt von PAUL KRÜGER Leipzig , 1893, § 182 s . 568 ; vgl. hier auch Ubbelohde bei 0 . E . HART MANN : Ueber die römische Gerichtsverfassung. Ergänzt und herausgegeben von he Geriche. Anhung xeSportliche Rech AUGUST UBBELOHDE . Göttingen 1886 . Anhang XI S. 602-605 . (2) Vgl. in diesem Sinne statt aller : RUDORFF, Römische Rechtsgeschichte II. Leipzig 1859, S . 4 Anm . 3 ; PERNICE, Festgabe für Beseler S . 77 Nr. 7 ; der selbe Amoenitates iuris III, Sav. 2 . VII (1886 ) s. 103-112; derselbe, L 'ordo ju diciorum e l' extraordinaria cognitio durante l' impero romano, Archivio Giuri dico XXXVI, Pisa 1886 p. 147 ; GIRARD , Manuel 8 p . 1140 . 358 Elemér Balogh Texte der angeführten Konstitution Diocletians, in der von der Ueber weisung von Prozessen an Geschworene durch Ausstellung einer Formel keinerlei Rede ist, die vielmehr nur von Delegationen von amtlich beauftragten Unterrichtern spricht, geht deutlich hervor, dass Diocletian vor allem der Lässigkeit der Statthalter entgegen treten wollte. Diese dürfen nicht mehr die Streitsachen an von ihnen amtlich bestellte Unterrichter beliebig überlassen ; sie sollen in der Regel selbst entscheiden. Unter allen Umständen müssen sie Prozesse über Freigeburt und Libertinität selbst verhandeln ; sonst wird ihnen gestattet, bei Ueberhäufung mit Amtsgeschäften Unter richter zu bestellen , welche Bestellung also für sie eine Erleichte rung, nicht aber eine Kompetenzschranke bedeutet . Die schon zur Zeit von D 1, 18, 8 schwerwiegenden Gründe für die Eigenkognition der Statthalter haben sich im Laufe der Zeit noch gehäuft und infolge der veränderten Verhältnisse unter Diocletian derart hervorgetreten , das Diocletian sich mit ihnen unbedingt abfinden musste. Hierzu kam noch , dass die Statthalter auf die Delegationen von amtlich beauftragten Unterrichtern damals um so leichter verzichten konnten , als ihre Geschäfte infolge der Entziehung der Militärgewalt und der Beschränkung der Ausdeh · nung der Provinzen eine Herabminderung erfuhren (1). Wie aus dem Gesagten hervorgeht, vollendete die in Rede stehende Konsti tution Diocletians durchaus nicht die Aufhebung der ordentlichen Formen des Verfahrens in bürgerlichen Rechtssachen , sie tat nicht den entscheidenden Schritt für die vollständige Beseitigung des Geschworeneninstituts , sie setzte vielmehr bereits diese Aufhebung voraus (2). Leider ist dieser Abschnitt wegen Raummangels erheb ( 1) Lactantius, De mortibus persecutorum C . 7 , 4 . (2) Unrichtig ist die Annahme von SCHULIN , nach der die fragliche Aufhe bung sogar erst durch die Konstitution von Constantius und Constans, durch die 1. C. 2 , 57 (58 ), 1 (Impp. Constantius et Constans AA. Marcellino praesidi Phoenice . Juris formulae aucupatione syllabarum insidiantes cunctorum actibus radicitus amputentur. D . X . k . Febr. Constantio III et Constante II AA . conss. a . 342) vom Jahre 342, die die Formeln beseitigte, vollständig aufgehoben worden sei (Lehrbuch der Geschichte des Römischen Rechts ( = Juristische Hand bibliothek Nr. 7 ). Stuttgart 1889 S. 592). Dieser Annahme widerspricht bereits der klare Wortlaut der Konstitution , die nicht die geringste Spur der fraglichen Aufhebung erkennen lässt. Wie aus den in Aegypten entdeckten griechischen Papyri aus römischer Zeit hervorgeht, hat die Authebung der ordentlichen For men des Verfahrens in bürgerlichen Rechtssachen die Aufhebung der schriftli. Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians 359 lich gekürzt worden . Auf die hier behandelte Frage werde ich nochmals zurückk ehren und die scharfsinnigen Ausführungen von Wlassak gehörig würdigen , als wir uns mit den verschiedenen An sichten über den wahren Inhalt der Iulian - Stelle 1. D . 1, 18, 9, von der die Callistratus- Stelle 1. D . 1, 18, 9 nur in einer etwas erweiterten Neufassung abgeschrieben worden ist, auseinandersetzen werden (1). umemelu sebi,1-1275 Papyri No chen Anweisungen der Oberbeamten an die Unterbeamten , die wie Kaiserreskripte in einer den Formeln sehr verwandten Form gefasst waren, nicht miteinbegriffen (Vgl. P . Oxy I 67 ( p. 124-127 = Neudruck : MITTEIS, Crestomathie Nr. 56 , S . 63-64 = P. M . MEYER, Juristische Papyri Nr. 87 S. 296 -298 ) aus dem Jahre 338 für einen Prozess aus der Zeit, in der das Geschworeneninstitut schon längst beseitigt war. (Vgl. dazu MITTEIS, Papyri aus Oxyrchinchos Hermes XXXIV S . 108 - 101 ; derselbe, Libellen 106 , 108 -109; derselbe, Grundzüge S . 40 , Anm . 2 ; STEINWENTER, Versäumnisverfahren S. 115 ; GIRARD , Manuels p . 1134 Anm . 2 , 1140 Anm . 1. Gegen die Verwirrung der obengenannten schiftlichen Anweisungen mit den eigentlichen Formeln des Formularprozesses vgl. PARTSCH, Schriftformel S. 65 -67 und insbesondere BOULARD, Instructions und dazu die Besprechung Koschakers, Gött. Gel. Anz. 169, 1907 S. 807-821. ( 1) Aus der einschlägigen Literatur vgl. statt aller : WLASSAK , Provinsial process, insbesondere S . 16 ff; Prozessgeselse Il S . 332 Anm . 12 ; WIEDING , Li bellprocess S. 97, 116 , 117 ; UBBELOHDE a . a . 0 . S. 521-522 Anm , 7 ; E . I. BEK KER Aktionen II S. 197 D . ff; MOMMSEN Staatsrecht II 23 S . 977 ; PERNICE, Fest gabe für Beseler S. 71 ff ; Parerga IV : Der sogenannte Realverbalcontract, Sav . Z. XIII (1892) S. 284 Anm . 2 ; KIPP, Geschichte der Quellen des römischen Rechts“, Leipzig 1919, S . 75 Text und Anm . 43 ; KÖBLER Berliner Philologische Wochen schrift XL (1920) Sp. 414 ; PARTSCH , Neue Urkunden zum justinianischen Reskriptenprozesse, Götting. Nachrichten , Phil. -hist . Kl. 1911. S . 252-253 ; BOYÉ , La Denuntiatio S . 282, 290 f, 315 . - - - --- - -- - - - RUDOLF DÜLL PRIVATDOZENT IN MUENCHEN ZUR BEDEUTUNG DER POENA CULLEI IM RÖMISCHEN STRAFRECHT Roma · II SUMMARIUM Cullei poenae executio cuius sit momenti et quid pertineant ad hoc singulare supplicium forae illae IV valde quaeritur. Qua in causa Dosithei Theophilique sententiam communiter receptam sequendum non est: errant qui putant feras illas ob naturam suam parricidae naturae similes habitas ideoque cum eo culleo inclu sas fuisse. Diversis explanationibus quae ad hoc excogitari possunt scrutatis ap parebit mere procurationis prodigii causa haec animalia adhibita fuisse : adsidue enim furiae ultrices iratique inferi parricidam persequi et agitare debent et vi perarum canis galli simiaeve figura traditio ad inferos significatur. Totum hunc ritum ab Etruscis receptum Augusti temporibus innovatum et exornatum ad fas praecipue pertinere manifestum est. IV actus in hoc ritu possunt distingui: sepa ratur parricida a patriae solo ; deinde monstri illius in cives contagium pestiferum coercetur virgis rubris sive sanguineis, quibus vim magicam inesse arbitrabantur ; deinde verbis sollemnibus parricida execratur postremoque feris istis, furarum inferorumque potestatis symbolis consociatus inferis culleo adsignatur carensque omni elementorum usu ritu solemni ad litus devectus in mare proicitur. Post haec piacula exercentur. Unicum hoc populi Romani supplicium videtur nec notum usquam apud veteres gentes orientis occidentisque neque apud Germanos nisi a Romanis receptum . Cullei poenam quae iurisconsultorum illustrium aetate in desuetudinem venerat Constantinus restituit confirmavit Justinianus. Zu den interessantesten Problemen des römischen Strafrechts gehört die poena cullei. Die mit der Säckung verbundenen solennen Akte, wie sie in der antiken Literatur überliefert sind und teil weise noch in die Gesetzgebungskodifikation Iustinians gelangten (s. D . 48, 9, 9 ; Cod. I. 9, 17, 1 ; I. 4, 18 , 6), haben in der gelehrten Welt schon oft besondere Beachtung gefunden und namentlich ist es Brunnenmeister gewesen, der auf den sakralen Hintergrund dieser Strafe mit grösster Eindringlichkeit hingewiesen hat (1). Diese Auffassung ist allgemein anerkannt (2). Das Verfahren der Säckung hat in der republikanischen Zeit, wie sich deutlich aus den Ciceronianischen Berichten (pro S. Rosc. Amer. 25 , 26 ) ergibt, überhaupt nicht pönalen Grundcharakter gehabt, sondern den der procuratio prodigii; auch in späterer Zeit ist dieser Gedanke noch lebendig. Man glaubte übrigens in Griechenland und in Rom ur sprünglich zu parricidium gesetzgeberisch überhaupt nicht Stellung (1) Die Tötungsverbrechen im altröm . Recht, 1887. (2 ) Hitzig , in PAULY-Wissowa, R . E . s . v . culleus. 364 Rudolf Düll nehmen zu müssen , da man etwas derartig Unglaubliches wie Ver wandtenmord unter Menschen gar nicht für wahrscheinlich hielt (3). Im überlieferten römischen Vollstreckungsritual offenbart sich deut lich der Gedanke der Isolierung der Mitwelt von dem portentum et monstrum , der besonders dadurch zum Ausdruck kommt, dass dem Täter Holzschuhe angelegt werden , damit er den Heimatbo den nicht entweihe (4 ). Diese Vorstellung, auf die Cicero hinweist, ist noch der Prinzipatszeit eigen . Die endgültige Exekution im cul leus geschieht zu dem Zweck, dem Täter den Gebrauch aller Ele mente und die Grabesruhe zu nehmen . Mit dem Vollzug der Säck ung war, weil es sich um einen Prodigialakt handelte, Expiation verbunden (5). Die seit den Gracchen überlieferte Uebung, in den culleus zugleich mit dem Verbrecher gewisse Tiere – zuerst wer den Schlangen genannt, in späterer Zeit noch der Hahn , der Hund und der Affe — zu stecken , wird von der herrschenden Lehre unter Bezugnahme auf Zeugnisse aus dem Altertum , namentlich Dosi theus, dahin verstanden , dass es sich um Beigabe von Tieren han delte, die ihrer Art nach dem Charakter des Täters gleich waren (6 ). Nun befriedigt der Stand der herrschenden Lehre über das Problem durchaus nicht. Die von ihr angenommene Tiersymbolik ist keineswegs überzeugend ; den römisch nationalen Vorstellungen hinsichtlich dieser Zeremonien ist viel zu wenig nachgegangen ; auch der historischen Entwicklung auf diesem Gebiet ist kaum gedacht. Andererseits ist der in D . 48 , 9, 9, pr. zu den Tierbeigaben ge nannte mos maiorum im Schrifttum stark in Frage gestellt (7). Unter weitgehendster Heranziehung antiker Quellenbelege wird es sich daher darum handeln , unbeeinflusst durch etwa vorliegende Deutungsversuche zu den verschiedenen Problemen Stellung zu nehmen, stets aber sämtliche überlieferte Solennitäten des Verfahr ens einem möglichst einheitlichen Gesichtspunkt zu unterstellen . (3) Vgl. die Stellen bei BRUNNENMEISTER a. a. 0 . 190. (4) BRUNNENMEISTER 188 ; in der Wendung bei Cic . de inv. 2, 50 , 149 : ei statim , quod effugiendi potestas non fuit, ligneae soleae... inductae sunt ist deutlich der Nebensatz, der auf die effugiendi potestas hinweist, eine Erläute rung zum « statim » . (5 ) BRUNNENMEISTER 197 n . 1. (6 ) Hitzig a. a. O .; Schrader, Corp. iur. civ., I (1832) 769 ff.; Rein , Krimi nalrecht d . Römer (1844) 457; Voigt, XII T. I, 256, BRUNNENMEISTER, 189 ff. (7) MOMMSEN, Röm . Strafrecht 922 n . 8 . Zur Bedeutung der poena cullei im römischen Strafrecht 365 Allgemeines. 1 . Uebersicht der Entwicklung. Die poena cullei lässt sich bis in die älteste Zeit hinauf ver folgen, wobei sich auch die prodigiale Natur des Aktes klar of fenbart: das monstrum , portentum soll aus dem Staat verschwinden ; diesem Zweck dient ein vornehmlich sakraler Akt. Der Staat hat die PAicht, sich von dem gefährlichen Wesen zu befreien und die erzürnten Götter in aller Form zu besänftigen . Anderenfalls ist mit einem Strafgericht der schwer gekränkten Gottheiten zu rechnen . Wir sehen schon in der Königszeit den Staat bzw . die Staatsre ligion betreffende schädigende Handlungen als Anlass zur Säckung, wozu auf Valerius Maxim . 1, 1 , 13 und Dionys. 4 , 62, 4 verwiesen sei. Ob Herkommen oder Gesetz später für parricidium die Säckungs strafe geschaffen hat, ist bestritten . Es besteht aber wohl kein ernst licher Grund , ein späteres Gesetz , welches Val. Maximus, Festus und Cicero ausdrücklich erwähnen ,mit den von Brunnenmeister (8 ) angegebenen Gründeu zu leugnen (9 ). Für verhältnismässig frühe Zeit der Republik nennt Plautus die Säckung, so in Pseud. 214 mit der scherzhaften Wendung: te ipsam culleo ego cras faciam , ut deportere in pergolam und in dem verloren gegangenen Stück Vi dularia , vgl. Fulg . serm . ant. 53: Plautus ait in Vidularia : Iube hunc insui in culleo atque in altum deportari, si vis annonam bonam . An dieser Stelle kommt deutlich wieder der Prodigialcharakter zum Ausdruck. Auch Terenz erwähnt den culleus, wie uns der Scholiast überliefert, Schol. Ter. p . 11, 15 : minatur... mittendum eum in cul leum . Nach allgemeiner Ansicht ist die Säckungsstrafe unverändert in die Sullanische Parricidalquästion übernommen worden ( 10) und unter diese Gesetzgebung fällt bekanntlich die Rede Ciceros für S . Roscius Amerinus, wo der Redner anschaulich auf den Vollzug der poena cullei am parricida hinweist (11). (8 ) a . a . 0 . 186 ff. ar die ad Hexie sich auspoles (9 ) denn Cic . de inv. 2 , 50, 149 wiederholt zwar die ad Her . I, 13, 23 ge nannte lex im Wortlaut nicht, setzt sie aber ebenfalls voraus, wie sich aus dem « legibus quae supplicio huiusmodi afficiunt et quae ad testamenti faciendi potes tatem pertinent » ergibt. (10) MOMMSEN, Strafr. 644 N . 3. ( 11) MOMMSEN, a . a . 0 . 366 Rudolf Düll Eine Aenderung im Vollzug der culleus -Strafe brachte die l. Pompeia de parricidiis, vermutlich aus dem Jahre 70 v. Chr. (12). Dieses Gesetz unterstellte das parricidium der Strafe des korne lischen Mordgesetzes (D . 48, 9, 1) und schaffte damit auch für das parricidium die Todesstrafe ab , indem es dieses Verbrechen aus dem Sakralbereich nahm und in die allgemeine humane Regelung des Strafrechts der späten Republik einstellte ( 13 ). Augustus je doch setzte die poena cullei wieder für Aszendentenmord in Kraft (14), ohne aber damit der l. Pompeia einen anderen Na men zu geben . In welcher Weise diese augusteische Aenderung erfolgte , ist nicht überliefert, ebensowenig sind wir darüber unterrichtet, ob in diesen Aenderungsbestimmungen etwas über die Tierbeigaben enthalten war, denn die Bemerkung des Do sitheus (Hadr. sent. 3, 16 : ÉyÉveto vonog tis...) schafft keine Klar heit darüber, welches Gesetz er im Auge hat. Hitzig nimmt für das Wiederauftauchen der alten culleus- Strafe als mitbestim mend an , dass sich diese Strafe im Hausgericht erhalten habe ( 15 ). Jedenfalls ist für die Zeit des älteren Seneca berichtet, dass hier der carnifex die culleus- Strafe wieder zur Vollstreckung brachte (Sen . controv. 7 , 2 , 17, 3 : si damnatus esses, carnifex te culleo tum insuisset) und Sueton (Aug . 33 ) erwähnt die culleus - Strafe bereits mit Rücksicht auf Judikationsakte des Augustus. Nach D . 48 , 9 , 9 liess Hadrian die culleus- Strafe mit der Kriminalstrafe des bestiis obicere alternieren und in der Folgezeit kam die Säckung unter den klassischen Juristen gänzlich ausser Uebung, vgl. Paul. sent. 5 , 24 : antea insuti culleo in mare praecipitabantur , hodie tamen vivi exur untur vel ad bestias dantur. Konstantin jedoch stellte die alte poena cullei wieder her (Cod. Th . 9, 15 , 1) und diese Bestimmung blieb unter den Byzantinern in Geltung (Cod . Iust. 9 , 17, 1 ; I. 4 , 18, 6 ). Die christlich gewordene Welt sah indes, wie sich deutlich zeigen wird, die Strafe nicht mehr unter ihrem spezifisch histori schen Gesichtspunkt an . Der alte Prodigialcharakter der Entsteh ungszeit wurde später nicht mehr verstanden, sogar umgedeutet, und wesentliche Teile des alten Rituals gerieten in Vergessenheit. (12 ) MOMMSEN , 644 n . 2. (13 ) v . Hippel, Deutsches Stafr . I (1925 ) 62 ff. ; v. BAR, Gesch . d . deutsch , Strafr. ( 1882) 23 ff. (14 ) Mommsen, a. a . 0 . 645 . (15) Pauly-Wissowa, R . E . a .a. 0 . Zur Bedeutung der poena cullei im römischen Strafrecht 367 2 . Das Alter der Tierbeigaben . Wir dürfen als sicher annehmen, dass die Tierbeigaben bei der poena cullei als Regelerscheinung erst in der Prinzipatszeit einsetzen . Der erste Bericht über Tierbeigaben in den culleus betrifft die Zeit der Gracchischen Unruhen und findet sich bei Plutarch, Tib . Gr. 20 . Es handelte sich um ein Perduellions -bzw . Majestätsver brechen dieser Zeit, keineswegs um parricidium , wobei erwähnt ist, dass gegen einen gewissen Gaius Villius die Säckung vorgenommen wurde εις αγγείον καθείρξαντες και συνεμβαλόντες έχιδνας και δράκοντας. In den oben bereits genannten Ueberlieferungen der poena cullei bei Val. Maximus und Dionysius geschieht die Säckung ohne Tier beigaben, ebenso bei Plautus und Terenz. Gerade letztere Schrift steller hätten es sich sicher nicht entgehen lassen , über derlei Ge bräuche sich zu verbreiten , zumal gar dann, wenn der Affe, den die Lustspieldichter sonst gerne in ihren Stücken erwähnen (z . B . Plaut. Merc. 233, Mil. 162, 172 , Rud . 771), schon dabei eine Rolle gespielt hätte . Diese Erscheinung im Bericht des Plutarch , die sich gar nicht auf den parricida erstreckte, muss aber eine Besonder heit gewesen sein ; denn sie hat nicht dazu geführt, in der sulla nischen Parricidalquästion eine Rolle zu spielen . In dem in diese Periode fallenden Prozess gegen S . Roscius Amerinus erwähnt Ci cero nicht ein einziges Mal Tierbeigaben , nicht einmal Schlangen . Daraus kann wohl, übereinstimmend mit Brunnenmeister (16 ) ge schlossen werden, dass Cicero dieser Gebrauch noch fremd war, denn er hätte sich ein solches Moment zu dem Zweck, die Lage seines Klienten möglichst grausig zu schildern, schwerlich entgehen lassen ; Cicero bemerkt dazu ja noch , dass man es vermieden habe, den Täter eines solchen scelus nefarium selbst mit wilden Tieren in Berührung zu bringen, sodass die gedankliche Verbindung un bedingt gegeben gewesen wäre : (pro Rosc. Am . 26 , 71 : ...maiores... noluerunt feris corpus obicere, ne bestiis quoque, quae tantum scelus attigissent, immanioribus uteremur); auch de inv. 2, 50, 158 und ad Her. 1, 13, 23 findet sich nicht eine einzige Andeutung in dieser Richtung, obwohl sonst verschiedene Gebräuche der Säckung dar gestellt werden ; auch in späteren Werken Ciceros (vgl. ep. ad Quintum fr . 1 , 2 , 2 ) ist nicht der mindeste Hinweis auf eine Säck ung mit Tierbeigaben . Im ( 16 ) a . a . 0 . 188. übrigen können , da das Pompeische 368 Rudolf Düll Gesetz die Säckungsstrafe aufhob und die Strafe des Cornelischen Gesetzes anordnete, die Tierbeigaben nicht auf das Pompeische Gesetz, wie Brunnenmeister (17) und Voigt (18 ) annehmen , zurück geführt werden , zumal die in I. 4, 18 , 6 gebrauchte Wendung der 'nova poena ' ebenso wie die gleichbedeutende Version bei Theophilus keineswegs hinsichtlich der Tierbeigaben zwingend ist. Als unter Augustus die culleus-Strafe wieder bei Aszendenten mord vollzogen wurde, scheint nun auch die von der Gracchenzeit her in Erinnerung gebliebene Beigabe von serpentes , viperae in den culleus langsam wieder in Uebung gekommen zu sein . Solche ser pentes werden uns für die Zeit des Tiberius und der folgenden Kaiser von den beiden Seneca überliefert (19), ferner von Ps. Quintilian, decl. 17, 9 : culleo serpentibus expianda feritas. Das nächste Tier, von dessen Verwendung wir erfahren , ist der Affe (simia). Ueber ihn berichtet Juvenal an zwei Stellen (sat. 8 , 213 und 13, 156 ): an erster Stelle nennt er ihn neben der Schlange (serpens), an zweiter Stelle für sich allein . Die weiteren zwei Tiere, der Hahn und der Hund werden erst in der nachhadrianischen Zeit von Dositheus, zusammen mit der Schlange und dem Affen erwähnt (Dosith., Hadr. sent. 3, 16 : metà èxidvns vai niðńkov vai aléktogos kai xvvos) d . i. etwa in der Zeit um 207 n . Chr. (20); die gleichen vier Tiere in der Reihenfolge Schlange - Hund -Hahn -Affe bringen Modestin in D . 48, 9, 9 pr. und die Konstitution Konstantins in Cod. Iust. 9, 17, 1, sowie I. 4, 18 , 6 , während Cod . Th . 9 , 15, 1 lediglich die serpentes, a potiori, nennt. Aus dieser Uebersicht – die späteren Hinweise aus der christ lichen Zeit, welche dazwischen nicht sämtliche vier Tiere nen nen (21), interessieren hier nicht weiter – darf wohl angenommen werden , dass die Tierbeigaben im Verfahren gegen den parricida erst mit dem Prinzipat auftreten, nach kurzer Lebensdauer zur Zeit (17) a . a . 0 . 188, 189. (18 ) a . a . 0 . 256 n . 34 . (19) MOMMSEN, Stafr . 922 n . 8 . (20) GOETz, in Pauly-Wissowa R . E . s. v. Dositheus. (21) SCHRAEDER, a . a . 0 . 769, MOMMSEN, a . a . O . 922 n . 8 . Entgegen MOMMSEN ist hier übrigens zu Isid . orig . 5 , 27 , 36 festzustellen , dass sämtliche Tiere ausser dem Hund aufgefübrt sind . Zur Bedeutung der poena cullei im römischen Strafrecht 369 der klassischen Iuriston mit der poena cullei verschwinden und erst in der konstantinischen Aera wieder in Uebung kommen . 3. Das Alter des übrigen Ritualverfahrens. Ueber das sonstige Ritual der poena cullei sind uns folgende Besonderheiten überliefert: a) Der Isolierungsakt durch Anlegen der soleae ligneae und das Verhüllen des Hauptes des Täters ( caput obnubere folliculo lu pino); auf diese Förmlichkeiten verweisen uns Cicero ad Her. 1 , 13, 23 und de. inv. 2, 50, 148, sowie Festus p . 170. Diese Zero monien scheinen schon alter Zeit zu entstammen , denn Festus be ruft sich auf die antiqui. Von späteren Schriftstellern wird dieser Brauch nicht mehr erwähnt, woraus aber keineswegs geschlossen werden darf, dass er im Prinzipat nicht mehr zum Leben erweckt worden sei ; dies deutet Seneca, exc. contr. 3 , 2 frvielmehr an : me aio a parricida separetis, parricidam non accuso , sed fugio. b) Die Geisselung “ virgis sanguineis " überliefern D . 48 , 9, 9 pr. Damit ist über das Alter dieser Uebung freilich nichts ge sagt. Verhältnismässig einfach wäre die Beantwortung der Frage, wenn es sich hier um die allgemein übliche Geisselung anlässlich des Vollzugs der poena capitis handeln würde, denn das virgis cae dere, verberare wird in Verbindung mit der Kapitalstrafe schon für die älteste Zeit genannt (vgl. z . B . Livius 2, 5 ; 8 , 7, 19 u . a . m .) (22). Wenn es sich nun auch bei der Säckung um keine sollemnis poena handelt, sondern um procuratio prodigii, oder, wie es bei Cicero pro S . Rosc . Amer. 25 , 69 heisst, um ein “ singulare supplicium in impios " , welcher Besonderheit die unten noch näher zu erörternden virgae sanguineae entsprechen , so können keine Bedenken bestehen, auch diese Prozedur in sehr alte Zeit zu verlegen . Dafür spricht besonders auch die unten noch zu klärende kultische Bedeutung dieses Aktes. c) Die Verbringung des culleo insutus zum Gestade mit einem von zwei schwarzen Rindern bespannten Wagen. Auch das Alter dieses Rituals ist unsicher. Seine Erwähnung begegnet allein bei Dositheus (Hadr. sent. 3 , 16 : eis äražav egevyuěvn μελανών βοών κατενεχθήναι προς θάλασσαν και εις βυθονα βληθήναι). Hat man auch Dositheus etwa in die Zeit kurz nach Hadrian zu setzen , (22) vgl. MOMMSEN, Strafr . 42 n . 1 ; 47 ; 918 n . 2, 920 u . ö. ; BRUNNEN MEISTER , a . a. 0 . 188 1 . 7. 370 Rudolf Düll so schliesst dies nicht aus, dass damit eine Uebung frühester Zeit in Betracht kommt. Den Bericht des Dositheus, der hier eine Tat sache bekundet, hält Brunnenmeister für apokryph (23), während ihn Mommsen als echt zu übernehmen scheint (24 ). Wie sich später zeigen wird, sprechen alle Umstände dafür, diesen Bericht als echt aufzufassen , weil das Ritual in das überlieferte Gesamtbild voll und ganz passt. Die Tatsache, dass Plautus und Cicero, überhaupt rö mische Schriftsteller niemals darüber eine Andeutung machen , kann nichts gegen die tatsächliche Fundierung des Dositheischen Be richts beweisen ( 25 ). Anzunehmen ist daher, dass der symbolische Isolierungsakt und der Verhüllungsakt des Rituals jedenfalls schon der älteren Zeit angehören ; das Bestreichen mit den virgae sanguineae und der so lenne Beförderungsakt zum Wasser kann ebenfalls schon alter Zeit angehören, doch ist es auch möglich, dass diese Formalien erst mit der Einführung der Tierbeigaben in das Verfahren gekommen sind. Aus diesem kurz geschilderten Ritual kann man bereits klar ersehen , dass der Grundcharakter der ganzen Prozedur niemals eine sollemnis poena gewesen sein kann , dass vielmehr, entsprechend den Ueberlieferungen, ein sakraler Prodigialakt vorliegt. Auf diese Natur weisen auch die juristischen Ueberlieferungen hin , wenn in Cod . Th. 9, 15 , 1; Cod . Iust. 9 , 17, 1 und I. 4 , 18, 6 , die stereo type Wendung auftritt : lege Pompeia de parricidiis... neque ulla sol lemni poena subiectus, sed insutus... in mare proiciatur. Die Bedeutung der Tierbeigaben . Die Bedeutung der Tierbeigaben ist eines der wichtigsten Pro bleme des ganzen Verfahrens. Es ist bereits dargetan, dass die Tierbeigaben beim parricidium erst seit dem Prinzipat sicher über liefert sind. Wenn man nun gänzlich unbeeinflusst an die Beant wortung der Frage, was mit den Tierbeigaben denn eigentlich (23 ) a. a. 0 . 188 n . 4 . ( 24 ) Strafr . 922 n . 9 . (25 ) der bei Cicero ad Her . 1, 13 zitierte Gesetzestext « devehatur in profluentem » scheint vielmehr eben den Beförderungsakt anzudeuten . Zur Bedeutung der poena cullei im römischen Strafrecht 371 beabsichtigt war, herantritt, so kann hier an eine stattliche Reibe plausibler Deutungen gedacht werden, für welche da und dort be achtliche Gründe ins Feld geführt werden können. Diese Möglich keiten müssen an der Hand der Ueberlieferungen sorgfältig ge prüft werden , sodass sich dem Kernpunkt der Sache immer näher kommen lässt. Dabei wird es sich gleich zeigen, dass gerade der von der herrschenden Lehre angenommenen Erklärung, es handle sich um symbolische Tiere, deren Art der Natur des Verbrechers ähnlich sei, gewichtige Einwendungen entgegengesetzt werden müssen . 1. Die erste Erklärungsmöglichkeit ist die, dass irgendwelche antike Gedankengänge des mythischen Symbolismus das Opfer der Exekution zu seinesgleichen gesellen wollen und dass die vier At tribute gewissermassen Zerrbilder von Lebewesen darstellen, die dem parricida aus Symmetrie beigegeben werden. Dies ist die herr schende Ansicht ( 26 ) und sie kann auch antike Belege für sich in Anspruch nehmen oder sie scheint es wenigstens zu können . Auf diese Gedankengänge kann einmal die Darstellung bei Cicero pro Rosc. Am . 22, 63 hinweisen, dass es sich um ein Verfahren gegen ein portentum atque monstrum handle, das durch die Ungeheuer lichkeit seines Tuns noch die Tiere übertroffen habe (immanitate bestias vicerit). Ferner sind es gewisse Ueberlieferungen bei Dosi theus und bei Theophilus, welche diesen Gedanken in den Vor dergrund stellen . Wir lesen bei Dositheus (Hadr. sent. 3, 16 ): ... μετά έχιδνης και πιθήκου και αλέκτορος και κυνός ασεβών ξώων ασεβής άν 990nos und in der Paraphrase des Theophilus zu I. 4 , 18, 6 wird erlantert: τα δε προειρημένα θηρία εμβάλλεται διά τούτο, επειδή ομοιότροπα αυτώ εστίν. Τα μεν γάρ αναιρεί τους γονείς, τα δε της προς αυτούς ουκ απέ. metai uaxns ( 26 a ). Schrader versäumt, entsprechend diesen Belegen, nicht, aus der antiken Literatur Nachweise zusammenzustellen, aus welchen sich ergibt, dass Schlangen als verabscheute Tiere, welchen parri cidium in der eigenen Art nachgesagt wird , betrachtet wurden (27), (26 ) Schrader, a. a . 0 . 764 ff. ; Rein , a . a. 0 . 457 ff.; BRUNNENMEISTER, a . a . 0 . 188 ; Hitziz , a. a . 0 . (26 a ) FERRINI, ( Theophil. Instit. Graeca paraphrasis II, 493) übersetzt : « ferae... ideo cum eo insuuntur, quia similes ei sunt, quarum una parentes suos devorat, ceterae a pugna cum iisdem non abhorrent » . (27 ) a. a . 0 . 769 ff. 372 Rudolf Düll dass der gallus im gleichen Ruf stand (28 ), dass der Hund als ein ganz verachtetes Tier angesehen wurde und dass der Affe sich der gleich geringen Beliebtheit erfreut habe. Man kann jedoch hier eine Reihe von Bedenken nicht unterdrücken . Diese Bedenken stützen sich einmal auf die Unzulänglichkeit dieser Tiersymbolik als solchen , dann auf die Frage der historisch exakt zu wertenden Zuverlässigkeit des Berichtes der antiken Autoren und endlich auf die grundsätzliche Stellung einer in diesem Sinn zu deutenden Symbolik in einem Prodigialverfahren. Was die Tiersymbolik anlangt, so muss zunächst bemerktwer den, dass die Tiere, für welche der Vergleich mit dem parricida im Altertum allein überliefert ist, lediglich Schlange und Hahn sind , keineswegs die anderen ; und was die Berichte über Schlange und Hahn anlangt, so handelt es sich allein um Zeugnisse aus griechischem Mythus, dazu noch um vereinzelte. Der Bericht des Aristoteles ist lediglich naturwissenschaftlich zu werten ; Herodot, Aeschylos und Aristophanes betreffen gelegentliche Aussprüche ; römische nichtchristliche Schrifteller, die Schlange und Hahn mit dem parricida konfundieren, hat Schrader überhaupt nicht beige bracht. Dass aber Schlangen als solche in Rom zu den verachteten Tieren gehört hätten, trifft gar nicht zu. Die Schlange wird viel mehr als beliebtes Haustier genannt, das kultische Bedeutung hatte, so besonders im Manen - und Genienkult (29). Die Schlange war fer ner der römischen Gottheit Fauna oder Bona Dea heilig (30) : in der Nähe des Tempels dieser Göttin am Aventin wurden Schlangen gehalten (31); auch Mercurius erscheint in der römischen My thologie dazwischen (32) in der Rolle des griechischen Hermes als Seelenführer mit dem Attribut der heiligen Schlange (33) und end lich sind die Schlangen mit dem in Rom eingedrungenen Asklepios kult als heilige Tiere besonders im Tempel dieses Gottes auf der Tiberinsel verehrt worden (34 ). (28) SCHRADER , a . a . 0 . 769. (29 ) Wissowa, Religion und Kultus der Römer, 2 , 176 . (30 ) Wissowa, a . a . 0 . 219. (31) (32) (33) (34 ) Wissowa, a , a . 0 . 217 . Wissowa, a . a . 0 . 306 . THRAEMER in Pauly.Wissowa R . E . s. v . Asklepios . Wissowa, a. a . 0. 307, 308. Zur Bedeutung der poena cullei im römischen Strafrecht 373 Was den Hahn betrifft, so sehen wir den Gedanken der von Schrader angeführten griechischen Quellen für Rom durchaus nicht eingebürgert ; im übrigen hat Schrader die griechischen Ueberliefer ungen schon zu einseitig gesehen . Plinius n . h . 10, 21 stimmt als Römer das Lob des Hahnes an und bemerkt ausdrücklich , dass es sich beim gallus um ein Tier handle, welches den Gottheiten wohl gefällig sei (dis grati). Sakrale Vorstellungen mit dem Hahn kennt nun bereits Griechenland : als dem Asklepios angenehmes Tier ha ben ihn Genesende dem Gott zum Dank dargebracht, was uns Platon , Phaid . 118 aus den Worten des sterbenden Sokrates über liefert : • Koitov, špn, TQ 'Aokanniq Opeiouev åłextovova ; übereinstim mend Tertull. anim . 1, p . 300, 4 : Aesculapio gallinaceum reddi (35 ). Auch bezüglich des Hundes sieht Schrader einseitig. Seine diesbezügliche Ausbeute aus der klassischen Zeit ist gering; jene aus der christlichen Periode jedoch für unsere Frage völlig wertlos. Schrader führt u . a . ( 36 ) die tadelnde Stelle bei Homer Il. 1 , 225 an, übersieht aber die bekannte gegenteilige in Od. 17, 291 ff. Die weiteren von ihm zu Vergil, Horaz und Plinius herangezogenen Stellen betreffen keinesfalls die regelmässige Einstellung des Rö mers zum Hund. Die von Schrader angeführte Plutarchstelle (qu . Rom . 111) weist auf den Hund als Opfertier. Gegen die Annahme, der Hund sei allgemein in Rom als verachtetes Tier angesehen worden , sprechen z. B . deutlich : Plinius, n . h . 8, 40: canis fidelissimus ante omnia homini (mit näheren Ausführungen über seine vorbildliche Treue). Ovid. fast. 5 , 137 : canis... ante pedes stabat... Quae standi cum Lare causa fuit ? Servat uterque domum domino quoque fidus uterque. Ovid . fast. 4, 763 : ...valeant homines gregesque et valeant vigi. les, provida turba, canes. Der Hund war in Rom grundsätzlich zweifellos ein geschätztes Tier. Er diente aber auch als Opfertier und spielte bei den Lu perkalien eine wichtige Rolle. Er war dem Faunus heilig (37) und wird als Opfertier beim Sühneopfer im Kult des Faunus anlässlich der Lustration (38 ) und im Kult der Genita Mana regelmässig er (35) vgl. Thes. l. Lat. s . v. (36 ) a . a . 0 . 769 . (37) Wissowa, a . a . 0 . 214 . (38 ) Wissowa, 210. 374 Rudolf Düll wähnt (39). Ferner gedenkt Plutarch (qu. Rom . 111) griechischer Hundeopfer im Hekatekult (40) und zwar zum Zweck der Abwehr von Unheil (αποτροπαίων) und als Sühne und Reinigung ( καθαρσίων), desgleichen bei den römischen Luperkalien (Avkainis): ¿ v To naðapoio μηνί κύνα θύουσιν. Was den Affen anlangt, so schien Schrader von seinen gefun denen Literaturbelegen selbst nicht ganz befriedigt gewesen zu sein . Er kann wohl einzelne Stellen, die den Affen gerade nicht mit Lobsprüchen überschütten , heranziehen (41), doch will die Ver bindung mit dem parricida nicht recht glücken. Ein besonderes, von Schrader nicht erwähntes Moment, nämlich die von Plinius n . h . 8, 54 bezeugte Liebe der Affen zu ihrer Art, ist für die Symbolik übrigens nicht förderlich. Auch hier können natürlich Zeugnisse aus christlicher Zeit, die den Affen als Zerrbild des Menschen in den Vordergrund stellen , nichts beweisen. Was gerade den Affen im Ritual der Parricidalstrafe anlangt, so ist noch besonders zu beachten , dass seine Erwähnung erst seit Juvenal erfolgt (42) und zwar mit Bezug auf Aegypten, wo dieser Dichter am oberen Nil im heutigen Assuan ein Militäramt bekleidete. Wie stand es aber grundsätzlich im heidnischen Aegypten mit dem Affen ? Er galt bei den tierliebenden Aegyptern als ein sehr beliebtes und ge schätztes Tier (43 ) ; ferner wissen wir , dass Affen (niðnkos), be sonders der hundsköpfige (KVVOKÉqałos) noch im römischen Aegyp ten heilige Tiere waren (Lukian , Jup. trag. 42 : JeoS... äåñois KUVOKÉ palos )... Tionuos); besonders der Anubis -Gottheit bzw . dem Thuti, dem ägyptischen Hermes, war der hundsköpfige Affe heilig (Lu kian , Tox. 28 : és tò 'Avovßidelov... HVvOnepálovs åpyvgous ; Minuc. Fe lix, Oct. 22 : Isis... filium cum Cynocephalo suo... luget) (44 ); dazu kommt, dass die Tötung von Affen, die göttliche Verehrung ge nossen , in Aegypten unter schwerste Strafen gestellt war : Rufin . (39) Wissowa, 240 . (40 ) SCHRADER . a . a . 0 . 769 . (41) a . a . 0 . 770 . (42) MOMMSEN, Strafr . 922 n . 8. (43) ERMAN -RANKE, Aegypten und aegypt. Leben (1923) 229, 275 ff. ; zum altägypt. Tierkult allgemein vgl. auch MITTEIS-WILCKEN, Chrestomathie d . Pap. Kunde I, 1 105 ff (44 ) vgl. auch Göli, Ill. Mythologie ( 1896 ) 286 , 290. Zur Bedeutung der poena cullei im römischen Strafrecht 375 hist. mon . 148 C . : canes... et simias atque alia portenta venerati sunt (Aegyptii) ; Minuc. Felix, Oct. 28 : (Aegyptiorum sacra)... nonne dam natis instituta serpentibus, crocodillis, beluis ceteris... quorum aliquem si quis occiderit etiam capite punitur ? Neben diesen Einwänden gegen die Schrader'sche Auffassnng der Tiersymbolik ist aber auch gegen die historische Wertung der Berichte des Dositheus und des Theophilus kritisch Stellung zu nehmen . Was Dositheus anlangt, so wird man die Entstehung seiner Schrift über Hadrian etwa in die Zeit des Septimius Severus und der klassischen Juristen nicht unter dem Eindruck würdigkeiten über Hadrian antiken Göttern die Rede ; setzen dürfen (45 ) . Die Schrift stehtnoch christlicher Gedanken ; in seinen Denk ist des öfteren von Hercules und den dann aber enthält sie die griechisch philosophischen Hauptgrundsätze über Strafen und Strafzweck, denn anschliessend an die Erwähnung der poena cullei erfolgt deren Be gründung als « υπόδειγμα τιμωρίας ένα μαλλον φοβηθώσιν ούτως ανόσιον noiñoain, also das Voranstellen der Abschreckung, die als Zweck dieser Strafe hingestellt wird. Damit ist aber gerade nicht der hi storische Ausgangspunkt, der im römischen Sakralrecht liegt, ge würdigt, nicht der Gesichtspunkt der procuratio prodigii (46), son dern eine spätere, zur Zeit des Schriftstellers erst aufgekommene Auffassung. Für diese seine Beurteilung kann freilich der Autor gewissermassen mildernde Umstände beanspruchen : er steht auf dem Boden der griechisch - römischen Ethik der Stoa und ihrer Beurteilung des Verbrechens (47) ; von der Vergeltungsidee ist man zum Abschreckungsprinzip immer mehr übergegangen und Seneca hat dieses deutlich für Rom übernommen (de ira 1, 16 ) : nemo pru dens punit quia peccatum est, sed ne peccetur, oder nat. qu. 2 , 42, 3 : ad conterrendos, quibus innocentia sine metu non placet... posuerunt vindicem et quidem armatum . Diese Gedanken werden von den rö mischen Juristen übernommen , vgl. D . 48, 19, 6 , 1 (Ulpian ) : ...ut exemplo deterriti minus delinquant. So erscheint die Heranziehung dieses Gedankens für die Auffassung des Dositheus aus seiner Zeit heraus begreiflich , historisch ist sie , wie dargetan , keineswegs zu (45) Goetz in Pauly-Wissowa, R . E . s. v . (46 ) BRUNNENMEISTER , a . a . 0 . 185 ff., 191 ff. 197. (47) s . v. Bar , Gesch. d. deutsch. Strafr. 208 ff., 211 ; v . HIPPEL, Deutsch . Strafr . I, 464 ff. 376 Rudolf Düll würdigen . Dazu kommt ferner, dass es ja Hadrian gewesen ist, der die Parricidalstrafe des Säckens ihres bis dahin beibehaltenen Pro digialcharakters entkleidet hat, denn er bestimmte ( D . 48 , 9, 9 pr.) dass sie durch eine rein kriminelle Strafe, nämlich das “ obicere bestiis ” ersetzt werden könne und zur Zeit des Juristen Paulus ist Feuertod zusammen mit dem « obicere bestiis " die regelmässige Strafe (Paul, sent. 5 , 24 ). Ein nichtjuristischer griechischer Schriftsteller , wie es Dosi theus war, der noch dazıı die römischen Rechtsinstitute wohl nur aus der Ferne kannte und jedenfalls nicht von der historischen Seite urteilen wollte, ist daher schon a priori für historische Be weisführungen mit grösster Vorsicht aufzunehmen. Wenn nun Do sitheus die sog. Tiersymbolik mit den Worten erklärt: åoepns äv JQWnos uerà ảoeßāv goov, so liegt von vorneherein die Wahrschein lichkeit auf der Hand , dass er damit den Deterritionsgedanken fortsetzen will. Denn diese Auffassung passte ihm in seine mora listischen Ausführungen ; er wollte als Ethiker seinen Lesern gute Ratschläge geben, predigt das xałos gîv, yoveis typov, pilovs qihelv , Eixonotov elva. (3 , 17) und beginnt seine Darstellung mit der ziem lich bescheidenen Einführung: 1056ueva ÉQUEVEVELV Kay’ds duvápeda didKOkeiv válkiota (3 , 1). Es ist also die grösste Wahrscheinlichkeit dafür gegeben, dass Dositheus unter dem Bann des Abschreckungs zwecks der Kriminalstrafe steht und unter diesem Gesichtswinkel als Moralphilosoph die ihm wesensfremde römische poena cullei ansieht. Seine Erklärung sowohl über den Zweck dieser Strafe als über die Bedeutung der dabei verwendeten Tiere hat von vornhe rein den Stempel des Unhistorischen an sich . Nun sehen wir, dass später Konstantin die alte Vorstellung der poena parricidii als Prodigialakt wieder in den Vordergrund rückte , indem er in Cod. Th . 9 , 15 , 1, Cod . Iust. 9 , 17, 1 das iso lierende Sakralritual unterstrich . Dass in der Justinianisch - christ lichen Zeit jedoch das Verständnis altrömisch - heidnischen Kult wesens nach Jahrhunderten christlicher Vorstellungen noch eine Rolle spielen konnte , dafür bestanden keine Vorbedingungen . So erklärt sich wohl auch ohne weiteres, dass die Dositheische An sicht ohne nähere Prüfung übernommen wurde, um so leichter, als in der Zwischenzeit verschiedenes in der Tiersymbolik in ähnlichem Sinn von christlicher Seite gedeutet werden konnte. So überrascht es gerade nicht, dass Theophilus in der Institutionenparaphrase die Zur Bedeutung der poena cullei im römischen Strafrecht 377 Dositheische Ansicht wiedergibt, zugleich aber dieselbe noch mehr ins Unwahrscheinliche zieht. Wenn nämlich Theophilus mit Bezug auf die vier Tiere ausführt: Tà uėv yàg ávalget tous yoveīs, tà di ris Froos avtous oºk åNÉMETAL páxns, so kann er mit der ersten Gruppe noch auf den in der griechischen Literatur dazwischen vertretenen Mythus mit anspielen , der Schlange und Hahn mit dem Bild des parricida tatsächlich in Verbindung bringt (48 ), und der in der griechischen Reichshälfte unter christlich verwandten Gedanken gängen lebendig geblieben sein mochte; die Erklärung jedoch, dass sich die beiden anderen Tiere des Kampfes gegen die Aszendenz nicht enthielten , womit Hund und Affe gemeint sind, erscheint gänzlich willkürlich und dazu farblos, weil sie für jede beliebige andere Tiergattung passen würde. Nehmen wir aber einmal an, die Erklärung des Dositheus und die noch fragwürdigere des Theophi lus gingen in Ordnung. Es läge also symbolische Bedeutung in dem Sinn, dass Schlange und Hahn den Parricidalcharakter, Hund und Affe ein Merkmal ähnlicher Art zum Ausdruck brächten, vor. Wie erklärt es sich dann aber, dass die erstmalige Erwähnung von Tierbeigaben in Rom mit der Säckungsstrafe gerade ein Nichtpar ricidium betrifft (Plut. Tib . Gr. 20) und wie erklärt es sich wei terhin , dass wir gerade in Aegypten den Affen beigegeben sehen , und zwar ganz für sich allein (Juvenal, sat. 13, 156 ), wobei wir ja von Aegypten wissen , dass dort der Affe ein beliebtes und sogar heiliges Tier war ? Sollten da die Römer ihren angeblichen Wider willen gegen dieses Tier unverhüllt gezeigt haben , den religiösen Gefühlen der Bewohner zum Trotz und ihre Erbitterung heraus fordernd ? Und wie erklärt es sich, dass Juvenal an der angegebe nen Stelle den bei der Prozedur verwendeten Affen als “ innoxia simia " anspricht ? Verträgt sich das mit der Dositheischen Dar stellung, dass ein Tier verwendet wird , das verachtet und todes würdig war, in dem man dieselben Eigenschaften sah , wie in dem parricida selbst? (49). Alle diese Momente lassen uns die Dositheisch - Theophilische Erklärung der sog. Tiersymbolik von der historischen Seite her (48) SCHRADER, a . a . 0 . 769, 770. (49) über die gelegentlich überlieferte Tötungsdrohung der Priesterschaft gegen heilige Tiere in Aegypten, wenn sich die Gottheit nicht gnädig erweist, vgl. MITTEI .WILCKEN, Chrestomathie d . Pap. Kunde I, 1, 125. Roma · II 25 378 Rudolf Düll mit grösstem Vorbehalt entgegennehmen . Nun sprechen aber noch Gesichtspunkte ganz allgemeiner Art gewichtig gegen die darge legte Deutung. Legt man den Tieren ihnen selbst zukommende symbolische Deutung bei, so gelangt ein einem Prodigialakt fremdes Element in das ganze Verfahren . Wir sehen nun aber deutlich, dass der Gedanke, dass es sich bei der poena cullei gerade nicht um eine sollemnis poena handelt, noch in der Konstitution Kon stantins (Cod . Th. 9, 15 , 1) sehr lebendig ist, in einer Zeit also , wo die Tierbeigaben in Uebung sind. Mit diesen Tierbeigaben kann jedenfalls dann, wenn sie symbolisch nichts als eine Verdeutlich ung der Verbrechereigenschaften bezwecken sollen , ein sakral kultischer Zweck nicht gegeben sein . Die Beigabe der verhass ten Tiere wäre als Kundgebung an den Täter bzw . als Mani festation an die Bürgerschaft im Sinn der Deterrition zu werten . Auch hier stehen erhebliche Bedenken gegen diese Annahme: Die Tierbeigaben werden erstmals in der Gracchenzeit genannt; nun ist es bekannte Tatsache, dass gerade in diese Zeit das Eindringen griechischer Vorstellungen in den römischen Strafprozess fällt, das eine Humanisierung im Lauf der Quaestionen gebracht hat (50 ). Passt nun in eine solche Entwicklungsperiode der Gedanke, dem Verbrecher, den man bisher culleo beseitigte , nun noch Tiere in den culleus mitzugeben, mit welchen man jetzt dokumentieren will, dass man ihn gleich verachtenswert halte wie die mit eingeschlos senen Tiere, wo man ihm bisher dergleichen weitere Demütigung zugleich mit der Abhaltung nicht gerade angenehmer Gesellschaft fernhielt? Alle diese Momente zusammengenommen müssen dazu führen , die Tiersymbolik im Sinn der herrschenden Lehre abzulehnen und namentlich der Dositheisch - Theophilischen Deutung jene Interpre tation zu versagen, dass die Tiere ihrer Gleichartigkeit mit dem parricida wegen im Verfahren Verwendung fänden . Dass trotzdem dem antiken Bericht ein relativer historischer Wert zukommt, wird sich im weiteren Verlauf der Darstellung zeigen . 2 . Man könnte weiterhin daran denken , dass die Tiere dem Täter beigegeben werden um ihn zu quälen. Dies würde ohne wei teres auf die Beigabe der Schlangen (serpentes, viperae) passen . Solche werden in der Plutarchstelle ( Tib . Gr. 20) in der Mehrzahl (50 ) v. Bar, a. a. 0 . 23 ff. Zur Bedeutung der poena cullei im römischen Strafrecht 379 genannt und scheinen auch später in der Mehrzahl dem parricida beigegeben worden zu sein ; Ps. Quintilian decl. 17, 9 : culleo ser pentibus expianda feritas; Sen. contr. 7 , 1 , 23: culleum serpentes... parricidae instrumenta . Dass die Tierbeigaben dem genannten Zweck bestimmt waren , ist aber unwahrscheinlich aus der Natur des P10 digialaktes, denn der Hauptzweck des Verfahrens ist die Beseiti gung des Täters, der den Göttern verhasst ist und dessen Belas sung im Land diesem Fluch und Unheil bringen würde (51) ; hier wäre die Beigabe einer den Täter bis zu seinem Tod quälenden Bestie aus diesem Grundcharakter des Verfahrens systemwidrig . Dazu kommt aber, dass die weiter genannten Tiere diese Eigen schaft, den Täter ernstlich zu quälen , in viel geringerem Mass oder gar nicht haben, so kaum der Hund und der Affe , ganz und gar aber nicht der Hahn. Wir finden andererseits freilich literarische Quellen , wo drei der Tiere als bissig genannt sind (vgl. Scrib . Largus 173 : morsum a rabioso cane vel a serpente ; Celsus 5 , 27, 1 : morsus... interdum simiae saepe canis nonnumquam ferorum anima lium aut serpentium ). Demgegenüber muss darauf verwiesen werden dass der Hahn als quälendes Tier jedenfalls keine Rolle spielen kann, ferner darauf, dass Juvenal sat. 13, 156 die Säckung in Ae gypten , obwohl dort kein Mangel an Schlangen ist und diese bei der Säckung auch dazwischen genannt werden (sat. 8 , 213), auch gültig lediglich mit dem Affen als Beigabe vornehmen lässt. Da raus kann auf alle Fälle der Schluss gezogen werden, dass es auf das Quälen des Täters nicht abgesehen sein konnte, denn eine Pro zedur lediglich mit dem Hahn müsste wohl ebenfalls als ausrei chend angesehen werden können . Endlich spricht ganz allgemein gegen den Quälungsgedanken , dass die ganz verschiedenen Tier gattungen nicht in ihrer Eigenschaft, dem Verbrecher zu schaden , nebeneinander gestellt sein können , sondern wegen ihrer speziellen Eignung für die Erreichung eines gemeinsamen Zweckes, der nicht in der Linie der unmittelbaren schädlichen Einwirkung auf das Opfer der Exekution gelegen sein konnte. In den Gloss. cod. Vat. IV p . 502, 3 (ed . Goetz) findet sich zur culleus- Strafe folgende Erklärung : culleo includebantur parri cidae cum simia et serpente et gallo : insuta mittebantur in mare et (51) Hırzig , a . a . O . ; BRUNNENMEISTER, a . a . 0 . 193 ff.; vgl. auch die oben 271 zitierte Plautusstelle . Rudolf Düll 380 contendentibus inter se ipsis animantibus homo maioribus poenis effi ciebatur. Diese Erläuterung kann nicht ernst genommen werden, denn es kann keine Rede davon sein , dass die Tiere deswegen beigegeben wurden , um unter sich in Streit zu geraten und damit die Lage des miteingeschlossenen Menschen zu verschlechtern . Je denfalls zeigt dieser Deutungsversuch, wie verständnislos selbst die ausgehende Antike dieser Erscheinung gegenüberstand . 3. Wie wir schon bei Betrachtung zu Zf. 1 kurz gesehen haben , besitzen sämtliche der genannten vier Tiere in Rom bzw . in Aegypten sakralen Charakter. Es drängt sich daher der Ge danke auf, ob die Tiere nicht als Opfer an Gottheiten , vor allem an die Manen , Laren und Genien zur Sühnung der den Manen des Getöteten angetanen Schmach gedeutet werden können. Besonders muss auf die Verwendung des Hundes als Sühneopfer bei den Lu perkalien verwiesen werden (52). Liesse sich die Verwendung jedes der vier Tiere für Sühnezwecke nachweisen, könnte vielleicht die Bedeutung der Tierbeigaben darin gefunden werden, dass den verletzten Gottheiten zwecks Herbeiführung der Entsühnung wohl gefällige Tiere dargebracht werden sollen. Für diese Ansicht scheinen eine Reihe von Umständen zu sprechen, so vor allem die Ueberlieferung bei Ps. Quintil. decl. 17, 9 , der sich zu dem Verfahren , in dem bloss serpentes verwendet werden , äussert : culleo serpentibus expianda feritas, womit auf den Entsühnungsgedanken hingewiesen sein kann ; mit dieser Stelle liesse sich auch die Erwähnung der “ innoxia simia " bei Juvenal sat. 13 , 156 vereinen . Besonders schiene diese rein sakrale Theorie der altrömische mit Faunus (53) und Fauna (54) in Verbindung stehende Lustrationskult zu stützen , dessen Beziehung zur poena cullei wegen der mit dem Prodigialwesen in Verbindung stehenden Lustration (55) gegeben wäre. So bringt z. B . auch Ovid fast. 3, 291 den Faunus mit dem ritus piandi in Beziehung (sed poterunt ritum Picus Faunusque piandi prodere). An einer Säckung sind nach römisch - sakraler Auffassung weiterhin die Manen in ihrer Eigen (52) Wissowa, a . a . 0 . 196 , 210, 214, 240. (53) Wissowa, a . a . 0 . 210 , (54) Wissowa, 217 ff . (55 ) BRUNNENMEISTER , a . a . 0 . 196 ; Wissowa, a . a . 0 . 392 . Zur Bedeutung der poena cullei im römischen Strafrecht 381 schaft als unterirdische Gewalten (56 ) beteiligt. Es liesse sich so der Gedanke vertreten , dass die Manen , welchen durch das parri cidium Schmach angetan wurde, Genugtuung erhalten müssen . Pro digien -und Manenkult bringt zudem die römische Vorstellung in engste Beziehung , vgl. Ovid ., fast. 2, 535 ff. 556 : honor tumulis ... Manes... prodigiis venit funeribusque modus ; den Manen muss der parricida ferngehalten werden, vgl. Quintil. decl. 299: aeterna quiete compositus sepulcro meo parricida patrem premit. Expulso sedibus meis contactum illius fugio. Der Parricida wird den unterirdischen Gottheiten jedenfalls überlassen, vgl. Ps. Quintil., decl. 10, 15 : parricidio... custodientibus est iuvenis... adsignandus est inferis ; den selben Gedanken zeigt noch Konstantin in Cod. Just. 9 , 17, 1 in der Wendung “ inter eas ferales angustias " , womit an die Ueber antwortung an die Inferi gedacht ist. Da die poena cullei Prodi gialnatur hat, muss ihr ein Reinigungsakt folgen ; weil es sich um Lustration handelt, sind die sakral bei diesem in Betracht kom menden Gottheiten die Familienlaren (57) ;Manen und Laren stehen im römischen Kult übrigens in engster Beziehung (58). Dass die Laren durch böse Handlungen von Familienmitgliedern in Mitlei denschaft gezogen werden können, erwähnt Cicero in de leg. 2, 17, 42 sehr eindringlich : ...perditorum civium scelere... religionum iura polluta ... vexati nostri Lares familiares... impii... etiam sepultura ... caruerunt. Die Bezeichnung “ impius " verwendet derselbe Cicero bekanntlich in der Rede pro S. Rosc . Am . 25 , 69 mit Bezug auf den parricida (in impios singulare supplicium ... invenerunt). Endlich kommt aber bei jeder Expiation der genius populi Ro mani, dessen Kult hohen Alters ist , in Betracht ; Staatsopfer an den genius publicus werden schon in hannibalischer Zeit überliefert (59) ; piacula für den Genius kennt noch Cod . Th. 16 , 10, 12 (60 ). Man könnte nun annehmen , dass den genannten Gottheiten und Mächten gegenüber im Fall des parricidium Kulthandlungen stattzufinden haben , die Lustrations -und Expiationscharakter haben , wie es bei den Prodigien allgemein bezeugt ist (vgl. Tacitus, hist. (56 ) WISSOWA, a . a . 0 . 234 . (57) Wissowa, a . a . 0 . 169 ff. (58) Wissowa, 174 . (59) Wissowa, 179. (60) Wissowa, 175 . Rudolf Düll 382 5 , 13 : prodigia ... hostiis... votis expiare) und dass unsere vier At tribute damit zu tun haben. Für die Wohlgefälligkeit dieser Gaben an die di manes liesse sich folgendes geltend machen : a ) Die Schlange gilt als altes Symbol des Erdgeistes in der indogermanischen Welt (61) ; im römischen Genienkult war sie ein heiliges Tier (62). Mit der Schlange in enger Verbindung steht auch der Kult der Fauna oder Bona Dea (63). Dracontes als ani mantia vigilantissima spielen auch im Aeskulapkult in Rom eine Rolle (Festus p . 110 ); von solchen DOSKOVTES ist bei Plut. Tib . Gr. 20 anlässlich der poena cullei die Rede. Wo Sühnung in Frage steht, wie bei der Säckungsstrafe, sind die di manes betroffen ; so sollen z . B . in ähnlicher Vorstellung nach den leges regiae dieje nigen , welche sich ihren Eltern gegenüber tätlich vergreifen , den divis parentum geweiht werden (64), zugleich aber ist der genius des Volkes bzw . der Familiengenius in Mitleidenschaft gezogen. Beim Parrizidalprodigium würde die Entsühnung stattzufinden ha ben unter Zuhilfenahme der Schlange. In diesem Sinn könnte man Ps. Quintil. 17, 9: serpentibus expianda feritas lesen ; der Kult der Genien und der ihnen sehr verwandten Manen (65) erschiene dann als das Grundlegende, mit dem die Verbindung durch die serpentes zustandekäme. Es war dazu im Genienkult üblich , dass man mit Schlangen Schutz vor Verunreinigung anstrebte, welchen Zweck man schon durch bildliche Darstellung von Schlangen erreichen zu können glaubte (66 ). b ) Mit den Lustrationen haben Hundeopfer für Faunus in Rom ganz besondere Bedeutung. In diesem Kult, besonders beim Luperkalienfest, sind Hunde für Sühneopfer regelmässig überlie fert (67). Plutarch (qu. Rom . 111) verweist übrigens gleichzeitig auf ähnliche griechische Gedanken im Hecatekult, wo Hundeopfer zur Entsühnung und Abwehr des Unheils üblich waren : uuwv delavov “Εκάτη πεμπόμενος αποτροπαίων και καθαρσίων επέχει μοίραν. Ιn Rom wird der Hund zusammen mit den Laren als Sinnbild der Wachsamkeit (61) THRAEMER in Pauly-Wissowa R . E . s . v. Asklepios. (62) Wissowa, a . a . 0 . 176 , 177 . (63) Wissowa, 216 ff. 218 , 219. (64) MOMMSEN , Röm . Gesch, I, 175 ; vgl. auch BRUNNENMEISTER, a , a . 0 . 192 . (65) Wissowa, 176 . (66) Wissowa, 177. (67) Wissowa, 196 , 210 , 214, 240. Zur Bedeutung der poena cullei im römischen Strafrecht 383 genannt (Ovid . fast. 5 , 137 ff., vgl. oben S. 279). Auch im Aesku lapkult werden in Rom Hunde erwähnt (Festus p. 110 : canes adhi bentur eius templo ). Die Verwendung des Hundes bei der poena cullei wäre nach dem Ausgeführten sonach unter dem Gesichts punkt der Lustration canes als Veranlasser nius n . h . 8 , 41 und dies kann aber nicht erklärlich . Uebrigens werden serpentes und von Prodigien ebenfalls genannt (z . B . Pli 10 , 21 : canem locutum ... serpentem latrasse ) ; im Sinn der Schrader'schen These verwendet werden , weil gegen Tiere niemals ein Säckungsverfahren bezeugt ist, dieses vielmehr stets auf Menschen bzw . menschenähnliche Ge schöpfe sich erstreckte (68 ). Eine Beziehung des canis zur Lustra tion und zum Larenkult besteht zweifellos, wird doch der Hund auch als Opfertier der Mater Larum überliefert (69). c ) Auch der gallus gallinaceus liesse sich der gleichen sa kralen Vorstellung einfügen. Da es sich bei der Prozedur vielleicht darum handelt, den Verbrecher den di Manes zu weihen (Ps. Quintil. decl. 10 , 15 : adsignandus inferis), worauf die schwarzen Rinder im Beförderungsritual (oben S . 275 ) und die serpentes hinweisen , wür den weitere sakrale Attribute unterirdischer Gottheiten in das Bild passen. Der Hahn ist ein solches, er ist u dis gratus ” (Plinius n . h. 10 , 21); er wird aber auch als Opfertier deae Nocti überliefert, denn wir lesen bei Ovid . fast. 1, 155 : Nocte Deae Nocti cristatus caeditur ales , quod tepidum vigili provocat ore diem . Dass der Hahn mit Aeskulap in Verbindung stand, wurde bereits oben erwähnt ; auch sind gallinae im Aeskulapkult bezeugt (Fest . p . 110 : huic gallinae immolabantur ). Jedenfalls wäre auch Beziehung des Hahns zum Manenkult wahrscheinlich . d ) Was endlich den Affen anlangt, so liegen uns über des sen Beigabe nur Berichte aus dem römischen Aegypten vor. Es ist daher nicht zweifelhaft, dass dessen Beigabe eine unmöglich altrömische Sitte gewesen sein kann (70), zumal ja Affen in Italien niemals heimisch waren . In Aegypten war nun der Affe, wie be reits oben dargelegt, ein heiliges Tier im Anubis - Thutikult, d . h . im Totenkult (71). Der Umstand , dass Juvenal in sat. 13, 156 den (68) Voigt, XII T. I 257. (69) Wissowa, a . a . 0 , 240. (70 ) so auch Mommsen, Strafr . 722 n . 8 . (71) Göli, Illustr . Mythologie 288, 285 . 384 Rudolf Düll Affen für sich allein verwendet (et deducendum corio bovis in mare cum quo clauditur adversis innoxia simia fatis), stellt damit wohl dieses sakrale Moment in den Vordergrund ; der hundsköpfige Affe Aegyptens ist übrigens Attribut des Totengerichts (72) und der Gott Thuti wird mit dem griechischen Hermes als Seelenführer identifiziert (73). Die Beziehung des Affen zum ägyptischen To tenkult scheint nahe zu liegen. Trotz aller dieser im Sinn von Ritualgaben zu Gunsten der di Manes gebrachten Belege ist die Erklärung der Tierbeigaben bei der Säckung im angedeuteten Sinn gleichwohl abzulehnen . Denn es sind folgende Gesichtspunkte in Erwägung zu ziehen : Fürs erste ist wohl zu beachten , dass eine Opferung, d . h . Schlachtung eines Tieres zu Gunsten einer Gottheit und die Tatsache des Steck ens des Tieres in den culleus nicht dasselbe sein können . Ferner sind als Opfertiere zu Gunsten der di Manes in unserem Fall le diglich Hund und Hahn erweislich . Keineswegs sind der Affe oder gar die Schlange als Opfergaben überliefert. Der Affe ist in Ae gypten ein heiliges Tier ; dass Affen geopfert wurden , wird uns aus Aegypten nicht berichtet (74) ; wir haben oben im Gegenteil gesehen, dass sie als heilige Tiere unter schwerer Strafe geschützt waren . Dass aber Schlangen in Rom als Opfertiere in Betracht gekommen wären , ist für Rom , wo Schlangenbeigabe im culleus schon in republikanischer Zeit autkam , an keiner Stelle belegbar. Gewisse Schlangen sind in Rom als heilige Attribute gewisser Gottheiten verehrt worden, allein als Opfertiere werden sie nir gends erwähnt. Dies ist ein wesentlicher Gesichtspunkt, weil damit zwischen die vier Arten der genannten Tiere ein trennendes Ele ment gestellt wird, das die einheitliche Beurteilung im Sinn von Opfergaben hindert. Ferner kommt in Betracht: die Stätte der di Manes ist die Erde; die ihnen zugedachten Opfertiere würden aber gar nicht ihnen dargebracht, sondern in den culleus gegeben , in nerhalb dessen keine Verbindung mit Erde Wasser und Luft be stehen soll. Dann aber ist zu beachten : Wenn Cicero bereits, wie (72 ) Göll, a. a . 0 . 297, 298, 286 . (73 ) Göll, a . a. 0 . 285. (74) Die überlieferten priesterlicben Tötungsdrohungen gegenüber heiligen Tieren bei göttlicher Ungnade (vgl. Mirteis -WILCKEN, Chrestom . d . Pap. K . 1, 125) sind durchweg Ausnahmen . Zur Bedeutung der poena cullei im römischen Strafrecht 385 oben ausgeführt, den Gedanken bringt, dass man sogar jeder Be stie die Berührung mit dem parricida ersparen will (pro S . Rosc. Am . 26 , 71), so lässt sich mit diesem zweifellos historisch richtigen Gedanken keinesfalls die Idee einer Opfergabe vereinen , wenn die Opfergabe mit dem Verbrecher in Berührung kommt und im glei chen Raum steckt wie dieser selbst . Es kann unmöglich eine den Göttern wohlgefällige Opfergabe bedeuten, wenn die Gottheit ein durch Besudelung mit dem Verbrecher entweihtes Opfertier in Empfang nehmen sollte. Aus diesen Gründen ist auch die sakrale Deutung der Tier beigaben im Sinn einer Entsühnungsfunktion zu Gunsten der Ma nen abzulehnen . 4 . Man könnte weiterhin an die Möglichkeit der Deutung der Tierbeigaben in dem Sinn denken , dass es sich vielleicht we niger darum handle , die ergrimmten Manen des Getöteten zu ver söhnen , als darum , den verblendeten Verbrecher selbst mit den rä chenden Gottheiten wieder auszusöhnen , also die Möglichkeit, dass vielleicht die Tiere aus Gründen der Milderung von dessen Los sakrale Bedeutung haben könnten. Man könnte etwa an den grie chischen Hermeskult, den Asklepioskult and den Thutikult denken , ferner an die Vorstellung von Heilung und Reinigung, welche durch Hahn, Schlange und Hund verkörpert werden könnte. Dieser Ge danke ist jedoch , obwohl die Tierbeigaben in die Zeit der Milde rung des römischen Strafrechts fallen , völlig abzulehnen . Die u impii ” sind überhaupt nach sakral- römischer Auffassung gar nicht in der Lage, von sich aus den Zorn der Götter zu besänftigen (Cic. de leg. 2 , 9, 22 : ne audeto placare donis iram deorum ); dann aber beherrscht das ganze Parrizidalverfahren gar kein derartig milder Zug ; Cicero schreibt (pro S. Rosc. Am . 24, 66): singulare supplicium ... scelus nefarium ... summus furor atque amentia ... nihil tam vile ... numquam abluantur. Es kann also nach römischer Auf fassung gar keine Rede davon sein , dass mit den Tierbeigaben eine Milderung des Loses des Täters beabsichtigt sein könnte und zwar auch nicht etwa in der Prinzipatszeit, denn denselben Gedanken lesen wir bei Quintil, decl. 299 : die Manen sollen jede Berührung mit dem parricida fliehen und es ist keineswegs an eine Versöhn ung gedacht: expulsus sedibus... contactum illius fugio. Der Abscheu gegen den parricida verbietet eine Annahme der beabsichtigten Milderung seines Loses ganz und gar. Rudolf Düll 386 - 5 . Ferner liesse sich die Beigabe der Tiere vielleicht in dem Sinn deuten , dass es sich um einen symbolischen Akt dahin han deln könne, dass sich die di Manes, die Familiengötter, die Laren und die Genien von dem Verbrecher lossagen. Dies geschehe etwa in der Weise, dass ein Attribut, welches den di Manes für gewöhn lich zukommt, dem Täter mitgegeben wird, damit ihm klargemacht wird , dass mit seinem Ende auch die den Laren , Manen und Ge nien heiligen Tiere und damit die Gottheit selbst, welche durch diese Beigaben repräsentiert wird , für ihn erledigt ist; dies wäre dann etwa eine drastische symbolische Andeutung des Abbruchs der Beziehungen . Auch diese Konstruktion muss indes abgelehnt werden . Es müsste befremden , wenn die Gottheiten ihnen heilige Tiere um eines portentum willen beseitigen liessen , lediglich um einer Demonstration wegen , um einem ihnen noch dazu äusserst verhassten Subjekt einen Denkzettel mitzugeben . ' 6 . Man kann nun endlich geltend machen , dass die Tier beigaben vielleicht solche rein prodigialer Natur seien und aus die sem Grund einem Akt der procuratio prodigii, als welcher ja die Beseitigung des parricida aufzufassen ist, eigentümlich sein müssen . Diese Annahme führt in der Tat zum eigentlichen Kern punkt des Problems. Selbst die Dositheisch - Theophilische Auf fassung der Orolotoonia lässt sich mit dieser Erklärung in Verbin dung bringen, freilich nicht ganz in der von beiden antiken Schrift stellern angenommen Art der Natur der verwendeten Tiere an sich , sondern jener ihrer besonderen Beziehung zum Prodigialkult . Denn wir lesen bei Terenz und bei Cicero, also für eine verhältnismässig frühe Periode über unsere sämtlichen vier Tiere Charakteristiken, die sie zum Prodigialkult in engste Beziehung setzen . Bei Terenz, Phorm . 705 bereits sind als prodigiale Tiere Schlange, Hund und Hahn in einem Atemzug genannt : “ Quot res postilla monstra evenerunt mihi! Intro iit in aedes ater alienus canis, anguis per impluvium decidit de tegulis, gallina cecinit : inter dixit hariolus, haruspex vetuit ” . Die krähende gallina ist natürlich als gallus zu betrachten ; das Femininum steht hier wohl ausschliesslich mit Rücksicht auf das Versmass . Bei Cicero wird dem Affen eine ähnliche prodigiale Rolle zu geschrieben . In de div . 2 , 69 nennt er ihn “ monstruosissima bestia " und das Dazwischentreten eines einem epirotischen König gehöri Zur Bedeutung der poena cullei im römischen Strafrecht 387 gen Affen bei einer Sakralhandlung in Dodona hat nach Ciceros Bericht (de div . 1, 76 ) den Spartanern einen gewaltigen Schrecken eingejagt: maximum illud portentum Spartiatis fuit, quod simia ... sortes et cetera ad sortem parata disturbavit. Die portentum - Vor stellung färbt wohl noch bei Rufinus, hist. mon . 148 C. ab , wo von dem Kult der alten Aegypter gesprochen wird : ...canes et simias atque alia portenta venerati sunt. Wir dürfen nach diesen Ueberlieferungen sicherlich davon aus gehen, dass die genannten vier Tiere wegen ihrer besonderen Be ziehung zu den Prodigien in das Prodigialverfahren der culleus Prozedur gelangt sind. Allein auch hiemit ist die Sache noch nicht endgültig geklärt. Denn die Prodigialnatur der vier Tiere kann für ihre Verwendung im culleus nicht allein bestimmend gewesen sein , wenn sie auch dabei eine wesentliche Rolle spielen wird : bei den prodigialen Tieren kommt an sich ja nur zum Ausdruck , dass ihr auffälliges Erscheinen mit irgend einem drohenden Unheil in Verbindung steht, sodass aus ihrem Auftreten auf eine schlimme Wirkung geschlossen werden darf; sie sind Vorboten schlimmer Dinge. Bei der Parricidalstrafe aber werden diese Tiere ad hoc nach Vorliegen des Prodigiums herbeigeholt und in das Verfahren eingeschaltet und zwar in der Art, dass sie das gleiche Los zu erleiden haben, wie das monstrum selbst. Es muss daher noch ein weiteres Moment mitbestimmend gewesen sein , das mit dem u adsignare inferis " in Verbindung steht, dem liegen soll. der Täter unter Damit kommen wir zu der Erklärung, dass es sich um Mit gabe der dem Prodigialkult an sich verwandten Tiere an die Un terirdischen zu dem Zweck handelte, die Gottheit bei der Bestraf ung des parricida symbolisch zu repräsentieren. Durch die Cha rakterisierung des “ ater canis " als prodigioses Tier ist deutlich gemacht, dass in solchen Tieren Ausstrahlungen schlimmer unterir discher Gewalten vorliegen. Durch die Beigabe von Trägern sol cher Ausstrahlungen unterirdischer Gewalten wollte man zweifellos den Verbrecher sichtbar in den Bereich derjenigen Gottheiten bringen , welche in der Unterwelt Besitz von ihm ergreifen müs sen : der Götter der Rache und Vergeltung. Den Manen des Getö teten ist schwerstes Unrecht angetan worden ; sie müssen gerächt werden und zwar mit Rücksicht auf die Schwere der Missetat in ganz besonderem Masse. Die Tierbeigaben verkörpern sämtlich Em bleme, Attribute der rächenden Geister der Unterwelt, der Furien . Rudolf Düll 388 Cicero weist in der Rede pro S . Rosc. Amer. 24 , 66 ff. sehr anschaulich darauf hin , dass der parricida schon nach ältester Vor stellung von den Furien gehetzt werde, die ihm keine Ruhe lies sen (ut eos agitent furiae... terrent... impiis assiduae domesticaeque furiae, quae dies noctesque parentum poenas a consceleratissimis filiis repetant). Der parricida wird den unterirdischen Gottheiten über antwortet (Ps. Quintil. decl. 10, 15 : adsignandus est inferis et den sioribus transfuga claudendus est tenebris); solche sind gerade die Furien (Seneca, Hercul. 1221 : dira furarum loca et inferorum carcer ). Die Rachegötter der Furien sollen den Verbrecher ständig jagen (Quintil., decl. 114 : ...furiis agitari et per totum orbem agi) ; Ps. Quintil., decl. 19, 14 u . 15 nennt den parricida “ furiis monstrosae feritatis accinctus ". Die Furien , sagt Livius mit Bezug auf einen Fall der römischen Königszeit, verfolgen die parricidae (Liv. 1, 48 , 7 : agitantibus furiis amens); auch Cicero (de nat. deor. 3 , 46 ) sind die Furien die vindices facinorum et scelerum . Der römische Furienkult ist sehr alt und aus dem Etruskischen übernommen, wo diese Rache-und Quälgeister, die den Verbrecher aufs Grimmigste zu hetzen haben , eine vertraute Vorstellung waren (75 ). Auch der Prodigienkult weist ja nach der Ueberlieferung deutlich auf etrus kische Einflüsse zurück (76 ); man vergl. z. B . Cicero , de leg. 2 , 9 , 21 : prodigia portenta ad Etruscos et haruspices... deferunto . Quibus divis creverint... procuranto . Dieser althergebrachte Kult wurde später mit dem Graecus ritus der Erinyen verschmolzen (77). Nun besteht offensichtlich die Vorstellnng, dass der parricida im Jenseits erst eigentlich bestraft werden soll. Sallust., or . Cott. 3 schreibt: Quis mihi (sc . parricidae) vivo cruciatus satis est aut quae poena mortuo ? Die di Manes des Ermordeten schreien nach Ver.. geltung (Seneca, contr. 7, 2 (17) 5 : Di Manes... et inultae patris... te persequuntur animae ; ebenso Seneca, exc. contr . 7, 2 ) und die Inferi haben die Aufgabe, nach der staatlichen Prozedur die Strafe des parricidium recht eigentlich büssen zu lassen (Cicero, Phil. 14 , 32 : illi impii, quos occidistis, etiam ad inferos poenas parricidii luent). (75 ) MOMMSEN, Röm . Gesch . I 180 ; WASER in Pauly-Wissowa, R . E . s . v . furiae. (76 ) MOMMSEN, a. a . 0 . 181 ; Thulin , in l'auly-Wissowa, R . E . 8. v. ha ruspeo . (77) WASER, a. a . 0 . 310 ff. Zur Bedeutung der poena cullei im römischen Strafrecht 389 Den parricida charakterisiert mit dem contemptus hominum deo rumque das “ ultimum nefas ” (Quintil., decl. 377). Der antiken Vor stellung ist durchgängig eigen, dass die Manen des Getöteten nicht ruhen können , solange nicht dem parricida vergolten ist und dass die rächenden Gottheiten der Unterwelt alles aufbieten müssen , um Rache zu erlangen . Die griechisch -römische Mythologie erklärt die Furien als Töch ter des Acheron und der Nox (Serv. gramm . Aen . 7 , 237 : furiae Acherontis et Noctis filiae sunt). Besonders ausgezeichnet unter den Furien sind die oft genannten Tisiphone und Megaera . Sie sind Gottheiten der Unterwelt (Tacit. ann. 14 , 30 : in modum furarum veste ferali ; Seneca, Herc. 1221 : dira furarum loca et inferorum carcer ) (78). Wir sehen also, dass in der Ciceronianischen Zeit und hinauf bis in die älteste Periode die Kultvorstellung der rächenden Ver geltung der Furien bestanden hat. Mit dem Wiederaufkommen der culleus-Strafe haben wir nun auch dahin deutliche Ueberlieferung, dass ein Verfluchungsverfahren einsetzte und dass gerade die Fu rien hier eine besondere Bedeutung hatten ; das “ adsignare inferis " von dem uns Ps. Quintil., decl. 10 , 15 bei der Säckungsstrafe des parricida spricht, erfährt durch Sueton, Claud. 12 eine plastische Darstellung, denn wir lesen hier: “ parricidam diris exsecrationibus incesserunt” , wozu das " diris ” , welches gerade auf die Furien hinweist (79), besonders zu beachten ist. Es handelt sich daher je denfalls um ein sakrales Verfluchungsritual, um den homo impius den Dirae, d . h . den furiae zu überantworten . Eine ganz ähnliche Wendung, noch unter Nennung der furiae, finden wir bei Livius 10, 41, 3 : dira execratio ac furiale carmen . Sämtliche dem parricida in den culleus gegebenen Tiere haben nun ganz deutlich Beziehung zu den Göttern der Unterwelt und namentlich zu jenen der Rache und der Vergeltung. Die Tiere ge langen daher wohl aus symbolischen Gründen in die Prozedur, aber nicht nach der von Dositheus gegebenen oberflächlichen Er klärung als doeBir sou schlechthin , die etwa aus ihrer Art an sich dem Verbrecher ähnlich seien , sondern als Attribute der Ge walten , welchen den Verbrecher zur Rache und zur (78, Weitere Nachweise in Thes. l. Lat. VI, 1 s. v . furiae. (79) S . die Belege in Thes, I. Lat. s . v . dirus. 390 Rudolf Düll Vergeltung ausgeliefert werden soll. Nicht für die Manen des Getöteten sind die Tierbeigaben bestimmt, sondern für die Gottheiten der Rache und der Finsternis, die die Untat vergelten sollen . Betrachten wir nun im einzelnen die Tiere unter diesem Ge sichtswinkel. a ) die serpentes, viperae. Wir haben es hier, wie schon bei Plutarch (Tib . Gr. 20 ) mit êzidvai, Spárovtag d . h . mit serpentes, viperae zu tun . Dies ist der übliche Ausdruck für unangenehme, namentlich giftige Repti Jien, die mit der den Genien heiligen ungiftigen Hausschlange nichts zu tun haben , ebensowenig mit den Beigaben des Aeskulap kultes. Hier kommt das u immitissimum genus animalium ” der serpentes (Plinius n . h . 10, 207) in Betracht, das sich besonders durch seine ictus und venena, seinen terror und seine minae be merkbar macht (vgl. z. b . Plin . n . h . 24, 7 ; 24 , 130 ; 24 , 163 ; 28, 70 u. a, m .); in dem gleichen Sinn erscheint die vipera als die u venenata ac pestifera " (Cic . har. resp. 50 ; Seneca contr . 7, 6 , 20 ) ; mortiferus serpentis ictus... et viperae erwähnt Columella 6, 17, die venena serpentium maxime viperae Plinius n. h. 23, 152. Serpentes sind nun die vorzüglichsten Embleme der rächenden Geister, der furiae (80) : Verg. Aen. 4 , 471 : serpentibus atris... ultrices Dirae ( = furiae). Verg . Aen . 7, 375 : serpentis furiale malum . Verg . Cul. 218 : Tisiphone serpentibus undique compta . Verg. Aen. 12, 848 : Tartaream Megaeram ... revinxit serpentum spiris. Horat. sat. 1, 8 , 30 : vocat Tisiphonen ... atque serpentes infernas. Ovid . met. 4 , 491 : nexa vipereis distendes bracchia nodis ( sc . furiae). Florus epit. 1, 6 : discoloribus serpentium in nodum vittis furiale more processerunt... habitus ille feralis. Wir sehen übrigens deutlich , dass viperae, serpentes vornehm lich den unangenehmen Beigeschmack haben , anguis dagegen meist den günstigen. Wenn z. B . ausgeführt werden soll, dass mit den Manen die Schlangen als Hausgötter ihren Platz verlassen (vgl. (80) Vgl. auch Waser, Pauly-Wissowa, R . E. s. v. furia 310 ff. Zur Bedeutung der poena cullei im römischen Strafrecht 391 Silius Ital. 2 , 585 ff.), ist von anguis die Rede, ähnlich Pers. 1, 113 (81). b ) canis. Der Hund als Emblem der unterirdischen Gottheiten , beson ders der Hecate und der Furien (82) ist häufig überliefert. Die schon öfter erwähnte Plutarchstelle (qu. Rom . 111) nennt den Hund als wohlgefälliges Tier der 'Exátn xVovia im griechischen Kult ; in Rom kommt die gleiche Vorstellung auf: Verg. Aen . 6 , 257: canes Hecatae. Val. Flacc. 3, 228 : Eumenidum canes. Horat. sat. 1, 8 , 35 : serpentes atque videres infernas errare canes . Schol: Hor. sat. 1 , 8 , 35 : infernas canes... aut Cerberum dicit aut furias. Servius gramm . Aen . 6 , 257 : canes... furias dicit Lucanus. Derselbe 4, 609; 3, 209 e. 380, 4 : apud inferos furiae dicuntur et canes. Ovid. met. 14 , 410: et latrare canes et humus serpentibus atris squalore et tenues animae... monstris volgus pavet. Seneca, Herc. 985 : Tisiphone caput serpentibus vallata post rap tum canem . Grattius, Cyn . 392: in furias vertere canes . Wir sehen hier deutlich, dass in der sakralen Vorstellung das im canis - Begriff liegende hetzende und verfolgende Element den Furien als Symbol beigelegt ist. c ) gallus gallinaceus. Auch der Hahn steht mit den Furien , den Göttinen der Nacht, Töchtern der Nox in engster Verbindung. Bei Ovid . fast. 1 , 455 ist davon die Rede, dass “ nocte Deae Nocti cristatus caeditur ales, quod tepidum vigili provocat ore diem " . Darin kann der Gedanke liegen , dass der gallus den Unterirdischen deswegen angenehm sei, weil er gewissermassen Feind ihrer Herrschaft ist. Wenn Ps. Quintil., decl. 10, 15 schreibt: adsignandus est inferis et densioribus transfuga claudendus est tenebris, so kann, auf den gallus abgestellt, zum Aus druck gebracht werden, dass die tenebrae für den Verbrecher niemals weichen sollen. Allein es ist wohl zu beachten, dass die Beigabe in den culleus keine Opferung bedeutet. Da doch sicher (81) Weitere Stellen in Thes. l. Lat. II, Sp. 53 ff. (82) Waser, a . a . 0 . 313 . Rudolf Düll 392 anzunehmen ist, dass die vier Tiere alle an dieselbe Adresse ge dacht sind, so ist die symbolische Bedeutung des gallus wohl nur im Furienkult zu suchen. In diesen bringt ihn aber deutlich die hier wohl allein bestimmende Vorstellung, dass der Hahn als ty pisch wachsames Tier die treibende hetzende Rolle des canis treff lich zu unterstützen geeignet ist, denn der Verbrecher soll ja den unablässig verfolgenden Quälgeistern der Furien überantwortet werden . Dazu passt gerade sein “ os vigile ” . d ) simia . . Wie schon oben erwähnt, ist der Affe in Rom frühzeitig bekannt gewordenes Tier. Bei der Prozedur ist er aber lediglich für Aegypten bezeugt, sodass eine zum aegyptischen Kult der unterirdischen Götter mehr scheinlich ist. Diese Beziehung läuft dem ein schon im culleus Beziehung als wahr römischen Furienkult parallel. Der Affe, besonders der hundsköpfige (cynocephalus) er scheint im aegyptischen Kult als Teilnehmer am Totengericht (83 ). Die römische sakrale Vorstellung macht ihn damit zu einer Art Cerberus, dem Gehilfen der Furien , der nicht eher ruht und rastet, bevor nicht dem Verbrecher vergolten ist. Cynocephali, die in der römischen Zeit in Aegypten sogar unter die Sterne versetzt wur den (84), werden zudem in der alten Literatur im Isiskult zusam men mit den unterirdischen Gewalten, insbesondere den Furien genannt, vgl. Inc. auct. (Querol.) p . 29, 22 : mysterio sunt in aditu Harpyae, cynocephali, furiae, ululae, nocturnae striges. Allen unseren vier Tieren ist also im Mythus die Eigenschaft eigen , dass sie zu den unterirdischen Gottheiten und zwar ganz besonders zu den rächenden Furien , die den Täter des parricidium nach antiker Auffassung unablässig quälen und verfolgen sollen, in engster Beziehung stehen. Gerade weil wir in Verbindung mit der Parrizidienstrafe das “ adsignare inferis ” überliefert erhalten ha ben , dazu die häufige Erwähnung der furiae und das Exsecrations verfahren (Sueton, Claud. 12 : parricidam diris execrationibus in cessere; Liv . 10, 41, 3 : dira execratio ac furiale carmen ), ist kein Zweifel, dass ein förmliches Verfluchungsritual in Gang gebracht wurde. In einer feierlichen Ritualhandlung wird der parricida den Furien überantwortet und ein Teil diese Aktes ist die solenne Bei (83) Göll, Ill. Mythol. 297, 298 . (84) BRUGSCH, Aegyptologie 345 . Zur Bedeutung der poena cullei im römischen Strafrecht 393 gabe der vier Tiere oder einiger von ihnen, welche die unterirdi schen Gewalten repräsentieren und ihre Besitzergreifung symboli sieren sollen . Dass dem sicher so war, werden wir im weiteren Verlauf noch sehen , wo ein ganz ähnlicher Gedanke beim Streichen mit den virgae sanguineae auftritt. Im übrigen dürfen wir ohne weiteres annehmen , dass die bei der Prozedur verwendeten Tiere, Schlange, Hund , Hahn und Affe dunkler Farbe waren, möglichst schwarz . Dies entspricht dem Ver wendungszweck dieser Tiere als Symbole der Inferi (85 ). Schwarze Tiere in Verbindung mit den Rachegottheiten nennt z . B . Vergil, Aen. 4 , 471 : serpentibus atris... ultrices Dirae; Ovid . met. 14 , 410 : ...serpentibus atris ; Terenz, Phorm . 706 : quot monstra ... ater canis . Schwarze Schlangen spielen im etruskischen Prodigialkult übrigens seit Alters als böse Vorzeichen eine Rolle (86). Die Manen des Getöteten verlangen Rache, die Furien sollen sie ausführen. Daher stehen an erster Stelle unter den Beigaben, in älterer Zeit ganz allein erwähnt, die serpentes als das wesent liche Attribut der rächenden Gottheiten ; noch in Cod . Th . 9, 15 , 1, Cod. Iust. 9, 17, 1 werden die “ contubernia serpentium " als das Wesentliche hingestellt. Durch ständige Verfolgung der Furien kann vielleicht eine Sühnung stattfinden (Ps Quintil., decl. 10, 15 : ser pentibus expianda feritas) ; staatliche Justiz dagegen kann die Grösse des scelus überhaupt nicht vergelten (Cicero, pro S. Rosc. Am . 26 , 72: numquam abluantur), während sonst « mari cetera quae violata sunt, cxpiari putantur " (Cicero l. c.). Die Verbindung mit den un terirdischen Gottheiten der Rache charakterisieren wieder die “ fe rales angustiae " der konstantinischen Konstitution in Cod. Iust. 9, 17, 1 . In Aegypten reicht, entsprechend der Vorstellung im Isis kult, der hundsköpfige Affe, der den Verbrecher jagt und vor dem Totengericht Rechenschaft fordert, für sich allein für die Prozedur aus (Juvenal. sat. 13, 156 ). Nun scheint in diesem Zusammenhang noch besseres Licht auf die Verwendung von Schlangen bei der culleus- Strafe für crimen laesae maiestatis bzw . perduellionis (Plutarch ., Tib . Gr. 20 ) zu fal len . Man hat nämlich den furia -Begriff åuf Vaterlandsfeinde und politische Schädlinge allgemein angewendet, vgl. Cicero, pro Sest. (85 ) Vgl. hiezu allgemein Wissowa, a. a . 0 . 413. (86 ) Thulin , in Pauly-Wissowa, R. E. s. v. haruspices Sp. 2465 . Roma · II 26 Rudolf Düll 394 33 : ab illa furia ac peste patriae ; Liv. 30, 13 , 12 , 13: illam furiam pestemque; der politische Verbrecher wird oft als “ patriae parri cida ” diesem Gedanken entsprechend, bezeichnet, so z . B . Cic . Phil. 2 , 17 ; 14, 92 ; wenn er im gleichen Sinn als “ furia " auf tritt, so liegt sicherlich der Gedanke mit zugrunde, dass er wie jener den Furien zur Strafe zu übergeben ist. Damit stimmt über ein , dass man in dem von Plutarch geschilderten Fall viperae und serpentes als Hauptattribute der furiae bei der Prozedur verwen dete. Sowohl im etruskischen Furienkult wie in der etruskischen Sühnelehre des Prodigialwesens spielen griechische Vorstellungen eine grosse Rolle (87) . Zugleich ergibt sich auch ein gewisser Anhaltspunkt über die Entstehungszeit der Tierbeigaben im culleus. Vor der Gracchenzeit finden wir keine Erwähnung der serpentes ; Cicero ist ihre Bei gabe noch keine reguläre; was den canis und den gallus anlangt, so werden diese mit den Schlangen bei Terenz als Prodigialtiere wohl schon genannt, doch ist ihre Beigabe bei der Säckungsstrafe wohl nicht unbeeinflusst vom Mâ- Bellonakult, durch den der He cate - Nox -und Furienkult neu belebt wurde (88) und der Affe (simia), obwohl als prodigiales Tier schon bei Cicero genannt, verdankt seine Uebernahme in das Verfahren doch wohl erst dem in Rom zu Ende der Republik eingedrungenen Isiskult (89). III Die Bedeutung des übrigen Rituals . Dem Grundgedanken , dass dem verfluchten den di inferi ge weihten parricida Symbole der unterirdischen Rachegottheiten mit gegeben werden, entspringen auch weitere Eigentümlichkeiten des Verfahrens, die mit den unterirdischen Gottheiten in engstem Zu sammenhang stehen . 1. Zunächst sei auf die Verbringung des Missetäters im cul leus zum Gestade mit dem Ochsengespann verwiesen. Es besteht kein Anlass, den Bericht des Dositheus über dieses Ritual anzu (87 ) Thulin , a. a. 0 . Sp . 2468. (88 ) Wissowa, a . a . 0 . 318 ff . 316 . (89) Vgl. MOMMSEN, Röm . Gesch . III, 572. Zur Bedeutung der poena cullei im römischen Strafrecht 395 zweifeln , um so weniger, als nach den gemachten Feststellungen dem ganzen Verfahren kultisch -sakrale Bedeutung zukam ; auch der bei Cicero, ad Her . 1 , 13 zitierte Gesetzeswortlaut: dove hatur in profluentem deckt sich mit dem Dositheischen Bericht. Es ist daher leicht begreiflich , dass bis in die kleinsten Kleinigkeiten hinein solenne Formen herrschten . Dass den Wagen schwarze Rin der zu ziehen hatten , war gerade für den Kult zu Gunsten der di inferi typisch (90 ); schwarze Ochsen (bos ater ) werden uns als Opf ergabe zu Gunsten der di Manes überliefert (91); derartige Opfer mit zwei schwarzen Rindern erhält beispielsweise schon die alte Göttin Tellus (Ovid . fast. 4, 665 : morte boum tibi... Tellus placanda duarum ) ; es ist bei Dositheus nicht angedeutet, dass es sich nach Vollendung des Beförderungsaktes auch um eine Opferung der boves atri an die unterirdischen Götter handelte ; unmöglich ist dies aber ganz und gar nicht, da beim prodigium ja immer die Expiation zum Zweck der Besänftigung des Zornes der Unterir dischen eine wesentliche Rolle spielte . Tellus ist dazu eine altrö mische Gottheit, die bereits im alten Ritual als Vertreterin der Unterwelt auftritt (92), wobei die Wendung 4 Telluri ac dis Mani bus " üblich war (93). Es dürfte nach allem in diesem Ritual das Besänftigungsopfer an die di Manes zum Ausdruck kommen. Diese Prozedur passt auch vollkommen in den Adsignationsakt. Schwarz ist auch , zusammen mit dem später noch zu besprechendenų san guineus " die Farbe der Unterirdischen, vor allem der Furien (94). Man beachte auch, dass nach der Ueberlieferung schon Tarquinius Superbus wegen monströser Geburten , die dem Parricidium sakral an die Seite zu stellen sind (95 ), taurea sacra angeordnet hat,wo mit nach der allgemeinen Sitte wieder nur schwarze Rinder gemeint sein können ( 96 ). Die Inferi, welche hier Opfer erhalten, sind Tel lus oder die di Manes, jene dagegen , welchen der Uebeltäter cul leo überantwortet wird , sind die furiae. Das Befördern des den unterirdischen Göttern ausgelieferten Opfers auf dem von schwar (90) Wissowa, a . a . 0 . 413. (91) Wissowa, 413 n . 6 . (92) Wissowa, 194, MOMMSEN, Röm . Gesch. I, 165. (93 ) Wissowa, a . a . 0 . 194, 195 . (94) WASER, PAULY-WissowA, R . E . s. v . furiae 312. (95) BRUNNENMEISTER , a . a . 0 . 188 n . 4 . ( 96 ) Voigt, XII T ., I, 256 n . 43, 396 Rudolf Düll zen Rindern gezogenen Wagen erinnert übrigens auffällig an die Bestattungsprozedur der alten Aegypter (87), während im rö mischen Bestattungswesen die Wagenbeförderung grundsätzlich nicht üblich war (98 ). 2. Eine besonders interessante kultische Bedeutung liegt dem in D . 48, 9 , 9 pr . genannten Streichen mit “ virgae sanguineae ” zu Grunde. Dass es sich hier um etwas Anderes handeln könne, wie bei dem gewöhnlichen virgis verberare, virgis caedere der kri minalen Strafen, hat schon Brunnenmeister (99) für möglich gehal ten ; die richtige Erfassung dieser virgae sanguineae wenigstens an gedeutet zu haben , ist jedoch Verdienst von Rein ( 100). Es han delt sich hier , wie Rein annimt, nicht um Geisseln mit bluttrie . fenden , sondern um solches mit roten Ruten . Mehr hat Rein al lerdings nicht festgestellt und auch spätere juristische Schriftstel ler, selbst Mommsen (101), gehen sämtliche, soweit ich sehe, nicht näher auf die besondere Art dieser Geisselung ein . Die virgae sanguineae gehören nun dem Sakralkult an ; sie ha ben Zaubercharakter ; sie bezwecken die bösen Geister des porten tum zu beschwören und ihre schädliche Wirkung von der Allge meinheit fernzuhalten . Dies zeigen uns die Berichte der Antike über Zauberruten und Beschwörungsformen deutlich . Man vergleiche zunächst allgemein zur virga bei Opfer -und Kulthandlungen : Plautus, Pseud. 333: duo greges virgarum ulmearum ... ad lita tionem ... Jovi. Varro, 1. L . 6 , 18 : sacrificant... e caprifico adhibent virgam . Gellius 5, 8 , 1 (Hyg. fragm .)... lituus... virga brevis... qui au gures utuntur. Ovid. fast. 2 , 28 : piamina ... februa poscenti pinea virga data est. Ovid . fast. 4. 735: virga verrat humum (zum Zweck eines Reini gungsrituals ). Festus p. 8, 10 : hostia .. Jovi.. cui ad figebatur apex virga oleagina. Festus p . 45, 18 : caduca auspicia ... cum aliquid in templo exci dit, veluti virga e manu . (97 ) Brugsch, Aegyptol. 71, 183. (98) Blümner , d . röm . Privataltertümer 495. (99) a . a . 0 . 188 n . 7 . (100 ) Criminalrechi 457. (101) Strafr . 922. Zur Bedeutung der poena cullei im römischen Strafrecht 397 Fest. p. 45, 32 : virgae, quas flamines portant,pergentes ad sacri ficium . Die virga, oft als virga aurea bezeichnet, ist auch Attribut des Merkur als Psychopompos (vgl. z. B . Hor. carm . 1, 24, 16 ; Vergil. Aen . 4 , 242 ; Ovid . ep. 15 , 64 : inque dei digitis aurea virga fuit); auch hier bestehen Parallelen zum etruskischen Prodigialkult, wo sich der griechische Hermes in dieser Eigenschaft schon frühzeitig nachweissen lässt (102). Besondere Bedeutung erlangt die virga als Zauberstab, so bei der Sibylle (venerabile donum fatalis virgae: Verg. Aen. 6 , 409), der magica virga der Medea (Val. Flacc. 7 , 210) oder der virga balae nacea (Fischbeinrute) gegenüber in felices bei Petron . sat. 21 und der virga Lethaea bei Sil. Ital. 10 , 356 . Im römischen Sakralkult bestand deutlich die Vorstellung, dass man im Besitz eines Zauberstabes böse Wirkungen feindlicher Ge walten bannen könne, z. B . Sil. Ital. 3 , 198 : ...neque vis aderat noctis virga fugante tenebras; Ovid . met. 14, 410 : paventis ora vene nata tetigit mirantia virga. Solchen Zauberruten legte man magische Kräfte bei. Von der virga populi (Pappelrute) berichtet z . B . Pli nius n . h . 24, 47 und 24, 63 in dem Sinn, dass man mit dieser verhüten könnte , sich wund zu reiten : virgam populi in manu ... (aut in cinctu ) ... tenentibus intertrigo non metuitur. Von der virga des Tamariskenbaumes besonders verkündet Plinius (n . h . 24 , 68 ) dass man sich damit Leibschmerzen fernhalten könne ; Mart. Ca pella 2 , 126 erzählt über ähnliche Zauberwirkungen : cuius vi gente virga dirum stupet venenum und noch der hl. Augustin berichtet ( serm . 93, 3 ) von der Verwendung einer solchen virga zwecks Ban nung der bösen Geister bei einem Toten : puerum suum cum virga misit praecipiens ut super cadaver exanime virgam poneret. Eine ganz besondere kräftige Zauberwirkung wird nun den so . genannten “ virgae sanguineae " zugeschrieben . In n . h . 19, 10 rühmt Plinius die Zauberwirkung einer virga sanguinea dahin , dass die mit ihr berührten Gegenstände für gewisse schädliche Einflüsse , hier von Ungeziefer, gefeit werden : sunt qui sanguineis virgis tangunt ea quae nolunt his obnoxia esse (d . h . Berühren der Gegenstände, von denen man wünscht, dass sie für schädigende Einflüsse nicht empfänglich werden ). Ein besonders günstiger Zaubereinfluss nach ( 102) THULIN , a . a . O . Sp . 2450 . 398 Rudolf Düll dieser Richtung wurde im Altertum dem Tamariskenstrauch zuge schrieben . Mit Bezug auf diesen schreibt Plinius n. h . 24, 10 , 43 : nec virga sanguinea felicior habetur. Dieser Strauch, eine Zypres senart, bringt deutlich wieder die Verbindung mit den unterirdischen Gottheiten ; diesem Zweck diente die Tamariske vornehmlich in Aegypten (103), aber auch in Rom (vgl. 9 , 917 : tamarix non laeta comis . . . nox ; Plin. n . h . 16 , 33: cupressus .. . Diti sacra et ideo funebri regno ad domos posita ) ; Taxus, tamarix und Zypressen werden oft zusammen genannt, so Plin , n . h . 16 , 80 ; 16 , 90 ; die Furien haben Fackeln aus Taxusholz ( 104). Sanguineus wird zu dem technischen Wort, mit dem die At tribute der unterirdischen Gottheiten charakterisiert sind. Man sieht hier die Einwirkung des Mâ-Bellonakults (105 ) und des ihm fol genden Selene-und Hekatekultes. Alles, was mit den Inferi-Gott heiten in Verbindung steht, erhält mit Vorliebe neben dem ater Praedikat jenes des « sanguineus " und cruentus. Man vergleiche : Carm . Lat. ep. 443, 4 : ..sanguinea palla ..Clotho Verg. Aen . 6 , 555 : Tisiphone .. palla cruenta Petron. sat. 124, 276 : Discordia.. sanguineam lampada quatiebat, ut Cocyti tenebras et Tartara liquit Ovid. amor. 2, 1 , 23 : carmine sanguineae deducunt (herabzau bern !) cornua lunae ; ähnlich Hor. sat. 1, 8 , 30 : luna rubens Val. Flacc. 7 , 328 : omnia quae Manibus eruit et quae sangui neae lunae destrinxit ab ira.. Besonders häufig erscheint sanguineus in Beziehung zum Bel lonakult : Seneca dial. 4 , 35 , 6 : sanguineum quatiens dextra Bellona fla gellum Ver. Aen. 8, 703 : cum sanguineo sequitur Bellona flagello ; ähn · lich Lucan . 7 , 568 ; Stat. Theb . 9, 297. Diese virgae sanguineae, die dem Zauberritual, also sakraler Vorstellung dienen, sind nach dem sweifellos zutreffenden Bericht des Modestinus in I). 48, 9, 9 pr. zu Grund zu legen ; sie passen voll und ganz in das Prodigialzeremoniell : der für schuldig befun dene Täter ist den rächenden unterirdischen Gottheiten verfallen ; (103) Göll a . a . 0 . 290. (104) Vgl. die Belege bei Thes. 1. Lat. VI, I Sp . 1614 . (105 ) Wissowa, a . a . 0 . 348 ff. Zur Bedeutung der poena cullei im römischen Strafrecht 399 von ihm als portentum geht eine gefährliche Wirkung aus, die ein gedämmt werden muss. Daher setzen zunächst die Isolierungsakte durch Anziehen der soleae ligneae ein und das caput obnubere mit dem Entzug des Tageslichts folgt. Nun werden mit den Zauber ruten die bösen Geister beschworen , um sie zu bannen und die unterirdischen feindlichen Gewalten, die in dem monstrum sich gezeigt haben, am weiteren Umsichgreifen zu hindern. Diesen infer nalen Gewalten wird der Täter nach Züchtigung mit diesen Ruten durch Exsekration übergeben und zugleich damit erhält er die Sym bole der Gottheiten, welchen er ausgeliefert ist, mit in den culleus. Die virgae sanguineae sind ganz ohne Zweifel in erster Linie dazu berufen, eine weitere Verbreitung der schädlichen Einflüsse , nament lich auch auf die Personen, welche den Verbrecher ergreifen müs sen , von der Mitwelt fernzuhalten, mutet doch Cicero (pro S . Rosc . Amer . 26 , 71) nicht einmal den wilden Tieren zu , dass sie sich an dem monstrum des parricida besudeln . In D . 48 , 9 , 9 pr. ist mit den virgae sanguineae somit ein Rest des alten Zauberrituals über liefert, keineswegs ein primär als Züchtigung gedachter krimineller Vollzugsakt. Das Zauberritual des virgis sanguineis verberare gehört richtig besehen nicht dem Verfluchungsakt grundsätzlich an, son dern einem Beschwörungsverfahren zum Zweck der Unschädlich machung der in dem parricida wirkenden infernalen Gewalten . Thu lin (106 ) dagegen führt aus, dass eine Geisselung des parricida mit Ruten eines Unglücksbaumes vorliege. Er beruft sich dabei auf Macrob. sat. 3, 203, wo die Unglücksbäume aufgezeichnet sind. In dieser Stelle ist jedoch keineswegs von virgae sanguinea e die Rede, sondern nur davon, dass mit dem Holz der näher angegebenen Unglücksbäume schlimme Prodigien zu verbrennen seien. Dieser Fall betrifft nicht unser Verfahren . Andererseits erklärt Thulin selbst mit Recht die virga sanguinea als eine solche von magischer Heilwirkung (107). Aus der Art nun , wie Plinius die Funktion der virga sanguinea erklärt, muss ihr die Bedeutung zugekommen sein, dass die Berühr ung eines Körpers mit dieser virga die schlimmen Mächte diesen Körper nicht weiter beeinflussen lässt, diese Mächte vielmehr ab hält und bannt. Damit deckt sich auch die Wirkung der di aver ( 106) Pauly-Wissowa, R . E. s. v. haruspices Sp. 2459. . ( 107) TAULIN , a . a . 0 . Sp. 2464 . 400 Rudolf Düll tentes, der das Böse vertreibenden Gottheiten die im Prodigialkult. ihre Stätte haben (108). Die Priesterschaft, die in unserem Ver fahren diese Zauberrute anwendet, soll dies sichtlich zu dem Zweck tuu , die schlimmen Mächte, die in dem prodigium wirken , von den Uebertritt auf andere abzuhalten und zu bannen, was besonders deswegen Sinn hat, weil die Entweihung des Bodens, die Besude lung von Haus und Gemeinde und die Befleckung aller derjenigen , welche sich des portentum zu bemächtigen haben , eine Rolle spielt . Diese Funktion erscheint im Sinn der Erklärung der virga san guinea bei Plinius zweifellos als die primäre und wesentliche ; dass man die Zauberruten letzten Endes noch zur Geisselung des Mis setäters verwendet hat, bildet wohl die Ueberleitung vom Beschwö rungsritual zum Exsecrationsverfahren und bringt zugleich eine Parallele zum Kriminalrecht, dessen virgis caedere in ältester Zeit entsprechend dem Sinn der Todesstrafe als Dedikation an die Got theit (109 ) wohl ebenso sakral zu deuten sein wird. Die Auslieferung des parricida im culleus an die infernalen Ge walten ist schon alter Vorstellung eigen , wie wir schon aus Plautus Pseud . 229 mit 214 ersehen können : der Kuppler Ballio droht an der letztgenannten Stelle seiner Sklavin Phoenicium , die Oeltran sporte im culleus veranlassen soll, wegen ihrer Lässigkeit im Scherz, er werde sie Tags darauf im culleus ins Bordell schaffen lassen, womit er deutlich auf die culleus- Strafe anspielt (culleo. . . depor tere in pergulam ). Auf diesen Gedanken lässt Plautus den Kuppler am Ende seiner Rede zurückkommen (v. 229), wo dieser nun droht: cras. . . poenicio corio invises pergulam . Damit meint er zweifellos wieder den culleus, wie denn auch der von Cic. ad Her . 1 , 13, 23 gennante Gesetzeswortlaut von obligatus corio " spricht und Juvenal sat. 13 , 154 das corium bovis mit der Säckungsstrafe ausdrücklich nennt (deducendum corio bovis in mare... cum quo clauditur... simia). Plautus will daher auf den roten Sack anspielen, d . h , entweder einen Sack , der wirklich diese Farbe aufwies, was in Anlehnung an die sanguineus- Qualität der Unterirdischen durchaus möglich wäre, oder aber, was wahrscheinlicher ist, in übertragener Bedeu tung auf den verfluchten, den inferi geweihten culleus. Mit der An spielung, die Sklavin werde in diesem Sack ins Bordell wandern, (108) Thulin , a . a. 0 . Sp. 2464. (109) MOMMSEN, Röm . Strafr. 901 ff. Zur Bedeutung der poena cullei im römischen Strafrecht 401 ist ohne Zweifel in v . 229 auf den culleus von v . 214 zurückge kommen . Wohl keineswegs ist dabei aber an die Sklavin selbst gedacht, etwa an Schläge, die zu blutigen Striemen ihrer Haut führten (110), denn von Strafe anderer Art als Ausführung der Drohung, sie ins Bordell zu schicken, ist nirgends die Rede. Dazu kommt noch in Betracht, dass der Kuppler als guter Kaufmann nur eine körperlich intakte Person für den beabsichtigten Zweck nutz bringend verwenden kann . Hier scheint anstelle des sonst üblichen u sanguineus " die gleicher Vorstellung dienende Bezeichnung “ poenicius ” zu stehen , vermutlich auch wegen des Wortspiels in Bezug auf Phoenicium , den Namen der Sklavin (cras , Phoeni cium , poenicio corio invises...). Jedenfalls ist poenicius zur Bezeich nung der natürlichen Leder-oder Hautfarbe nicht gebränchlich und die Deutung, dass etwa gerade Oel in roten Schläuchen verwahrt worden wäre, im Ernst nicht zu erörtern . Eine starke Stütze un serer Ansicht ist zudem der Umstand, dass poenicius im Sakralkult gerade in Verbindung mit Zauberformeln bezeugt ist, vgl. Ovid ., amor. 3, 7 , 29 : . . . num misero carmen et herba nocent, sagave poe nicea de fixit (gezaubert !) nomina cera. Man beachte in diesem Zu sammenhang auch die vielgedeutete u rubra " canicula bei Horaz, serm . 2, 5 , 39 im Licht der Berührung des Siriuskults mit dem von Hecate und Anubis (111 ). IV Zusammenfassung . Nach den Feststellungen unserer Untersuchung lassen sich im Prodigialverfahren der poena cullei im wesentlichen drei bzw . vier Abschnitte unterscheiden. Sobald feststeht, dass der Angeschuldigte des parricidium wirklich schuldig ist, folgen aufeinander : der Akt der Isolierung, dann jener der Beschwörung der in dem portentum zum Ausdruck gelangten verderblichen infernalen Gewalten , dann der Verfluchung (Exsecration ) und endlich jener der Adsignation an die Rache -und Vergeltungsgottheiten der Unterwelt zwecks Be (110 ) so GEORGES, Lat.-deutsches Wörterb . 8 . v . poenicius. (111) s. W . GUNDEL, Sterne und Sternbilder iru Glauben des Altertums und der Neuzeit, 1922, 277, 218 . 402 Rudolf Düll strafung des Missetäters. Um diese Akte gruppieren sich die sämt lichen überlieferten Zeremonien . Dem Isolierungsakt gehören an das Anlegen der Holzschuhe und das caput obnubere, sowie der Säk kungsakt als solcher, dem Beschwörungsakt die Verwendung der virgae sanguineae, dem Exsecrationsakt und dem Adsignationsakt die Beigabe der Tiere in den culleus sowie die rituelle Beförderung des culleus zum Ort der endgültigen Exekution . Mit der letzten Förm lichkeit ist, wie wir oben gesehen haben, höchstwahrscheinlich ein Sühneopfer verbunden, zu dem die zwei boves atri verwendet werden. Wahrscheinlich ist, dass wenigstens die genannten Hauptab schnitte schon alter Zeit angehören . Denn der mit der Säckungs strafe verbundeneGedanke der Isolierung, Beschwörung, Verfluchung und Adsignation an die rächenden Gottheiten lässt sich mit dem alten Prodigialkult aus etruskischer Quelle recht wohl vereinen . Dazu passt, dass uns die erste Culleusprozedur in Verbindung mit Tarquinius Superbus überliefert ist und religiöse Verfehlungen zum Gegenstand hat. (vgl. die Stellen bei Val. Maximus und Dio nysius oben S. 271). Besonders die Betonung des Gedankens der rächenden Furien hat im etruskischen Kult bereits die kräftigste Wurzel (112). Doch scheint die Ausgestaltung der Symbolik im Ad signationsverfahren erst späterer Zeit anzugehören, denn es fehlen hiezu Belege für die vorgracchische Periode, was wohl kaum als Zufall angesprochen werden kann. Man hat in älterer Zeit die ani malia prodigiosa als rein vorbedeutende animalia gewertet ; ihre Verbindung mit der Säckung ist offensichtlich , übereinstimmend mit den für die ältere Zeit fehlenden literarischen Belegen hiezu , eine spätere künstliche, die Symbolisierung betonende : die Tiere werden nun ad hoc mitgegeben , um das Vergeltungsverfahren durch die entsprechenden Attribute an die unterirdischen Vergeltungsgott heiten äusserlich sichtbar zu unterstreichen . Weil diese Tiere als Attribute der infernalen Rachegottheiten deren Art symbolisieren , dazu als monstra dem monstrum als Symbole der rächenden Ge walten gewissermassen an die Sohlen geheftet werden und damit den Schrecken und die Grausamkeit der Prozedur widerspiegeln , konnte sich die Version des Dositheus der Outorgoria bilden , die dazu durch römische Gedankenverbindungen , wie pestis et furia, wie (112) WASER , a . a. 0 . 8. v. furiae 308 , 309; MOMSEN , Rön . Gesch . I, 180 . Zur Bedeutung der poena cullei im römischen Strafrecht 403 sie gerade in Bezug auf das parricidium gebraucht sind (vgl. oben S . 299 ff.), befestigt sein mochte. Die Erklärung des Dositheus ist , wie sich gezeigt hat, nicht aus dem Charakter der vier Tiere an sich , sondern unter Berücksichtigung der Stellung dieser Tiere zum Furienkult brauchbar . Das Pompeische Gesetz hat die sakrale Natur des bisherigen Säckungsverfahrens beim parricidium durch Anwend barkeit der Strafbestimmungen des Cornelischen Gesetzes aufge hoben, aber anscheinend dem iudicium domesticum volle Bewegungs freiheit im bisherigen Sinn belassen (113). Diese alte Uebung hat nun Augustus wieder allgemein gefördert. Dies würde damit über einstimmen, dass wir gerade von Augustus als grossem Reformator im Sakralwesen wissen : er hat nämlich eine grosse Reihe ausser Uebung gekommener Zeremonien nachweislich wieder aufnehmen lassen (114 ) und insbesondere auch im Larenkult, der mit unserem Verfahren ja in innigem Zusammenhang steht (115 ). Die ersten Be richte über Tierbeigaben der Prinzipatszeit finden sich wohl aus der Zeit des Tiberius in den Werken des bald nach Tiberius ver storbenen älteren Seneca ( contr . 5 , 4 ; 7 , 1, 23) ; von Kaiser Claudius wird überliefert (Sueton, Claud . 34), dass er in aller Oeffentlichkeit die Parrizidienstrafe zur Exekution bringen liess und für die gleiche Zeit wird wieder das schon bei Livius erwähnte Exsecrationsver fahren genannt. (Sueton , Claud . 12 ). Nach dem Dargelegten dürfte die grösste Wahrscheinlichkeit bestehen, dass Augustus in seiner Sakralreform die culleus-Strafe in dem Sinn, wie wir sie von Mo destinus D . 48 , 9, 9 pr. geschildert erhalten und wie sie Dositheus veranschaulicht, ausgestaltet hat. Möglich ist dabei auch , dass auf Kaiser Claudius, der als Etruskerfreund und Reformator der Haru spizin und damit des Prodigialkults überliefert wird (116 ), gewisse Ausgestaltungen der augusteischen Reform zurückzuführen sind . Fest steht, dass sich ein Senatsbeschluss vom Jahr 11 n . Chr. jedenfalls mit der poena parricidii befasste, vgl. D . 29, 5 , 13 : eos, qui parri cidii poena teneri possunt, semper accusare permittitur eodem senatus consulto . (113) Hitzig in Pauly-Wissowa, a . a . 0 . (114) Wissowa, a . a . 0 . 74 ff. (115 ) Wissowa, a . a . 0 . 77 , 173 . (116 ) Thulin , a . a. 0 . Sp. 2435 . 404 Rudolf Düll So steht im Mittelpunkt der wichtigen Reformgesetzgebung zur poena cullei wohl derjenige, der als Reformator des Kultes und als Umbildner der römischen Staatsverfassung gefeiert wird . In letzterer Beziehung knüpfte er an die Idee des Cn . Pompeius vom princeps senatus an und verstand sie mächtig auszubauen (117 ) ; hin sichtlich des Pompeischen Parricidiengesetzes aber räumte er mit der Humanität der ausgehenden Republik im Kriminalrecht auf und kehrte zu den alten Kultgebräuchen der procuratio prodigii zurück. Zugleich rückte er durch Ausgestaltung der Tierbeigaben in den Mittelpunkt des Verfahrens sichtbar die sakrale Vergeltungs strafe, indem er dem Vergeltungszweck symbolische Ausdrucksformen gab . Der parricida soll nicht nur isoliert, verflucht und aus dem Staat wie ein beliebiges anderes portentum entfernt werden , sondern er wird den rächenden Geistern der Unterwelt in aller Form adsig niert, damit diese Rache und Vergeltung für das Verbrechen üben . Dadurch, dass die Exekution in dieser Weise mit den Tierbeigaben vor sich geht, kommt zugleich ein gut Teil der ihm innewohnenden Abschreckungsqualität zur sichtbaren Entfaltung. Das Verfahren nähert sich, obwohl es streng Prodigialakt ist, damit langsam der Kriminalstrafe. Schon Hadrian hat mit seiner Konstitution (D . 48, 9 , 9 pr.) die Grenzen verwischt, desgleichen die klassischen Juristen, die das parricidium rein kriminal ahnden (Paul. sent. 5 , 24). Die Wiederaufnahme des alten Prodigialkults durch Konstantin (Cod. Th. 9 , 15, 1) konnte den ursprünglichen Charakter in der nun emporstrebenden christlichen Welt naturgemäss nicht mehr lange Zeit rein wahren und der Sinn des altrömischen Rituals musste namentlich im Osten mehr und mehr verloren gehen. Wir sehen ihn auch von Theophilus in der Institutionenparaphrase nicht mehr klar erkannt, denn er entfernt sich von der richtigen Deutung der Tierbeigaben noch weiter als Dositheus, bei dem man deutlich sieht, dass er der historischen Auffassung noch näher steht. Die auf beide Autoren zurückgehende herrschende Ansicht über die Beigaben hat sich damit als unhaltbar erwiesen . Unser Problem zeigt die innige Verbindung von ius und fas im römischen Recht, die besonders in diesem Prodigialverfahren zu Gunsten des fas in noch sehr später Zeit lebendig blieb . Wenn ( 117 ) EDUARD MEYER, Caesars Monarchie und das Principat des Pompeius 5 . Zur Bedeutung der poena cullei im römischen Strafrecht 405 wir bedenken, dass noch zur Zeit der grossen Juristen die etrus kische Prodigialwissenschaft öffentlich gelehrt wurde (118 ), dass sie unter Konstantin und seinen Nachfolgern trotz der Fortschritte des Christentums nicht ganz verschwand (119), ja , dass Teilerschei nungen des alten Kults im Westen noch bis ins 7. Jahrhundert lebendig geblieben sind ( 120), so ergibt sich die überraschende Tatsache, dass das römische Recht seine sakrale Wurzel, die es in ältester Zeit aus etruskischen Quellen übernahm , bis zum Untergang der römischen Weltmacht nicht gänzlich abgestreift hat. In der langen Entwicklungsgeschichte des römischen Rechts steht bis zu Ende die poena cullei als rocher de bronce des alten fas und ist noch mit einem Teil ihres ursprünglichen Rituals, besonders dem Adsignationsakt, der Gesetzgebungskodifikation Justinians in ihrem strafrechtlichen Teil eingegliedert. Die Sonderstellung dieser Strafe im System war wohl noch den Byzantinern bewusst, indem sie den Charakter der sollemnis poena verneinten (I. 4 , 18, 6 ); die klare historische Erkenntis des Verfahrenszwecks ist ihnen aber, wie gerade die Erklärung der Tierbeigaben bei Theophilus zeigt, fremd geblieben . Der Werdegang der poena culleiaus etruskischer Kultvorstellung lässt uns endlich diese sakrale Prozedur in der antiken Welt als Sondererscheinung würdigen. Wenn angenommen wird , dass die Säckungsstrafe Parallelen ausserhalb Italiens in der Antike auf weise (121), so muss diese Ansicht mit grösstem Vorbehalt entge gengenommen werden. Denn die altpersische Oxáqevois, auf welche man sich beruft und die uns z . B . bei Plutarch Artax. 16 anschau lich geschildert wird , enthält nicht die geringste Spur des reli giösen Grundcharakters der Säckung, sondern bedeutet eine qual volle Marterung und unterscheidet sich sehr wesentlich von der isolierenden Natur der culleus-Strafe ; dass uns Plutarch (de mul. virt. 19 i. f.) von einem wirklichen Säckungsverfahren der Kyrenäer gegenüber dem Tyrannen Leander berichtet (122), welches in die Zeit der mithridatischen Kriege fällt, beweist ganz und gar nichts (118 ) THULIN , a . a . 0 . Sp. 2435. ( 119) THULIN , Sp. 2436 . (120 ) Thulin , a, a. 0 ., Wissowa, a. a. 0 . 549. (121) SCHRADER, a . a. 0 . 767 ff. ( 122) SCHRADER , a . a . O . , BRUNNENMEISTER , a . a . 0 . 185 . 406 Rudolf Düll für eine selbständige Entwicklung dieser Strafe ausserhalb Italiens, deutet vielmehr auf Rezeption, zumal ja Kyrene bereits geraume Zeit vorher in die römische Einflusssphäre gelangt war (123). Die bis ins 18 . Jahrhundert bezeugte culleus- Prozedur in Deutschland in den Ländern sächsischen Rechts (124) ist Folge der Rezeption des römischen Rechts (125 ) ; ihre verhältnismässig frühzeitige Er wähnung dürfte mit der Bekanntschaft mit den Schriften des Isi dorus, der die römische Säckungsstrafe schildert, zusammenhängen (126 ). Die altdeutsche Strafe des Ertränkens des Verbrechers im Sack zeigt jedoch schwerlich Verwandtschaft mit der poena cullei (127), ebensowenig wohl die Beigabe eines Hunds zur Exekution am Galgen (128 ), weil in diesen Fällen der wesentliche Zweck der römischen Säckung, Isolierung und Entfernung aus dem Staatsge biet mit dem Entzug des Begräbnisses gefehlt hat. Auch der gele gentlich erwähnten Säckung in Verbindung mit dem Feuertod in deutschen Rechten liegen wohl christlich -römische Grundvorstel lungen zugrunde (129). Demgegenüber gibt uns die culleus-Strafe einen sehr lehrrei chen Einblick in den sakralen Grundcharakter der etruskisch -rö mischen Entwicklung. Wir haben gesehen, dass noch in der repub likanischen Zeit vom parricida im Sinn des Hochverräters gespro chen wird, so deutlich, wenn Cicero in Phil. 4 , 2 , 5 den “ parricida patriae " erwähnt, desgl. pro Planc. 29, 70 oder Phil. 2 , 7 , 17, (parricidium patriae), womit auch die Wendungen bei Tacitus, be sonders “ hostis et parricida " übereinstimmen (z . B . hist. 1 , 85 , 18 ; ann . 4 , 34, 16 ; 15 , 73, 11. Dieser inneren Verbindung entspricht auch die Strafe , die als Säckung bei parricidium und perduellio auftritt, so schon in der ältesten Periode, wo der Reli ( 123) Vgl. hiezu OLIVERIO , La stele di Tolomeo Neoteros Re di Cirene 73 ff.; WENGER, Festg . f. Salv . Riccobono 529 ff. (124) Vgl. auch Grimm , Deutsche Rechtsaltertümor, 4 . Aufi. Bd . 2 S . 278 ff.; man rezipierte auch die Tierbeigaben und setzte anstelle des Affen die Katze, s . Grimm S. 280 . (125 ) GRIMM, a. a. 0 . 280 . (126 ) GRIMM , 280. (127) So SCHRADER , a. a . O ., BRUNNENMEISTER 185 ; über die Sitte vgl. GRIMM , 187 ff. (128) Grimm , a, a, O . 261. (129) vgl. hierüber Grimm , a.a. 0 . 280, 284 ff. Zur Bedeutung der poena cullei im römischen Strafrecht gionsfrevler sie erleidet, und in der Hochverräter vollzieht (130). Die wohl nur bei besonders schlimmer rakter; bei parricidium im weitesten mord ist, kam 407 Gracchenzeit, wo man sie am Säckungsstrafe erscheint hier Ausartung mit Prodigialcha Sinn, das nicht Verwandten sie nicht in Betracht, weil Valer. Max . 1, 1, 13 die poena cullei ausdrücklich mit Religionsverletzung und Verwand - tenmord allein in Beziehung bringt: par vindicta .... violatio paren tum ac deorum . Andererseits freilich bestehen kaum Bedenken, für das parricidium im Sinn von Cicero , de leg . 2, 9, 22 (sacrum sa crove commendatum quiclepsit rapsitque parricida esto ) die Säckungs strafe in besonders schweren Fällen anzunehmen . In der bei der poena cullei überlieferten alten Verbindung von parricidium und perduellio schimmert wohl der unitarisch -sakrale Charakter des ältesten römischen Strafrechts mit durch. Denn das öffentliche Strafrecht kannte zunächst überhaupt nur zwei Verbre chen, parricidium für den privaten Bereich und perduellio für den öffentlichen (131). Das älteste öffentliche Strafrecht kannte ferner nur eine einzige Strafe, die Todestrafe (132 ). Eine Steigerung der alten Vorstellung der öffentlichen Strafe als sakraler Opferung an die verletzte Gottheit (133) bedeutete es, wenn man für wichtige Gebiete , wolche die religiöse Vorstellung besonders nahe berühren, die Gottheit selbst die Vergeltung vornehmen lässt, indem man ihr den Uebeltäter lebend ausliefert. Das bewusste schädigende Handeln gegen das eigene Vaterland (perduellio) und das vorsätzliche Töten eines nächsten Angehörigen (parricidium ) erschien vom Gesichts punkt der religio den Römern als Handlung ganz gleicher Art, gleich verabscheuungswürdig und gleich unglaublich , sodass man nach alter Sitte den monstrosen Täter lebend im culleus den Ra chegöttern zur Strafe ausliefern musste. Dieser Gedanke ist schon für die Königszeit bezeugt, er war unter den Gracchen lebendig , wo wir Säckung für perduellio , hier erstmals mit Tierbeigaben , erwähnt finden, und er lebt in der Vorstellungswelt der späten Republik und des Prinzipats, wie Cicero und Tacitus beweisen . Die Idee der Auslieferung des lebenden Verbrechers an die Gottheit (130 ) Beides sind Fälle der perduellio , vgl. MOMMSEN, Strafr. 567 ff. (131) MOMMSEN, a . a . 0 . 526 tl. (132) MOMMSEN, a . a . 0 . 906 . (133 ) MOMMSEN, Strafr . 899 ff. 408 Rudolf Düll - Zur Bedeutung der poena cullei im römischen Strafrecht zur Strafe ist auch in der Prozedur gegen die unkeusche virgo Ve stalis leitender Gesichtspunkt geblieben (134) und auch hier sehen wir für die älteste Zeit die poena cullei in Uebung (135 ). Jede culleus-Prozedur beherrscht dieser sakrale Vergeltungsgedanke, der in späterer Zeit durch die Tierbeigaben noch besonders unterstri chen wird . Abgespalten im parricidium wirkt so die alte poena cullei bis in die byzantinische Zeit und darüber hinaus als lebensfähige, wenn auch ihrem Sinn nach unter christlicher Aera nicht mehr erfasste Ausstrahlung altrömisch -etruskischen Sakralrechts. (134) MOMMSEN, a . a . O . 927 ff. (135 ) Voigt, XII T. I, 257 . J . B . TAYER PROFESSOR OF LAW IN TAE HARBARD UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (U . S. A .) ERROR IN SUBSTANTIA IN THE PANDECTS Roma - II SUMMARIUM Errorem in substantia apud iurisconsultos Auctor examinat. Varia exempla variosque casus ostendit. Interpolationes a Iustiniani compilatoribus in Digesta introductas relevat. Iuris iustinianaei rationem indagat. The event which we are commemorating has always been thought to reflect more glory upon those who supplied the material than upon the actual authors of our miscellany. This judgement is undoubtedly correct in so far as the work of compilation is thought to be less dignified and respectable than that of deciding legal causes; but the question remains as to the relative skill with which Justinian 's commissioners fulfilled their task. Although they were thoroughly inadequate to perform the functions of the jurisconsult if we are to judge by their attempts in such texts as 18 , 1, 57, 3 ; 22, 3,25, the purpose of these lines is to defend them from the charge of the same incompetence in the discharge of their main duty . In recent times the tendency has been to insist upon the multa et maxima transformata of Const. Tanta 10 and to ignore the infor mation in id . 15 , in spite of the fact that as the Byzantine talents obviously did not lie in the direction of originality exaggeration is more to be expected in the former proposition than the latter. The point of g 15 cit. may be better appreciated if the nature of the material is considered in connection with the tremendous abbre viation described by Justinian. The classical writings did not con tain abstract rules and exceptions summarizing the law , which would have been perfect for the compilers' purposes, but consisted almost entirely of separate cases real or hypothetical. The maximum of information could thus be imparted in the minimum of space only by an indefatigable use of the argument a contrario and by avoiding all obvious typical cases in favor of those on the border line. A study of the thirty - third book of the Digest has led to the 412 J. B . Tayer conviction that this was in fact the compilers' method . As the re sults of the investigation may appear elsewhere and as space forbids an extended discussion of many different subjects, two possible examplesmust suffice to illustrate the contention . In 33, 9 , 7 we are told that omnis mea penus carries anything destined for use, pre sumably as opposed to alienation . This proposition is not helpful except upon the permise that it would not be true of some other form of words, but given such a premise with the aid of the argument a contrario it becomes enlightening. Penus alone, referring to what is to be consumed by the testator and those circa eum , 33, 9, 3 , 6 , omnis mea also includes what is to be consumed by those not circa eum because it gives more than mea alone, which would refer to the testator himself (1 ), and less than omnis alone,which would give what is for sale, cf. 33, 9, 4, 2. A case where the compiler seems to have avoided stating the main rule except by implication and has given us a large number of passages containing exceptions to show the extent of the rule is that of the stipulation for a penalty. It seems too clear for argument that if one promises a slave worth 100 and in case of non payment 100 or less as a « penalty » , the latter sum is owed cumulatively, for otherwise what it specifically described as a penalty gives nothing more than could anyway have been claimed. Doubt is possible only if the sum is much greater than the value of the slave, e. g. 200 ; but it involves an unwarrantable disregard of the terms of the pro mise to assert that when the creditor stipulated for 200 as a « pe nalty , he meant only 100 . It is so obvious that as a rule a pe nalty is owed cumulatively that the compiler did not think it necessary to be stated except by implication in 45, 1, 38, 17 i. f., but as penal stipulations are as far as possible strictly construed , he included a large number of passages containing exceptions to the rule . Failure to observe that according to the principle of Const. ---- - - (1) For this effect of meus cf. 34 , 2, 25 , 6 , the relation of which to id . 7 is obvions if the ancient forms are recalled . Vestem do necessarily restricts the class to those owned at the date of the will, G . 2, 196 , so that meam can only refer to the use ; but vestem dato means those owned at the death so that meam need only be a reference to the present. In the case of penus which is daily diminished and disappears in a year, 33, 9, 4, 2, the criterion of 25 , 6 cit. is preferred to one whereby the bequest can never be wholly valid . Error in substantia in the Pandects 413 Tanta 15 the facts of the cases are not reproduced in vain may have caused the commentators to mistake the exceptions for the rule (2 ). The inadequacy of such summary discussion of these two topics is fully realized : they are only intended to illustrate the hypothe tical method of the compilers. The immediate task is to use this hypothesis upon the group of texts dealing with so called essential error, which have since Savigny given rise to such endless di scussion (3). It is hoped that if the passages are approached with (2) Apparently the only authors to whom this reproach is inapplicable are KERSTEN cit. VANGEROW , Pand . 3 , 344 , and in part Perozzi, Ist.2 2 , 175 . The ar gument can here be indicated only in the briefest form . The passages denying cumulation for a promise dare or facere all seem to depend on the fact that the penalty will be restricted if it can be referred to some extra advantage for which there would otherwise have been no legal remedy. The questions has occurred to nobody but KERSTEN why three of the passages (17, 2 , 41 ; id . 42 ; id . 71 pr.) should deal with the actio pro socio , which had the beneficium competentiae. If it was doubtful whether the rest of the debt was not wholly discharged , cf. ar bitror in 17, 2,63, 4, it seems a safe assumption that the deductio ne egeat was available. The « penalty » was thus interpreted as a guaranty against all such defenses, just as in the case of a master promising a penalty for non payment of a « peculiar » debt. Similarly in 19 , 1, 28 the significance of the facts has gone unobserved ; the facere for which the penalty was stipulated was neither promised as part of the price nor by stipulation, but by a separate pactum adjectum or afterthought (vendidit et convenit), whence Julian assumed that the parties re garded it (mistakenly ) as otherwise unenforcible, cf. the innominate contract in C . 2 , 3 , 14 . In any praetorian stipulation the basis of the promise is necessarily the interesse and the penal element lies in the acceleration or the certainty of what was before a disputed claim , 2, 11,5,1; 2; 44,4,4,7. The only other relevantpassages dealing with promises of something declared to be a penalty (in wich the word poena occurs) seem to be those of a pact not to sue, where there is no question of cumulation because breach of the pact never renders the promisor liable to pay anything but only prevents him from suing. It is more likely that the penalty is a price for permission to sue successfully than owed for act which can do the promisee of the penalty no harm and the promisor no good, cf. 18 ,7,6 pr. If, ho wever, the pact concerns a large or indefinite number of claims, the penalty is incurred though it is broken unsuccessfuly, 45, 1, 122,6 ; for the same sum cannot be meant as a price for successfully bringing an infinite number of suits for in definitely various amounts. (3 ) References to the literature since SAVIGNY will be found in WINDSCHEID KIPP. Pand., § 76a, and the Index Interp. to the varioustexts. Of the older wr:ters Noodt, Op. 4 . 101 (ad Lib . 18 Tit. 5 ), and AVERANIUS, Interp. Juris. 1, 19, deserve mention . 414 J. B . Tayer the suptilis animus recommended by Const. Tanta 15 the result may reflect credit both upon the compilers and the classical jurists . The premise being that where a case is stated first the argument a contrario is to be drawn for other cases, but where the rule comes first we are to recognize a general principle , our starting point is obviously 19, 1, 21, 2. Although since Cujas this has been supposed so difficult that the most desperate emendations have been sugge sted, taken by itself it seems perfectly sensible . It seems to be generally admitted that analytically or logically a sale or other transaction is not void merely because of a mistake as to the na ture of the material of the object agreed upon, a proposition which may be taken as proved by Zitelmann 's great work (4). There is no need to suspect even the first three words of 21, 2, for Paul cannot have failed to discuss the point in this book, cf. 18 , 1, 1, 2 ; id . 34 pr. Pernice' s objection (5 ) to quamvis does not appear cogent. it may quite simply be referred to the condiction of 18, 1, 41, 1 : i. e. although the sale is valid , the buyer is not without a remedy (sc. for an innocent misrepresentation ). To this general proposition an example is appended which possesses the desired quality of being nearly the most extreme which is conceivable , for the mensae ci treue were passionately desired and worth more thant their weight in gold for the material alone (6 ). Nothing could thus be more un fortunate than the suggestion of Leonhard (7) that the tables were carved or belonged to a famous man : in fact Blümner (8 ) gives a row of citations to show that they were manufactured with the (4) The logical truth of the proposition is admitted by HANAUSEK -WIND SCHEID , loc. cit. n . 7 , and was clearly perceived before ZITELMANN by SAVIGNY, System , 3. 300 /1. It is also specifically stated by Ulpian in 13, 7, 1, 2, to the reason wherein too little attention is usually paid , cf. WINDSCHEID cit., n . 10. (5 ) Labeo 2 , 2, 1, 248 n . 2. (6 ) It is true that the text is inapplicable to sales of raw material, but an ar gument for the validity even in this case seems permissible from 46, 3,50 cit. infra n . 29. The generality with which the case is stated in 18, 1 , 9 , 2 also indicates a contrario that there is no distinction for a seen lump of copper ; apprehension by some sense appears to be all that is necessary for consent in corpore, cf. 18, 1 , 11 pr. The reason assigned in 13 , 7 , 1, 2 would be conclusive, if wemake the not very daring assumption that raw metal was there presupposed . (7) Irrthum ", 2. 98 . (8 ) Röm . Privatalt., 125 n . 1. Error in substantia in the Pandects 415 sole purpose of preserving their natural condition . Our text thus stands for the proposition that no error, however essential, as to the material can vitiate the transaction for lack of consent, because the material is only a quality of the object . It is, then , not sur prising to hear that the same is true for the case of an object of brass or copper thought to be gold, 18, 1, 45 ; 45 , 1 , 22, which is easier in that Leonhard's view is here permissible that the thing was partly desired as an objet d ' art and furthermore in that auri chalcum « was highly prized among the ancients » ( 9 ). Our hypo thesis that there was a sensible scheme in the compilation requires examination of these two passages to refute the charge ofrepetition . The function of 45 cit. is to give us details as to the liability for the warranty, which is mentioned only in general terms in 21, 2 cit.(10). The example of the brass vase is retained to avoid any confusion created by the preceding passages (18, 1, 9, 2 ff.; id . 41, 1), which might have led to a distinction between a mistake as to the material and one as to such an obvious « quality » as is reported for the clothes . A restriction is added by 22 cit. to the effect that in stipulations the debtor is liable only for dolus. The reason is in general obvions; the stipulation for the golden vase is framed by the creditor and the promisor simply answers spondeo, making no reprentation or dictum (11). ( I It would now be possible to begin on the real problem which is presented by the apparently contrary passages, were it not for the fact that the genuineness of the main texts, 45 and 21, 2 citt., has been attacked from another angle by Haymann (12), who con vinced Partsch (13). Although this thesis has already been rejected (9 ) The quotation is from HARPER'S Latin Dictionary. (10) Cf. 4 , 3 , 37 cit. infra n . 16 . (11) On the nature of the transaction in 22 cit. cf. SAVIGNY loc. cit. n . s. who realizes that it was not purely gratuitous. If the stipulation had embodied a promise to sell and the seller had made an innocent misrepresentation , the actio empti might be available , but Paul's point is that there is no liability ex stipulatu for this dictum , cf. 22, 1, 4 , 1. If the creditor had promised a facere in return for a vase innocently alleged by the debtor to be golden , he might be permitted to escape liability on renouncing his claim for the vase. All that is said in 22 cit. is that the stipulation for a golden vase does not by itself imply a dictum by the promisor that it has that quality. ( 12 ) Haftung des Verkäufers, 107 ff. (13) Z . S. S. 1912, 611 ff.; cf. also SIBER Röm . R . 2, 201. J . B . Tayer 416 with good reason by Stintzing (14) and Monier( 15 ), some further objections may be excused because they involve illustrations ofthe refinement of the classical distinctions and the care which they were reproduced by the compilers. It does uot seem to require much argument to indicate that a priori a seller of a copper vase which he (innocently) alleges to be gold and for which he receives a corresponding price is required by bona fides and common sense to make good his dictum . Haymann 's error consists in ignoring the leading text on the point, 18 , 1, 43 pr., which cannot be restricted to the aedilician edict as it mentions the sale of a house. As re gards innocent misrepresentations the question is whether the seller as a reasonable man should have perceived that they caused the buyer to pay more. Certain dicta are calculated almost necessarily to have this effect (hoc ipso pluris vendidit); and the statement ex press or implied that a thing is of gold is undoubtedly in this ca tegory. The implication from the end of 43 cit. disposes of one of the main foundations of Haymann' s theory, the supposed conflict between 19, 1, 13, 3 and 21, 1, 19 pr. An assertion that the slave is honest and good is of the type which usually does not cause the buyer to pay more , and will subject the seller to liability only if it actually has this effect (caro vendidit). If he obtains a noticeably higher price in consequence of his dictum the seller must realize that it has become serious and assumed the quality of « teme rity » (16 ). Haymann 's other chief point is the implied conflict between 13 , 3 cit. and the following $ $ 4 - 7 , which imply that the liability for false dicta is limited to dolus. Incidentally it may be noted that the beginning of $ 6 affords a strong argument against , him : the statement that « also in cases of this kind » dolum solere praestari implies that in other cases the liability is greater, for it ( 14 ) Krit. Vierteljahrschrift, 51, 557 ff. ( 15 ) Garantie contro les vices cachés, 134 ff. (16 ) What if the buyer, deceived by the seller's assertion that it is gold , pays the price of copper or less ? With this case in mind 4 , 3, 37 becomes quite expli cable : the actio empti presupposes that the object is not worth the price. Thus if the slave is described as good and honest, in which belief the price of a di shonest slave is paid , there is no damage from the point of view of sales ; and if the slave later maliciously destroys the buyer's property, the seller's only lia bility is ex delicto. Such damages are recoverable ex empto ( 18 , 1, 45) only « pa rasitically » Error in substantia in the Pandects 417 can never be less. The common feature of the cases evidently is that the misrepresentation concerns an accessory or incidental point, or what is called dolus incidens. The compiler has coupled the ar tiflcium with the peculium in $ 4 to indicate that the trade was an extra one unlike that in 18, 1, 43 pr. Moreover the dictum in $ 4 must be understood to have been of the same type as that in the preceding text, i. e . that the slave sold as a good cook was also a « good » weawer or had a « good and honest » vicarius. Here the innocently misrepresenting seller is not warned that his dictum is taken seriously by an unusually high price, which he may regard as justified by the undoubted excellence of the ordinarius as a cook . It would of course be different if the buyer explains that the extra amount is paid for the honesty of the vicarius, who then ceases to be an accessory. Finally the dictum must cause the buyer 's error: he may suspect the vice and the seller's reassurance may be so qualified as not to justify any reliance upon it. If the seller on being interrogated answers that the vice is absent « as far as I know », he is guilty of a celare not a dicere (17). In short an innocent misrepresentation was actionable ex empto or vendito only if the speaker ought to have realized that it caused the other party to give more or accept less than the actual value of the object. It is now time to turn to the passages which have caused all the trouble , viz. 18 , 1, 9, 2 - 11; id . 14 ; id . 41, 1, in the hope that ca reful attention to the context and use of the argument a contrario may illuminate them . As is well known, the first passage has recently been entirely eradicated by Beseler, who convinced Lenel and Lauria ( 18). The suggestion could hardly be more unsatisfactory : so unlike Tribonian is the distinction of 9 , 2 cit. that Beseler has to invent an umbratilis doctor as its author, and his own idea that Ulpian decided for nullity leaves a conflicl with Paul, Marcian , and logic. No attempt is made to explain why the seller is not liable for his dictum in selling the copper for gold . The problem is to discover what case was in Ulpian 's mind , and it is submitted ( 17 ) Thus is explained the etsi negavit clause of 19 , 1, 1, 1, claimed as a sup port by HAYMANN, op. cit. 116 . The immediately following case contains just such a guarded dictum . (18) Cf. Index Interp. 418 J. B . Tayer that the agreement concerned an absent object. This conclusion is indicated by the context : the preceding 9 pr. deals with an « ab sent » slave, and the following 11 pr. argues from the case of a buyer constitutionally unable to see the thing. The same result may be reached from another point of view : the case of 9, 2 cit. must be different from that in id . 14, which is introduced as a new subject, and yet there is no sense in holding the transaction more void if only one party is mistaken than if this is true of both . As soon as it is realized that the transaction was a « sale by de scription » of a species, the rationes dubitandi et decidendi begin to appear (19). The case is an intermediate one between that of misunderstanding or « Dissens » in 9 pr. where the buyer thinks of a different existing thing, and that of mistake of quality in 14 where he thinks of a present thing indentified by sight. When the seller offers « the lump of gold weighing ten pounds now in my top drawer » referring to a brass lump of that weight, or « the golden vase which I bought yesterday from Titius » ignoring the fact that the vase was brass, the question is acute whether the buyer consents . If with Marcellus we answer in the affirmative, the next case is that of the « horse now in the box stall » when a cow is there. Marcellus would doubtless have replied that his view did not apply where the noun was in correct, which denotes identity as distinguished from the qualifying adjective. Then the case is an offer of « the strong young ra cehorse now in my box stall » , which at the moment contains a feeble old carthorse . If the seller was really referring to the carthorse maliciously of through ignorance of its true qualities, Marcellus would presumably have held the sale valid and the seller liable for his dicta , which cannot have failed to elicit a higher price. Ulpian, however, was unwilling to go so far; if the description was innacurate in an « essential » particular he held the sale void for lack of an object just as if the « horse now running in the field » were sold and there were only a fox running there. There is no liability for the dictum any more than if the horse (19) Consultation of Williston , Sales, 2 ed., SS 224, 225 will in fact reveal that almost exactly the same conflict as that between Ulpian and Marcellus exists between the English and American courts, the learned author arguing in favor of Marcellus' view . Error in substantia in the Pandects 419 were dead instead of non-existent(20). Indeed where the object sold is clearly non -existent as in the case where a jar of good Surrentine wine is sold which turns out to be empty, the situation is hard to distinguish from the promise of a horse which has just died (21). The difference between an essential misdescription and a mere falsa demonstratio probably was drawn by Ulpian according to whether the seller had reason to suppose that the buyer was paying more in consequence of the quality, the same requirement which would render the seller liable for the dictum if the buyer had seen the object. If the nullity for error in substantia is thus . explained (22), there is no great difficulty in comprehending the distinction in favor of the acetum which has caused such discussion . There is no need to impute foolish philosophical distinctions to our author, who is simply pointing out that the word vinum covers acetum in so far as that is soured wine: wine spoiled by acor is no less wine than if it is affected by mucor. The compiler tried to make this doubly clear by inserting the exactly similar 18 , 1, 10 . The description contained no reference to the quality of the wine, and the result seems not only logical but just since one who buys merely « wine » (in jars ?)(23) without testing it or inquiring as to its condition may well be held to assume the risk of acor and mucor . The result of these conjectures may thus be summarized : (20) This theory is well exposed by RABEL, Grundzüge, 449 ff., who errs only in applying it to an object identified by sight, se contra 21, 2, 31. (21) Ulpian's case of the jar of unseen salad dressing sold as wine is very similar to Gardner v . Lane, 12 Allen (Mass.) 39, where specific barrels containing salt were sold in the belief that they were full of « Grade A mackerel » , cf . 18, 1, 41, 1, later to be discussed . (22) Material seems to be lacking for adequate exploration of the extent of Ulpian 's doctrine. Of the many questions which it presents one of the most ur gent is : what if the sale is of the « lump of copper weighing ten pounds now in my top drawer » which turns out to be gold ? However, there is no excuse for speaking of « relative nullity » , WINDSCHEID -KIPP, loc . cit . n . 9 i. f., when we are carefully told that nulla emptio nulla venditio est in 11, 1, cf. also emptionem et venditionem in our 9, 2. (23) Cf. Z . S . S. 1927. 209 n . 5 ; EHRLICH , St. Scialoja , 2 , 738 ff. The vinegar which a testator vini numero habuit is shown by the comparison in 32, 85 to be that which has turned sour without his knowledge. Whether or not the fact is known, the word vinum still applies to sour wine, cf . 35 .5 .3, and our sale is valid . If the seller knows it is sour he will be held as as in 19 , 1, 11, 5. 420 J. B . Tayer where there is a « sale by description » of an absent species Marcellus held the transaction valid if the noun was correct (massa auri, vas aureum ) subject to the ordinary liability for dicta or mis descriptions: Ulpian held that a false dictum in the technical sense rendered the transaction void for absence of consent, i. e., the object had not been identified for the buyer, whose mind is directed to ward something which is non - existent, but both Ulpian and Paul (in 10 cit.) construed the description very literally since the buyer does not trouble to inspect the object. In 18, 1, 11 pr. Ulpian supports his conclusion by the case of a blind buyer, who seems more clearly to accept only on condition that the description is correct, for his infirmity renders it unlikely that the is in this case assuming a risk or making a pure specu lation. Two questions immediately occur: what if he apprehends the object by another sense, what if he follows the advice of a a third party ? These possibilities cannot fail to have been distin guished by Ulpian, the remains of whose discussion are probably reproduced in the unduly abbreviated vel si . .. materiarum . The minus peritus is obviously the blind man's mistaken adviser, for the reesoning (non vidit) is quite inapplicable to him as a buyer. Eos thus refers to the buyer in 9 , 2 , and represents the end of the di scussion of consent and of the refutation of Marcellus. Vel si in materia erratur is apparently the compiler's reference to the imme diately preceding quotiens clause and a method of explaining to us that the case is the same as that in 9, 2 of an absent object, which in this case means not apprehended by any other sense (24 ). Smel. ling or tasting the liquid is certainly enough to identify it even if the blind buyer is unable to distinguish acetum from embamma, and the same seems true of handling the lump of copper. Thus 11 pr. means that in the case of a blind buyer, whether he relies on the seller's description or that of an unskilful adviser, there is no con (24) On the reading of the Basilica see LOTMAR, Krit. Vierteljahrschrift, 26 , 266, wo treats our text in some detail. Where the problem requires several cases to be distinguished and words are found which can be referred to these cases, such words should not be disregarded as glosses or inventions of the com piler merely because they are awkward or obscure. In view of the enormous abrid gment it would be more surprising if the compilers had been able to reprodnce in clear and elegant form an already closely reasoned original. Error in substantia in the Pandects 421 sent. If the blind man does not trust his own judgment based on some other sense, his consent is conditional on the accuracy of the description. This is only a way of describing the result: Ulpian' s point was that the object was not identified for him : he was thin king of a different species which happens to be non -existent. It is of course quite possible for him to be uncertain of the quality and regard the description as an assurance or guaranty on the part of the seller, which possibility causes the ratio dubitandi in the case of the minus peritus chosen as an adviser: it might be said that the sale was valid and the adviser liable in the actio mandati. Ne vertheless, once the buyer's doubts have been removed his condition is the same as if they had never existed In 18, 1, 11, 1 we encounter a distinction impossible to justify or even comprehend on the ordinary premise that the object was perceived (25 ). However, it seems quite clear that we are still in the topic of « sales by description » ; the following two texts deal with absence and presence of the buyer and the subject is abandoned only in 14 . The question of consent supposing the de scription to be incorrect has been finished and our text reverts to the case of acetum and the question whether or not the description is correct. The error in sexu thus means a misdescription in gender, and the question is one often encountered elsewhere (26 ). The rules there exposed are doubtless intended to apply here, so that if the seller offers « the three slaves (servi) whom I bought yes terday » , the buyer cannot complain if one or two are feminine, An ambiguity consisting in the word itself and therefore known to both parties causes the object itself to be equally uncertain ; the buyer is in effect contracting for a spes. If he does not demand further details, he must be supposed to be as indifferent to the sex of the servi as to any other quality not defined by this generic appellation . Such a sale is practically equivalent to the promise of three homines. It would be otherwise if all three were femi (25 ) Only a person unfamiliar with the Pandects could suppose that purely obscene considerations are involved, so KOHLER, Jh. Jahrb. 28. 277; even if they sufficed for an explanation. If sale were not void for a turpis causa, the conflict remains with 19, 1, 21, 2 and common sense : the sex of a beautiful slave seen by the buyer seems indubitably to be a quality. ( 26 ) Cf. e. g. 31, 45 pr. ; 32,81 pr., 1 ; id . 93, 3 ; 50, 16 , 101, 3 ; id . 163, 1 ; id . 204 . 422 J. B . Tayer nine or similarly if one woman was described as a servus, because the masculine plural is permissible only to avoid the trouble of saying two words where one may suffice. It is a variant of the second hypothesis with which our passage deals. As for the first case, the enim clause is cogent only if interpreted as meaning that a woman of any kind will satisfy the description. The reason must be in the double meaning of the word ; which commonly has a sexual connotation , but as is shown by 32 , 81, 1 in legal parlance refers to youth and is equivalent to puella (27). The objection re mains that an old married (and sterile ) woman would in any case not satisfy the description and yet Ulpian decides that the sex is enough. To this the answer is that the error is immaterial; there is no reason to prefer a virgin slave 80 years old who would cor respond to the description , to one of that age who lacks the quality in question . In other words virgo may connote at least two qualities of which one is « essential » (28), but its primary meaning alone without a certain age limit amounts to a mere falsa demon stratio . The result is that any female substantially corresponds to the description. If we give the compiler the benefit of the doubt and assume that there is a reason for the choice of a very equi vocal term , we obtain a contrario the interesting consequence that more than mere femininity is necessary if the sale is of the puellae quas hodie emi. Here the requirement of puerilis aetas (50, 16 , 204 ) exists, for the use of puella merely to denote the servile condition is extremely rare, that function being performed by the term ancilla . The sequence of thought yow becomes obvious : in logic the next case is that of a puer and accordingly we find it discussed, which phenomenon confirms the hypothesis of a careful purpose in the compilation. Here , however, the compiler hasmade a slight blunder in the attempt to convey the maximum of information in the mi nimum of words. The quia clause clearly implies that a sale of the puer « whom I bought yesterday » is invalid if the slave were a puella , and yet we are told that she is a mulier, who in no event can satisfy the description. The reason is not far to seek : the word (27) According to FORCELLINI the word was also sometimes used of fecundity, and by Christian writers even of men . Neither sense was common enough to de serve consideration here : the interpretation must be a usual one, cfr. 45 , 1, 110 , 1. ( 28 ) See 19, 11 , 15 , about to be mentioned. • Error in substantia in the Pandects 423 mulier is the compiler's reference to the case in the original of the plural pueri. We thus learn from mulierem that Ulpian followed the rule of 32, 81, 1, whereby tres pueri quos emi is satisfied if one or two are puellae but not if they are mulieres, and from the quia clause that puer in the singular is not satisfied by a puella. All this agrees excellently with 50,16, 204, whose first definition is not adopted here because it is purely generic in its application and our seller is describing a species. Our plural denotes the age alone and our singular also distinguishes the slave from a puella . The proposition for which 11, 1 stands is than that the buyer cannot complain if the object essentially corresponds to any natural or common meaning of an admittedly ambiguous word : he must be held to have known the ambiguity and thus his omission to inquire further shows in difference to the various alternatives. The question remains what if the buyer was in fact not indifferent, to which an answer has been left us in the closely connected 19, 11, 1, 5 . If the circumstances, among which is doubtless a very high price, are such as to put the seller on notice that a young and virgin slave was desired, the sale will be « resolved » as if it had been void for lack of con sent (29). This decision is informative on the question whether the Romans preferred the « will » or « declaration » theory of legal transactions. The mere fact that the buyer in fact cherished a false conception of the thing will not suffice to render the sale void , if this conception was unjustified by the terms of the offer. Il the buyer chooses to rely solely on the description , he must take the consequences unless dolus can be imputed to the speaker. In short 19, 1, 11, 5 contains an example of the declaration theory exactly analogous to 2, 15 , 12 ; 45, 1, 99 pr. i. f. (30 ). (29 ) The resolution of the sale is comprehensible only on the assumption that the case was like ours that of a sale by description, for if the buyer saw and agreed, he should be able only to claim damages as usual. If he did not see the woman , he never really agreed, and though the law disregards this absence of consent, his equitable remedy is modelled accordingly . There is no condiction for the price because the sale was formally valid . The mistake does not prevent the later passage of ownership in the woman, who is then seen by the buyer, though he fails to perceive her age, cf. 46 , 3, 50. (30) Though the involved topic of the will and declaration theories cannot be further discussed, something must be said of the passages which seem to con tradict the suggested interpretation of 11, 1 by holding that an obscure pact is 424 J. B . Tayer The next passage is 18 , 1, 14, wherewith we are clearly intro duced to another sphere, that of a present, fully identified object. Nevertheless the decision seems to depend on the same literal verbal interpretation to which we have been accustomed , cf. 18 , 1, 10 . The . usual difficulty is to justify the validity if the thing contains a little gold , which is thonght to conflict with 18 , 1, 41, 1, but ours is just the opposite , i. e, to reconcile the invalidity where there is no gold with 18 , 1, 45 and 19, 1 ,21, 2 . After what has been said the difference of 41, 1 cit. is clear, not only was the table there specifically de scribed as of solid silver (31), but the missing element was unseen as in 18 , 1, 9, 2 ff. Iu 14 cit. as usual the sense emerges only upon the supposition that the result is to be restricted to cases like the interpreted against the seller ; 2, 14, 39 ; 18, 1, 21; id. 33 ; 50, 17, 172 pr. Against these four texts three can be alleged where the ambignity is decided for the speaker, i. e. 18, 1, 34 pr.; 45, 1, 110, 1 (supra n . 27); 50, 16 , 125 (nam qui... sensit). Although the first of these has always caused great difficulty, cf. GLÜCK , Pand., 4, 161; BAUER O ., Dareingabe, 72 ff., in fact it perfectly illustrates and confirms the proposition deduced from our 11, 1. In connection with 18 , 1 , 58 the last sen tence clearly implies that the same would be true though Stichus alone were the subject of the sale . The point of the decision and the distinction from 18, 1 , 9 pr. can only lie in the fact that the ambiguity was known to the buyer. If, knowing that the word Stichus applies to several of the seller's slaves and that the seller means a particular one, he does not inquire further, he is held to be indifferent, and the fact that he has a particular slave in mind amounts only to a hope or speculation . It is as if the seller had three gold watches of about equal value with which the buyer was familar and one of which (unknown to the seller) he preferred, and the seller brings him a box saying « here is my gold watch which I offer for 50 ». If the buyer agrees without opening the box, the fact that he thought it contained the preferred watch would be immaterial. In 34 pr. the buyer's fundamental indifference is more clear if Stichus is only an accessory, but even if he is the principal, this state of mind is held to be evinced by the failure to demand any details . On the contrary the ambiguity will harm the seller if he answers the buyer's inquiry, which shows a particular interest in the subject. Thus it is that all the apparently contrary texts concern pacts, or special agree ments about points which have been the subject of discussion . If in his offer the seller enters into details intended to awaken the other's interest, he must speak clearly, hence re integra in 18 , 1, 21 ; cf . also 21, 2, 69, 5. If the phrase appears in the list of seller 's duties, or purports to give the buyer some advantage, it will be hard for the seller to prove the opposite by asserting an ambiguity, hence 18, 1, 33 as explained by 8, 2, 17, 3, whereon see KIPP, Krit. Vierteljahrschrift, 33 , 541. (31) This vital distinction is rightly insisted upon by CURTIUS, OTTO Th .. 5, 174 ; so also FABER, Rat. ad 18 ,1,9,2. Error in substantia in the Pandects 425 one described . The price was not as usual determined by the par. ties themselves in a bargaining spirit, but was agreed to be for the market value, in short the original transaction seems equivalent to that described in 18 , 1, 7 pr. where the price is to be set accor ding to the arbitrium boni viri. In consequence the parties consult one or more experts whose judgment they accept (pretio exquisito ). It is indicated by auri liquid that mistakes of the appraiser typi cally do not affect the validity of the sale (32). Having agreed to abide by his judgment the parties are mutually bound to respect it, and their remedy, if any, is against him for dolus or culpa ex mandato or conducto, there being no question of any dictum by seller or buyer . All this applies if the bracelet is correctly described, but here as in 9 , 2 cit. the transaction is void if there is any essential misdescription to the appraiser. The reason is that the parties' in tent has simply not been fulfilled , they desired that bracelet to be valued, not a hypothetical golden bracelet. Any description condi tions or restricts the task of the appraiser who applies himself strictly to the duty indicated. This is clearly seen in the case of 41, 1 : the parties take the table to an expert describing it as of solid silver ; the silversmith will then appraise it as work of art and add the value by weight. In so doing he answers the hypothe tical question what the table would be worth if it were of solid silver, or values a hypothetical table , not the actual one which the partiers had agreed to have appraised. It would be quite different if they had merely requested him to appraise the table, then his error in thinking it solid silver would be treated as if it had been made by the parties, and in the case of our brass bracelet his idea that it was gold would in no way affect the validity of the sale . In short our decision rests on the dinstinction between requests for valution of « this bracelet » and « this gold bracelet ». The former was what the parties agreed upon, and if they do the latter, they have no more consummated their agreement than if another bracelet had by mistake been valued. As the original contract was not binding , 18, 1, 7 pr., the whole transaction is a nullity. Thus our (32) If LEONHARD, Irrthum ’, 2,93, were right in supposing that the appraiser was not mistaken and valued the bracelet correctly, there would be no doubt as. to the validity of the sale. The purpose of consulting him is solely that any er rors of the heirs may be corrected ; cf. also HAYMANN, op. cit., 133 . Roma · II 28 426 J. B . Tayer text has no connection with a defect in the thing : the error caused a failure to determine the price in the manner agreed . It would presumably be the same if the parties agreed to consult an expert and by mistake choose one who knew nothing of the matter. Whe ther binding or not , the original transaction is in these cases made subject to a condition which must be duly fulfilled (33). To be a condition it must be agreed upon by both parties, hence it would be immaterial if the buyer alone consulted an expert describing the object as of solid gold . As for the phraseology of our passage, the phrase de materia et qualitate is probably meant to show that the thing was useful or ornamental in itself so that the material is undoubtedly a quality. The case contrasted, and doubtless also referred to in the first ut puta sentence, is that where the material alone is in question , i. e a massa or lump of raw metal. This was not perhaps discnssed by Ulpian, for it is easier to decide and a mistake of the expert is less likely. The final sentence which seems mere repetition, ought to be read with the facts of 18, 1, 10 in mind : the ingenuity of the case in 14 is that everything there said is applicable to the « sale by description » where the object is not perceived by the buyer, and it is this to which the last sen tence calls attention . The final text thought to be contrary to the main principle of 19, 1, 21, 2 is 18, 1,41, 1, which shows that Julian was an adherent, if not the founder, of the view criticized by Marcellus and defended by Ulpian in the famous 9 , 2 cit. The point is now clear, the case is only in extreme form of the jar of salad dressing instead of wine or the barrel of salt instead of fish . Application of the usual ar gument a contrario suggests some interessing conclusion. The de cision would then be confined to precious metals , which are redu cible and in that form of great intrinsic value. The worth of the material by weight alone is a feature which cannot be overlooked or neglected and which is absent in the case of materials not avai lable for currency . The mensae citreae of 19, 1 , 21, 2 are desired for ( 33 ) The truth of this proposition seems plain , and it is certainly not affected by the view of Labeo and Cassius in G . 3.140. If not binding, the original agreement is even more conditional on the establishment of the price in the manner stated ; as regards the idea that 19 ,2, 25 pr. etc. are interpolated see SCHRADER'S note to the words ita hoc constituitit J . 3 , 23, 1 . Error in substantia in the Pandects 427 the material alone aut in that shape and no other. The buyer of a solid citron table does not think of the insidie as a distinct asset per se . The ratio decidendi of 41, 1 may be that two things were bought of which one was unseen , its absence causes the whole tran saction to be void because the price was indivisible (34 ). The seller is relieved from liability for his dictum on the ground of impossi bility : the silver inside is as non - existent as the mackerel in the barrels which contained salt . If on the other hand the table had been made of solid lead which the parties mistook for silver, the transaction would be quite valid and the seller held for a dictum . Here in effect the inside of the table was seen because it exactly corresponded to what they saw , i. e. the outside. The distinction is very subtle put as usual thoroughly logical given the rule that the sale of a valuable and ornamental jar of fine old wine is void if the jar is empty or contains beans. The topic of error in identity has been chosen because such difficulty has been caused by the apparently conflicting texts. If the above attempt to restrict the decisions to the facts stated is considered successful in removing the antinomies and restoring a sensible doctrine for the great jurisconsults , the plea for a friendly attitude toward the Pandectes deserves attention . The compilers were painfully conscious of the differences of opinion represented in the material which they had to excerpt, and even if we had not their word for it in Const. Tanta 15 , it would be a natural assum ption that their main attention was directed toward including no contrary theories ( 35 ). Whenever an apparent conflict is encountered (34) Cf. 18 , 1, 58 ; 21, 1 , 36 . (35 ) Furthermore economy of interpolation is to be expected : where they chose among opposing views they would more naturally include a genuine text by an adherent than alter laboriously a contrary proposition, cf. supra n . 33 i. f. ; and where they changed the law they would prefer to include a genuine sta tement of the rule taken from another connection. An example of the latter con tention may be found in 33, 5 , 19, which as often been thought interpolated on account of J. 2,20, 23; but which is much better explained with FERRINI, Legati, 273 n . 1, as originally a case of a legacy per damnationen . Having to choose among a large number of statements of the same proposition , the compilers would have been at a loss if they were simply to reproduce it in the opposite form . If they could find nothing in any field which could bemade to fit the new rule they omitted the whole matter in the Digest, announcing the change by a statute in 428 J. B . Tayer - Error in substantia in the Pandects it should be the task of the interpreter to consider all the concei vable variations of fact to see whether they can be accommodated to the various decisions. Il will usually appear that this is not only possible but that the compiler has left some indication , often slight or obscure occulte ), of the distinction in question like si in materia erratur in 18, 1, 11 pr. The fact that the distinctions are usually, if not always extremely subtle and refined render the task more difficult but also more attractive. It is submitted that it is only thus that the true character of our compilation is perceptible as the greatest compendium of human ingenuity in existence, to which the compilers contributed no small share by their excessi vely allusive method . the Code. The requirement that the rubrics should be retained seriously limited the possibility of direct and far-reaching alterations in the law of the Digest. The question must always be considered : if this entire passage is substantially due to Tribonian, why should he have troubled to announce it under a new ru bric ? cf. 34, 1, 7 for his fidelity to the original. If the Palingenesia is consulted it will appear that the famous (30). 1 is probably genuine word for word ; it was only in a very remote sphere that the compilers could find the proposition they sought. ARTHUR SCHILLER PROFESSOR OF LAW IN THE COLUMBIA UNIVERSITY OF NEW YORK RES MOBILES, IMMOBILES AND SE MOVENTES SUMMARIUM Distinctione inter res mobiles, immobiles et se moventes iurisconsulti romani non utebantur. Eam ignorabant etiam iurisconsulti graeci atque aegyptiaci Cara calla imperante. Primum illam distinctionem habemus in Theodosii II constitu tione anno 443 data. Philosophiae graecae vim atque effectum Auctor indagat. The majority opinion is that the classification of property into movables and immovables had little legal significance in either Greek or Roman law (1). Leaving aside the truth of this statement for the inoment it must be pointed out that the Greco -Roman, or rather Byzantine law , from the fifth century on , stressed the three fold division of property into movables, immovables and things moving of themselves even more than the dual classification (2). At first sight, it would seem that a threefold grouping would be natural to peoples to whom slaves and domestic animale were among the important kinds of property, yet as far as the author is aware, at no other time in the world ' s legal history , did such a classification assume the role it did in the V - VIth centuries. It is necessary, however, to first re -examine the status of movables and immovables in earlier Greek and Roman law , before expoun ding the details of the Byzantine practice. (1) WENGER, Recht d. Griechen u. Römer (= Kultur der Gegenwart, II, 7, 1], 217 : « Aber es ist ein eigentümlicher Entwickelungsgang, dass die Unterschei dung von Mobilien und Immobilien, die in unseren modernen Rechten wegen des Grundbuchsystems von so hervorragender Bedeutung ist, für das klassische grie chische und römische Recht zurücktritt und oft mehr als Faktum konstatiert, denn als rechtlich relevant betrachtet wird » . Specifically, in Greek law , BEAU CHET, Hist. du droit privé de la répub. Athén ., III, 5 ff.; Hitzig , ZS. 18 (1897) 171 f. ; VINOGRADOFF, Outl. of Hist. Juris., II, 199 f. BONFANTE seems to have decisively settled the question for classical Roman law , especially Scritti giur., II , 242-59 ; cf. also OERTMANN, Volkwirtschaftslehre d. C. 1. C ., p. 27 ; SCIALOJA, Teoria d . proprietà nel dir, rom ., I, 61 f. ; SoHM -MITTEIS -WENGER, Institutionen !?, pp. 256 f.; BUCKLAND, Text-Book of Rom . Law ?, 186. Contra , as far as Greek law is concerned , SCHWARZ, KRELLER and possibly KÖBLER , see infra. (2 ) In accord ZACHARIAE, Gesch. d . Gr.-Röm . Rechts?, 185 ff.; BONFANTE , Corso di dir. rom ., II 1, 185 and Ist. di dir. rom .*, 239 (though BONFANTE, merely notes mobiles and immobiles). 432 Arthur Schiller I. Movables and Im 'm o vables . Movable objects are clearly different from animals, but so are houses from fields. The ancient Greek was accustomed to itemize the various things which might be the object of ownership (3). Nor did Greco - Egyptian law in Ptolemaic or Roman times reach a stage of absolute legal distinction . The earliest papyrus extant. distinguishes šyyata and vavtıná (4) ; this is not a distinction between immobiles and mobiles but rather between things pertaining to land and those relating to ships (5 ). The terminology fyyaiá të xai Šminha appears in the papyri (6 ), but there still persists the custom of specifically enumerating the objects, e. g. olxia , OKEŪDS, Xtivn , as well as using the perplexing tà inågxovta (7) It has been urged that the publicization of immovable property in connection with the Bibilo onun èputyoewy, as well as the fictional attribution of immovable cha racter to slaves indicates the general classification of property into movables and immovables in Roman Egypt (8) ; but when it is (3) E . g . Isaios VIII , 35 . If BEAUCHET, I, c., is correct in holding that mo vables attached to land remained movables, the Athenians were a long way from giving legal significance to the distinction of movables and immovables. (4 ) P . Eleph . 1 = Chrest. II 283 = P . Jur. 18 (311 B . C .), line 13 : 8x Tt. αυτού Πρακλείδου και των Ηρακλείδου πάντων και έγγαίων και ναυτικών. (5 ) MEYER, Jurist. Papyri, p. 46 believes that vavtiná = res mobiles, and was equivalent to the later initła plus utøvn. Even PREISIGKE, Wörterbuch, s. V., translates this passage « private Besitzgegenstände zu Lande und auf dem Schiffe » , while the ancient Greek usage clearly was not res mobiles, see Lys. 32. 7 and Demos. 27 11. Nor is there any warrant for the threefold Byzantine classification that MEYER , I. c., and KRELLER , Erbrecht. Untersuch . d . gr.-ügypt. Pap.-Urk., p . 11 n . 3 , make. (6 ) E . g. in the Dryton group of papyri, see KRELLER, op. cit., 345 . ( 7) In accord KRELLER, op. cit., 11, 345 ff. The identification by MEYER, supra note 5 , of stņvy and moventes is unlikely in that stývn was limited to animals, cf. PREISIGKE, Wörterbuch, s. v . Though tá Únioxovta is generally the whole property , it may mean only slaves or animals, reff. KRELLER, op. cit., p . 12 n . 2. (8) SCHWARZ, Die öffent. u . priv. Urk. im röm . Aegypten (Abhandl. Leipzig , XXXI, 3), 287 ff. WENGER and SoHM - MITTEIS -WENGER , I. c. supra note 1, would seem to hold the same on the basis of the « Grundbuch » . KRELLER , Er brecht. Untersuch., p . 10 , also holds that movables are to be distinguished. The • immobilization of slaves (and possibly ships) is discussed in SCHWARZ, I. c. ; cf . MITTEIS, Grund :. d . Pap.-kunde, II , 1,. 95 n . 2 ; Weiss, Griech. Privatrecht, I, p. 277 n. 114 . Cited with approval, KÜBLER, Studi Bonfante, II, 349, 360 f.; TAUBENSCHLAG, ZS, L (1930 ) 162 n. 1. Res mobiles, immobiles and moventes 433 remembered that ships, though analogized to immovables in some respects, and domestic animals which fall in the same group as slaves, were not subject to public recording, such a statement ap pears erroneous (9 ). As we shall see, the fact that in particular circumstances movables are handled differently from immovables, is not sufficient to attach major importance to such a distinction (10). It is unnecessary to dwell at any length upon the minor im portance of the division of property into movables and immovables in the Roman law of the republican and classical epochs (11). Bon fante has conclusively shown that the significant legal distinction of corporeal objects was that of res mancipi and nec mancipi, and that this remained so until the end of the classical epoch (12). It is true that in specific legal institutions some differentiation bet ween movables and immovables is to be found, a distinction that is rather the result of factual necessities than legal niceties (13) ; (9) The view of RostovzEFF, Stud. z. Gesch . d. röm . Kolonats, p. 403, that the ownersip of ships was recorded in the Bibhio Onun éyxTYOEWV is not accepted, cf. KÜBLER , Studi Bonfante, II, 349. On the immovable character of ships see TAUBENSCHLAG , Studi Bonfante, 1, p . 414 n . 357. There is no evidence what soever that, legally, animals were dealt with differently from other movables ex cept slaves. (10) In Roman law mobility or immobility was material in specific legal si tuations, yet it is held that the classification is relatively unimportant. Thus, the interest of SCHWARZ in the Biblio Ońkn or of KRELLER in the objects of inheri tance, does not warrant the general statements that these authors make in re hard to Greek law . (11) BIONDI, Corso di 1st. di dir. rom ., I, 159: « importanza limitata » ; PACCHIONI, Corso di dir. rom .?, II, 177: a non aveva..... grande importanza » ; BUCKLAND , Text-Book, p . 186 : « only subordinate interest » ; RADIN , Handbook of Rom . law , 335 : « not made the basis of a legal classification » ; GIRARD , Ma nuels, 265 : « sans avoir..... les mêmes conséquences qu'en droit germanique » ; SoHM -MITTEIS -WENGER, Instit., p . 256 : « keine besondere Bedeutung » . Contra, among recent authors, FADDA-BENSA, in trans. of WINDSCHEID , Pandekten , I, 526 ff. (inaccessibile to me) ; its minor importance overemphasized, SCIALOJA, Teoria d . prop., I, 61 ff. (12) Generally on res mancipi and nec mancipi, Scritti, II, 1 ff.; particu lary on the importance of mobiles and immobiles, ibidem pp. 239, 242 ff. and Corso, II, 183 ff. . ( 13 ) Notably, the time necesssary for usucapio , furtum of movables only, the interdictum uti possidetis for land and utrubi for movables, the prohibition of the tutor to alienate land . See further , for the fullest list, SCIALOJA, op. cit., I, 62 f. Arthur Schiller 434 Bonfante, in fact, holds that even in these cases the fundamental distinction is not between movables and immovables (14 ). : What might be considered evidence of the distinction is the presence of the expression res immobilis in the legal sources of the classical epoch. As a matter of fact, the words are practically wi thout exception interpolated ; in the Digest immobilis occurs in Macer 2 , 8 , 15 pr. (15 ), Modestinus 3, 3 , 63 ( 16 ), Marcellus 19, 2, 48, 1 (17), Ulpianus 33, 6, 3, 1 ( 18 ), Iavolenus 41, 3, 23. pr. (19). So also are C . 3 , 34 , 2 (215 . A . D .) (20) and Ulp. Reg . 19, 6 , 8 (21) interpolated . Even the words mobiles and moventes may occasionally be post-classical (22). This is undoubtedly the case in the much discussed D . 21, 1, 1 pr., which, as it reads, presents the threefold distinction of Byzantine law (23). The great weignt of authority relegates to the codifiers the words which extend the edict to sales (14 ) Scritti, II, 248 ff., and Corso, II, 186 ff. ; holding that the distinction in usucapio was between fundi and ccterae res, that furtum originally embraced all thefts, that the interdictum uti possidetis was modelled for the fundus and utrubi originally for the servus alone, that praedia urbana were only added to the tutor's prohibition by Constantine, etc., disposing in some way or another of almost every distinction that has been pointed out. ( 15 ) Interpolations noted, Index Interp., I, col. 18 and Supp. I, col. 17 ; cf., however, SCIALOIA , Proprietà , 68 . (16 ) Index Interp., I, col. 36 and Supp. I. col. 41 f. (17 ) Index Interp ., I, col. 365 . rp., II, COCUJAS, Opera,14 n.7; BoseAn.1);K (18 ) Index Interp., II, col. 284. (19) Interpolations, see Cuvas, Opera, IX , 507; LENEL , Palingen., I, col. 291 n . 1 f.; EISELE, Jher. Jahr., XXIV, 514 n . 7 ; BONFANTE, Scritti, II, 239, n . 6, 253, and III , 252 (cf. Ist.", 239, n. 2 ; Corso , II, 186 n . 1); KÜBLER , Studi Bonfante, II, 347 n . 3; VIR III, 2, col. 397 line 19 ; KRÜGER, ad h. h . (20 ) BONFANTE, following CUJAS, reading (im ) mobilium sees ( servitutem quaesiisti ] as interpolated , Scritti, II, 239 n . 6 , 253 and III, 252 (cf. Ist.*, 239 n . 2 ; Corso , II, 186, n . 1); cf. BESELER, Beiträge, IV , 86 ; RABEL , Mélanges Gi rard , II, 410 n . 2. (21) BONFANTE, Scritti, II, 253 : ... [mobiles ( ceterae res ?) .... [immobiles (praedia ? ) .... (8 ) .. . [rerum -biennii ). Cf. ALBERTARIO, BIDR XXXII , 126 ; SCHULZ , Epit. Ulpiani, ad h . l. (22) E . g. mobiles in D . 41. 2. 3. 13 , see BESELER , SZ L (1930) 39; 41, 3 , 23 pr., see supra note 19 ; 41, 3, 30, 1, see KÜBLER, Studi Bonfante, II, 348. (23 ) ( Ulp. 1 ad ed . aed . cur.) Labeo scribit edictum aedilium curulium de venditionibus rerum esse tam earum quae soli sint quum earum quae mobiles aut se moventes. Res mobiles, immobiles and moventes 435 of all types of objects (24). As Kalb has pointed out se moventes is not classical so that C. 3 . 36 . 4 (Alexander) : ... et res mobiles vel [se] moventes ..., is suspect (25). On the other hand, classical law did sometimes distinguish between movable objects and things moving of themselves, so that the terms res mobiles, res moventes, mobilia and moventia are usually genuine (26). Nevertheless, the distinction between res mobiles, in the narrow sense , and res mo ventes , had even less significance than that of movables and immo vables from the point of view of legal divergence (27). Thus I believe it has been established that in Greek law , Greco -Roman law in Egypt (to the constitutio Antoniniana at least), and Roman law to the end of the classical epoch, the distinction between movables and immovables was comparatively unimportant, and the threefold classification of res mobiles, immobiles and se mo ventes was non -existent. II. The origin of res mobiles, immobiles and se moventes. The earliest extant legal source that presents the classification of res mobiles, immobiles and se moventes is a constitution of Theo · dosius II of 443 A . D . (28), and it is not until the time of Zeno that the exact form in which the classes persist for centuries is found (29). The first problem , therefore, is to determine the origin of this novel situation , in other words, discover what factors wi (24 ) ( tam - fin. ), see Index Interp ., II, col. 1 ; among these DE SENARCLENS, RH , VI, 386 ff., has the fullest discussion ; add . MONIER, Garantie contre les vices cachés, 161 ff. (25 ) KALB, Juristenlatein ? 14 ff. (26 ) Cf. D . 50, 16 , 93 (Cels. 19 dig .): - Moventium ', item mobilium ' appel latione idem significamus: si tamen apparet defunctum animalia dumtaxat, quia se ipsa moverent, moventia vocasse. quod verum est. For res moventes see KALB , 1. c. ; for the remainder, examples in HEUMANN-SECKEL, Handlexikon, 8. v .movere. (27) PACCHIONI, Corso , II, 178 and n. 372, points out the distinction in cases of animus revertendi and servi fugitivi. (28 ) Nov. Theod. 22, 2, 3 : Sed ubi quarta pars bonorum mortui curiae debet offerri, immobiles quidem res, ...sub adspectu etiam curialium aestimari dividive coucedimus : mobiles autem res vel se moventes vel instrumenta vel si quid etiam in huiusmodi iure consistat in medium proferri divulgarique uon patimur, ... = C . 10 , 35 , 2, 2. (29) C . 1, 2, 15 pr.; 7, 37, 2 pr. 436 Arthur Schiller thin the period from the close of the classical epoch to the date of the Theodosian statute brought about the change. Proponents of the view that the Hellenistic- oriental law exer ted great weight upon the Roman law of the post-classical pe riod would suggest investigation of Greco - Egyptian papyri during the centuries concerned (30). It is true that there seems to be an increase in the custom of differentiating movables and immo vables (31). In addition, the Bibhodnien Éy« TYOEWV practice persists until the time of Diocletian (32), but as has been pointed out, slaves and animals are handled differently therein (33). Kübler in timates that the attribution of immobile character to movables in late Roman law is due to the infiltration of Greek law (34) ; whe ther this be so or not, it is not pertinent to the threefold division here concerned. Finally, the author has found no evidence of the class of thingsmoving by themselves , or the threefold classification generally , in the papyri of this epoch . When we turn to the Roman legal sources of the intervening period , although we do not find the origins of the distinction , we are able to understand how the way was paved for its introduction . The true Roman distinction of res mancipi and nec mancipi fades into obscurity early in the post - classical era, though not definitely . abolished until Justinianean times (35 ). According to Bonfante, the public forms prescribed for alienation of immovables as well as official registration marked the downfall of the civil forms ( 36 ). ( 30 ) The Beirut professors are too late to be considered , cf. COLLINET, École de droit de Beyrouth [Études hist., II], 130 ff. (31) The earliest usages (and only ones before Justinian ) of revntós and åkintos are BGU 8 II, 8 (decree, 247-48 ): ... eidos tõvvateox [n ]uévov ;v[TE] KELVntos kai đuelvntois ; P. Oxy. XIV 1642, 6 ( power of attorney, 289): uÝte ÉKNOLNOvai aŭtoũ TÌv εjnogiav åx[Elvýtov? und]é vui Kelvntāv; Stud. Palde . 1 6 , 12 (will, 480 ): ... k ] vntāv te vai åkivýtov Év navti εidn . : (32) TAUBENSCHLAG , Studi Bonfante , I, 414 n . 353. (33 ) Supra , note 9. (34) Studi Bonfante, II, 360 f. . (35) Consult generally BONFANTE, Scritti, II, 240 f., 310 ff. ; Corso , II, 177. C . 7, 31, 1, 5 (531) is the annulling statute . (36) Forms of writing, tradition and gesta date from Constantine, Fr. Vat. 35 , 249 ; cf. BONFANTE , 1. c., and STEINWENTER, Beitr . z. öffent. Urkundenwesen . Fr. Vat. 293, 1 ( 293 A . D .), which presents the confusion of ... in his quidem , C.7,31, 1,5 of writing, trand STEIN Res mobiles, immobiles and moventes 437 Nevertheless, the old designations for land and types of movable property persist (37), and in the contrast of movables and immo vables it is only exceptionally that res mobiles et immobiles is found ( 38 ). The few cases in which things moving by themselves are concerned do not anticipate the prominence which res se mo ventes is to have (39) ; rather the early post-classical passages should have resulted in the simple division of movables and im movables in Justinianean times (40). Thus, neither Greco -Egyptian nor Roman law are responsible for the threefold classification . Nor can the distinction be clearly explained on the basis of the new economic and social structure of the empire, the development of patronage and large estates which, at the end of the fourth century at least, are to be ob served (41). In such condictions all types of property come into the hands of a few persons, but there seems to be no pertinent reason why slaves and animals should have been given any more qnae solo tributario consistunt, ... Rerum autem mobilium sive moventium , si ex cepti (non ) fuistis. quae mancipi ... ; nec mancipi vero ..., would seem to have been tampered with by the redactor. (37) C. Th. 6, 35 , 1 ( = C. 12, 28, 1,(814 A. D.); Fr. Vat. 249, 7 (316); C. Th. 12, 1, 6, ( = C. 5, 5, 3 (319); C . 5, 37, 22 Dr. (326) ; C. Th. 10, 8, 4 (346) ; C. Th. 8, 15, 5, 2 ( 365-73); C. Th. 3, 30, 6, 1 ( = C . 5, 37, 24, 1 (396 ?). (38) C. 8 , 36 , 3 pr. (380 ) ... quodlibet denique mobile vel immobile ... legave rit ...; C . Th. 4, 6 , 8 (428 ) ... quibus rei mobilis vel inmobilis dominium confir matur ... ; also the interpolations of Ulp . 19, 6 , 8 (see supra , note 21), if it be of this period . (39 ) C . 9 , 33, 1 (242 ) Vi bonorum raptorum actionem , ... potius ad mobilia moventiaque quam ad fundos ..., clearly the classical point of view , cf. the cases in D . 47, 8 , 2, 17 ff.; C . Th. 10 , 9 , 2 (395) ...omnium bonorum , id est immobilium moventium vel, ut plenissime loquamur, praediorum urbanorum aedium mancipio rum animalium argenti auri ornamentorum vestium pecuniae fiscus incorporatio nem traditionemque percipiat. ...; C . Th . 2, 1, 8 pr. ( 395 ). Causas plurimi insti tuentes de fugaci servo aut manifesto furto aut non manifesto, direpti etiam animalis servive (KRÜGER, C. Th.: servi) vel rei mobilis ac moventis vel vi bo norum raptorum , ... (40) BONFANTE , Scritti, II, 217, 220 f. and Ist. , 239, intimates that the post-classical distinction was solely res mobiles et immobiles; I do not believe that the distinction made as regards gesta publica warrants such a generaliza tion , see infra . (41) See generally DE ZULUETA, De patrociniis vicorum (Oxford Studies in Soc. & Leg . Hist., I; 2); HARDY, Large Estates of Byz. Egypt. 438 Arthur Schiller prominence herein than in the republican era of praedia rustica. However , the social and economic conditions, just as the disap pearance of res mancipi and nec mancipi, gave the opportunity to the legal councillors, or at least the legislative bureaus, of Theo dosius II, Zeno and Justinian to apply to a legal situation the classification which I consider to be the source of res mobiles, im mobiles and se moventes namely the Neo-Platonic metaphysical triad of κινητός, ακίνητος and αυτοκίνητος. One of the points of disagreement between Plato and Aristotle was in regard to the nature of motion , particulary apparent in their respective discussions of the immortality of the soul (42). In these discussions the idea of aŭtorivnois, or auto -motion , assumes a place of first importance. To some extent there are reflections of the view of both philosophers in the later philosophical writings of the Hellenistic age. Plutarch , in his Moralia, probably has more references to aŭtorivious than any of his predecessors (43). As a matter of fact, the complete development of the metaphysical concept of auto-motion , with its correlatives of hetero-motion and non -motion is due to the Neo-Platonic school of philosophy. Though Plotinus (204-270), the founder of this school of tho ught, received his training at Alexandria, it was at Rome that he worked out his philosophical system ; and his ideas are no more Hellenistic than Roman (44). It is true that Neo - Platonism is an eclectic philosophy, but it may more correctly be viewed as the inspired reasoning of a genius (45). In Plotinus we find the first signs of the new significance attached to aŭtoxivnois (46 ). His suc cessors Porphyry and Iamblichus expanded his doctrines and doc (42) PLATO , Phaedr. 245 ff., de leg., 894 ff. ; ARISTOTLE, Phys. VIII. 3-6 , de an . I, 3 ff. (43) De plac. philos., IV, B : llegi yuxns, (Moralia , p . 898 B - C ) : Bains απεφήνατο πρώτος την ψυχήν φύσιν αεικίνητoν ή αυτοκίνητον. ... Πλάτων ουσίαν vontv, és Éavtñs Kıvntv. ... Cf. also Moralia , 884C, 899 B , 1013 C ff. (44 ) WHITTAKER, Neo - Platonists, 13 f., 26 ff. (45 ) ZELLER, Philos. d . Griechen, III. 2, 466 ff. (46) Ennead . VI 2. 18 (2 . 1121): " Eoti dě vai ņ Énlotņun aŭtorivnois, oyus ουσα του όντος και ενέργεια , αλλ' ουχ έξις : ώστε και αυτή υπό την κίνησιν ; VI 6 . 6 (2 . 1240 ) : ' A vonous Toivuv tis uvņoews, oŮ Nenonuev avtorivnoiv, aaa' αυτοκίνησις πεποίηκε την νόησιν, ώστε αυτή εαυτήν κίνησιν και νόησιν. On Kivnois in Plotinus see ZELLER, op. cit., 319 n . 2, 320 n . 1. Res mobiles, immobiles and moventes 439 trines and continued the effort of developing subordinate triads to insure a complete and consistent philosophical system . Neo - Plato nism spread over the Greco- Roman world and for two centuries, at least, it far outshadowed any other philosophy (47) ; even the Christian fathers of the fourth and fifth centuries reflect the psy chological and metaphysical doctrines of their pagan contempo raries (48). Macrobius' discussion of the immortality of the soul well illustrates the notoriety of this portion of Neo - Platonic phi losophy in the west (49). It is in the Athenian school, however , that the triad in regard to motion receives its final form . Proclus (410 -485 ), the greatest of the Neo-Platonists after Plotinus, devotes a large part of his Theological Institution to this Topic (50), and refers to it often in his commentary on Plato' s Alcibiades (51). Το quote but one passage from the former : Παν το όν ή ακίνητόν έστιν ή κινούμενον · και ει κινούμενον, ή υφέαυτού ή υπ' άλλου και ει μεν vo'éavtoû , aŭtorivnTÓV &otiv al dè un ' akaov, Étegorivntov. Ilav åga ñ axirntov ÈOTIV ñ aůtokivytov Ÿ Éteporivntov (52). The longest gloss of Hermias, a contemporary of Proclus, to the Phaedro of Plato , is devoted to an exposition of rivntov (Ens = Deus), aŭtorivntov (anima) and ÉTE gorivntov (phaenomena, mobilia ) (53) ; one of the last of the Neo Platonists, Iohannes Damascius, spends pages on a discussion of the same triad (54). The references in the Neo - Platonists could be multiplied at will ; here it is only necessary to point out that such metaphysical concepts, even though in a simplified and cor rupted form , were within the knowledge of all the learned persons of the age . (47) WHITTAKER, Neo -Platonists, XI. (48) Among others Synesius and Boethius. (49) Comm. in Somn. Scip . II. 13-16 ; see WHITTAKER , Macrobius, especially 79 ff. (50) Chs. 14 , 17 , 20 , (51) CREUZER, Initia philosophiae, I [Proclus, in Plato Alcib.], 15, 17 , 116 , 225 . (52 ) CREUZER , op . cit., III [ Proclus, Inst. Theol.], 24 . Later, 291 (ch. 195) Proclus makes the identification trãoa yvyn návra goti rå roáyuara , while yuyń is to a certain extent equivalent to Ens ' ; can we say that even Proclus would have affirmed the three types of πράγματα ? (53 ) Scholia to yoxú nãoa å Oávatos, pp. 114 ff.; cf. COUVREUR, Hermiae Alex . in Platonis Phaed . Scholia (Bibl. de l' École des Hautes Études, CXXXIII], VIII ff., to the text, 102 ff. (54) De principiis, SS 15 - 19 , 101 bis-103. in the translation of CHAIGNET. 440 • Arthur Schiller The Neo - Platonists themselves had little contact with the em peror and his court except in the brief epoch of Julian (55). Ho wever, even though Valentinianus, Theodosius, Arcadius and other emperors promulgated laws laying down severe penalties (56), the school persisted and, at times, its members were active in imperial circles. Pamprepius, a student of Proclus, had for a time great influence at Zeno's court, and Severianus of Damascus was a jurist and a public official under the same emperor (57). Justinian would not seem to have had any philosopher of the outlawed school among his legal councillors , for it was he that closed the school at Athene in 529 (58 ). Nevertheless , Neo - Platonic philosophy and the language that the philosophers employed was a common he ritage ; the framers of the statutes of Zeno and Justinian were undoubtedly acquainted with this philosophy, just as much as they wrote the « Kunstlatein » that impelled them to say res se moventes (ngáyuara aŭtokivnta), as Kalb has pointed out (59). From the time of Zeno, in fact, the Greek ngáyuata xvntú te nai årivnta vai aŭro rivnta is as standardized as the Latin res mobiles et immobiles et se moventes. III. Res mobiles , immobiles and se moventes in the Justinianean era . The earliest legal source presenting the threefold classification of res in its new form is, as has been noted , Nov . Theod. 22 (60). The next occurrences are in Zeno' s legislation , C . 1, 2 , 15 pr. and C . 7 , 37, 2 pr., illustrating the standardized form in both Greek and Latin (61). It is with Justinian , however, that our references mul (55 ) Cf. WHITTAKER, Neo -Platonists , ch . VIII. (56 ) E . g . C . 1. 1. 3 . 1 ; 1. 11. 6 . (57) See ZELLER , op . cit., 836 n . 2. (58 ) Joh . MALALAS, XVIII, 187. (59) Juristenlatein , 16 : « Somit ist jenes se mov. den (griechischen ) Räten Justinian's zuzuschreiben, welche in ihrem Kunstlatein nur res se moventes sag ten » ; accord HEUMANN-SECKEL, Handlexikon, 8. v. movere · Kunstlatein ' is not further defined . (60) See supra, note 28. (61) C . 1. 2 . 15 pr. (extat in Nomoc.) : Ei tis dwgeår KiVntāv û ånvýtov ή αυτοκινήτων πραγμάτων ή οιουδήποτε δικαίου ποιήσοιτο εις πρόσωπον : C . 7 , 37, 2 pr. Omnes, qui quascumque res mobiles vel immobiles seu se moventes vel in Res mobiles, immobiles and moventes 441 tiply to an astounding extent, so much so that it may be said that the threefold classification is as important as the dual classification of movables and immovables (62), and in some respects more im portant. This statement can only be justified by weighing against one another the instances of the dual and the threefold classifi cation in the sources. In the Institutes of Justinian only three passages need be considered. In . 2. 6 pr. substitutes mobilis and immobilis for the mobilia and fundus - aedes of G . 2, 42 as respects the time limit for usucapio, just as the compiler or later scholiast did in Ulp. 19, 6 , 8 (63). Res, for the purposes of vi bonorum raptorum , is stated to be rem mobilem vel se moventem , ... quod non solum in mo bilibus rebus, ... sed etiam in invasionibus, quae circa res soli fiunt, ... in In . 4 , 2, 1 (64). In the final case, In. 4, 15 , 4a, Justinian re produces the classical language of G . 4, 149, when speakings of the interdictum uti possidetis for fundus or aedes, and utrubi for res mobiles . In the Digest we are limited to the interpolations of the com pilers. Neque mobiles vel immobiles neque servos in D . 3, 3, 63, a passage dealing with the power of the procurator to alienate the property of the principal, is clearly interpolated (65 ), but whether it is a Tribonianism or an earlier gloss is more difficult to say. I should hardly think that the jurists responsible for the score of passages in the Codex reading mobiles et immobiles et se moventes would have written servos and thus directly excluded animalia. The interpolation in D . 21, 1, 1 pr. (66), in spite of the position of the fragment at the head of the title (67), and the arguments actionibus aut quocumque iure constitutas ... quibus quaecumque res mobiles seu immobiles seu se moventes aut in actionibus vel quocumque iure constitutae..., cf. Bas. 50. 13 . 2 (HEIMBACH V, 75): ... Agáyuara nivntà i årivnta ñj aŭtorivnta... (62) Modern scholars in both Roman and early mediaeval law mention only the dual division , BONFANTE, 1. c. supra note 40 ; Solmi, Storia del dir. ital., 364 . (63 ) See supra. note 21. (64) Cf. Lex Rom . Burg. 8. 5 : Quod si res mobiles vel sese moventes per vim quisque rapuerit. : (65 ) Supra, note 16 . (66 ) Supra , note 23. (67) The compilers often placed interpolated passages at the head of the title , see KNIEP, Präscriptio, 165 n . 181. Roma · II Da 442 Arthur Schiller advanced by de Senarclens and Monier (68), may, at least in part, be pre- Justinianean. Wherever the three classes follow immediately upon one another, the order is always movables, immovables and auto-movables ; only if the immovables are subject to a different rule may the order be changed and soli or praedia , etc . be substi tuted for immobiles (69). Twenty - three passages distinguishing res appear in Justinian ' s enactments in the Codex, of which eighteen show the threefold , five the dual classification . The phrase res mobiles vel immobiles vel se moventes, or with other connecting particles, is found in C . 1 , 2 , 23, 3 (530), 4 , 18, 2 , 1 (531), 5 , 12, 30 pr. (529), 6 , 61, 7, 1 (530), 7, 37, 3, 1d (531), 8, 21, 1 (529), 8, 53, 34, 1c (529), and 9 , 13, 1, 1f (533). The Greek counterpart πράγματα κινητά ή ακίνητα aŭtorivnta appears in C . 1, 3, 43, 4 (529) and 5 , 1, 6, 2 (n . d ). In all of these cases the same rule obtains for all classes and though it is true that occasionally further types of property , e. g. sive instrumenta vel alias quascumque res (C . 4, 18 , 2 , 1), are ap pended , these may be explained in the light of the subject matter concerned (70). The itemization of the legal situations in these passages discloses that the classification is not limited in its ap plication , but might be utilized whenever property of any sort was concerned (71). Where the legal rule as regards immovables is a different one than that which governs movables and automo vables, the three designations are found , but not directly appended to one another or in the normal order. In C . 3, 34, 13 (531) two years are necessary to extinguish a usufruct of land, one year for movables and automovables (72) ; C . 3 , 36 , 4 (Alex., but interp.) holds that gifts of movables and automovables by the pater to the (68 ) DE SENARCLENS, RH , VI, 415 ff.; MONIER, Garantie contre les vices cachés, 169. (69) See the following paragraph . ( 70 ) For instance , of C . 5 . 13. 1. 7 a , where incorporalis is added , Thale laeus says (HEIMBACH , III, 454 ) toŰTO GÉVov oti tò negi tõv åowuárov. (71) In the cases above the property is res generalli, either belonging to an ecclesiastical establishment, a filius familias, derived from the emperor or from a ravisher, or specifically donations, dowry and bequests. (72) ...per biennium in soli rebus, per annale autem tempus in mobilibus vel se moventibus deminuebatur, ... 443 Res mobiles, immobiles and moventes filius fall into the castrense peculium , those of immovables not (73 ); the restitution of dowry is within a year or at once, C . 5 , 13, 1 , 7a (530) (74) ; the penalty for failure to restore the dowry also differs, C . 5 , 13, 1, 7b (530) (75 ) ; C . 7, 31, 1, 1- 2 (531) declares different periods of time for prescription ( 76 ) ; in C . 8, 53, 36 , 1 (531) donations of movables and automovables to soldiers are freed from registration , implying that gifts of immovables are not (77) ; finally, a different rule obtains for delatores of immovables as con trasted with movables and automovables, C. 10 , 11, 8, 5 ; 5b (n . d.) (78). The five cases in the Codex where the dual division of res immobilis and mobilis is found are C . 1, 11, 10, 1 (n . d .), 1, 53, 1 pr. (528), 1, 53, 1, 2 (523), 5 , 12, 31, 8 (530) and 6 , 61, 8 , 4 (531). In the case of C . 1, 11, 10 , 1, of which we only possess the Greek copy (79), the matter is not conclusive for Justinian, inasmuch as in many cases of the threefold classification in the Codex, the text of the Basilica has reduced it to uvntà vai avtoxívnta (80). On the other hand it is worth observing that ratà rodas, as well as scholia of Justinian's councillors, reproduce the original form (81). (73) ...res mobiles vel se moventes, quae castrensis peculii esse possunt, ... praedia autem , ... peculii castrensis non sunt. ... (74) intra annum in rebus mobilibus vel se moventibus vel imcorporalibus ... rebus quae solo continentur ilico restituendis. ... (75 ) ... supersederit res mobiles vel se moventes vel incorporales ... usuras ae stimationis ... praestet : fructibus videlicet immobilium rerum ... praestandis, ... (76 ) ... rebus, quae immobiles sunt... decem vel viginti annorum vel triginta ... (2 ) ... rem mobilem seu se moventem ... per continuum triennium ... (77 ) ... absolvimus ... donationes rerum mobilium vel sese moventium , ... (78) ... nivýrois ... toutwv TÕV ngaypátov εiow tQuixovta nnegov xarakau Pável ... (5 b ) Ei dè kevntà ñ aŭtorinta ... ngáyuara , unde taðra kaTeXÉTW tis NQONETĀS, ... ( 79) Bas. 1. 1. 20 (HEIMBACH I, 16 ) : ... OÜte ojoias KiVNTÑS akivýtov kú QLOL εival OvYXOonOroovtai, ... (80 ) This occurs in Bas. 26 , 4 , 3 (HEIMBACH III, 109 ) to C . 4 , 18, 21 ; Bas. 29, 1, 119 (HEIMBACH III, 454) to C . 5 , 13, 1, 7b ; Bas. 50 , 10 , 4 (HEIMBACH V , 71) to C . 7, 31, 1- 2 ; Bas. 47, 1, 66 (HEIMBACH IV, 588) to C . 8 , 53, 34, 1 c. Also scholia , such as εi dè årivnra (HEIMBACH IV , 281) to C . 3, 36 , 4 ; dúvatai - noiy uata (HEIMBACH III, 445 ) to C . 5 . 12. 30 pr. (81) HEIMBACH III, 454 (scholium upon C . 5 , 13 , 1, 7 a) : daidota Oudueva ) To sarà rodas šzelº Tà kıvntà i aŭtorivnta, doómara ; Bas. 45 , 4 , 9 (HEIM BACH IV , 534) upon C , 6 , 61, 6 , 2 b : Tò katà nódag ... ÊK TÕV kanāY TOÚTOV 444 Arthur Schiller The Novellae would , at first sight, seem to show a great pre ponderance of the dual over the threefold classification, but when we examine the passages as to content, this majority is greatly lessened . Where the main subject matter concerned is land, and other property is merely incidental, there is reason to consolidate this subordinate matter into res mobiles ; this is the case in Nov . 7, 46, 54, 65. 1. 5 , and 131. 11. A number of the other passages deal with dos or donatio propter nuptias and the contrast here is res immobilis and mobilis, also with accent on the first, Nov. 24 i. f., 22, 44, 2 - 3 + 6 , 61, and 97. 2 . The remaining passages which utilize the dual classification are Nov . 4, 3, where the debtor has no mo ney to satisfy ; 72, 7, the tutor may lend movables, not immova bles, to meet expenses ; 115 , 3, 13, a minor may hypothecate mo vables or immovables to redeem a captive ; 119, 6, the judge decides where the estate of a minor is to be placed during settle ment ; 136 , 3, bankers have a prior lien where they have lent money to purchase property ; 164 praef., intestate succession to property has been prevented . There are only four cases in which the threefold classification is found , and in all of them the normal order appears. In Nov. 86 , 1 (539) it is provided that private judges shall have prior jurisdiction of cases involving the three types of property (82) ; Nov. 112, 1 (541) defines what res are subject to litigation and holds that mortgaged res are not liti gious (83); Nov . 131, 13 pr. (545 ) declares that bishops may not Cõv Toayudrey knºca vị xiv ca, vì aỦroxivnna cromrat; Bas. 45, 4, 10 ( HEIM BACH IV , 537) upon C . 6 , 61, 7, 1 : Tý kata nidas ... dwgeåv Ktíontai, cite kevntāv, εite årıvýtov, kite aŭtonivitov ngayuátov. So also Schol. Theod. to C . 5 , 13 , 1, 7 a (HEIMBACH III, 453): • åvng rà uỀv årivnta ngáyuata tis NQOIRÓS ... tå yåg xıvntà xai avtoxivnta eion Éviavtov peDodevetai ; Schol. Isi dor. to C . 8, 53, 36, 1 (HEIMBACH IV, 592): ... doorontal otpatiótais i kivytá, aůtokivnra ngáyuara . Cf. also HEIMBACH V, 71 note S to revntå of Bas. 50, 10, 4 upon C . 7, 31, 1, 2 : ñ aŭtorivnta is added in all the others. R . (82) ... είτε περί χρηματικής αιτίας είτε περί αφαιρέσεως πραγμάτων κινητών ở đktorov vì abrokuvrov Toi yeuả v ... Auth : ... give de peculiaria causa sive de sublatione rerum mobilium et immobilium seseque moventium sive de criminalibus, ... (83) .. . νοείσθαι πράγμα κινητόν ή ακίνητον, ή αυτοκίνητον... ιδικά πράγματα Kivntà drivnra ņ) aŭtorivnta óvoaori tais úno Onnais eu ÉQOLTO ,... Auth.: ... rem mobilem vel immobilem reseque moventem , ... speciales res mobiles vel in mobiles aut se moventes nominatim fuerinl hypothecae suppositae, ... Res mobiles, immobiles and moventes 445 alienate property they have acquired to their kindred (84); finally Append. Const. 7, 8 (552) concerns property held by Romans in Africa (85). Not only the strictly legal sources of the Justinianean epoch, but the private documents as well, show the existence of the threefold classification , and here again , seemingly more frequent than the dual. The Greco-Egyptian papyri are our best source. It has been pointed out that the threefold division is unknown, the dual comparatively infrequent in the period after the constitutio Antoniniana; (86) this remains the case until the sixth century when a striking change is to be observed (87). The form ηράγματα κινητά τε και ακίνητα και αυτοκίνητα is found in a lease ( 88), partnership agree ment(89), promise to repay (90), deed of gift (91) , surety agree ment (92), marriage contract (93), wills (94 ), deed of disinherison (95 ), ( 84) ... πράγματα κινητά ή ακίνητα ή αυτοκίνητα, ... μεταφέρειν. Auth. : res mobiles aut immobiles sesequc moventes, ... transferre ... (85 ) De rebus mobilibus vel immobilus. Res insuper mobiles vel immobiles seseque moventes, quas ... Romani possedisse noscuntur ... (86) See supra , note 31. (87) Noted by KRELLER , Erbrecht. Untersuch ., 11. (88) P. Lond. III 1007 b, 13 (558): και αμπελώνι] [μετά πάντων κινητών τε και ακινήτων και αυτοκινήτων πραγμάτων ακόλουθως. ( 89 ) P. Cairo Masp. 67159, 44 f. (568) : υποκειμένων ... πάντα τα προγεγραμ μένα [ π]άντων ημών των ημίν όντων και εσομένων πραγμάτων, κινη[των τε και ακινήτων και αυτοκινήτων , ενεχύρου λόγω και υποθήκης δικαι[ ω]. ( 90) P. Masp. 67126, 26 f. (541) : υ[ πο] θέμενοι ... πάντα ημών τα υπάρχοντα [ και υπάρξον]τα, κινητά τε και ακίνητα και αυτοκίνητα, εν παντί [ είδει κα]ί γένει. (91) P. Cairo Masp. 67154 vo., 7 f (566- 70): δωρεάς ... πάντα μο τα υπάρ χοντα και υπάρξοντα πράγματα, κινητά τε και ακίνητα και αυτοκίνητα . (92) P. Flor. III 323, 11 (525): έχειν [α]ϋ[τ]ω κινδύνω έμό και της έμής παντοίας υποστάσεως κινητής τε και ακινήτου [ και αυτοκινήτου]. ( 93) P. Cairo Masp. 67006 vo., 19f (6 th Cent.): [ δ]ωρεάς πάντα τα καταλει φθέντα]... κινητά [τε και ακίν]η[τα και αυτοκίνητα πράγματα λο ... (94) P. Cairo Masp. 67151, 88 f.(570): καταλειφθησομένων πραγμάτων... εξ ίσου εκ τε κινητών και ακινήτων και αυτοκινήτων πραγμάτων; P. Lond. I77, 18 ( = Crest. ΙΙ 319, circa 600) υπόστασιν και κληρονομείν με κινητής τε και ακίνη τον και αυτοκίνητον εν παντί είδει ται γένει. (95) P . Cairo Masp. 67097 vo. D . 63 f. ( = P. Jur». 11, 567) : είναι πάντα τα τε νύν όντα και εσό]μενα [ μοι [ πράγμα[τα παντοία, κινητά τε και [ α ] κίνη[ τ ] α και αυτοκίνητα εν παντί είδει και γένει. Arthur Schiller 446 settlements of inheritance (96 ), surrender of land (97), and other fragmentary contracts (98). In comparison with the instances of threefold classification (99), the contrast between movables and im movables in sixth century papyri is relatively infrequent (100). The legal and documentary sources of the Justinianean epoch speak for themselves. Whenever it was the intention to indicate corporeal property in the aggregate, the favored method was the utilization of the threefold classification of res mobiles , immobiles and se moventes. If, however, either movables or immovables were to be emphasized , the simpler dual classification was used. It is for this reason that the individual objects comprised within each of the three classes of the former division cannot be specifically enu merated. It may be said that even in the Justinianean epoch the particular property within each class was a matter of little import ; the intention was that every conceivable type of corporeal property should be included . Nevertheless, it is reasonable to suppose that res mobiles comprised objects which could be moved about and yet ( 96) P. Cairo Masp. 67151, 11 ( 566) : κληρο[νς ?), είτε κινητών [είτε αγκινή τω[ν] κα[ί αυτοκινήτων...]; 67313, 5 (6 Cent.) έκ [τε] κινητών κ[ a] [ακινή των, και αυτοκινήτων πραγμάτων ; Ρ. Ρar. 20, 10 (circa 600) ελαχίστης υποστά σεως κινητής τε και ακινήτου και αυτοκινήτου; idem, Ρ. Ρar. 20, 14 ; P. Flor. III 294, 69 f. ( 6 Cent.) κληρονομίας ... [ κινητών τε και ακινήτων και ?] αυτοκινήτων πραγμάτων. (97) P. Lond. III 1015, 16 f. (6 Cent.) [τα υπάρχοντα ] και υπάρξοντα πράγ ματα κινητά τε και ακίνητα και αυτοκίνητα.. .]. (98) P. Cairo Masp. 67122, 1 ( 6 Cent.) [ πάντων των υπάρχοντων και] [ πά Qξοντων πραγμάτων κινη[των τε και ακινήτων και αυτοκινήτων, ... ] ενεχύρου λόγω και υ[ ποθήκης δικαίω...] SB 4680, 3 ( Byz.) [τών τε κινητών και] ακινήτων [ και αυτοκινήτων; P. Lond. I 113, 2 , 61 ( 6 Cent.): [? κεινητά τε και άκείνητα και αυτοκείν[ ητα ... ενεχύρου λόγω και] υποθήκης δικαίου; P. Lond. V 1902, 6 f. ( 6 Cent.) πάντα τα υπάρχοντα ημίν και υπάρξοντα πράγπατα κινητά τε και ακί νητά και αυτοκίνητα. (99) Note also P . Oxy. I 125, 18 (surety -indemnity, 560) επιβήναι κατά των πάντων διαφερόντων και πραγμάτων και πάντων αυτοκινήτων. (100) P. Cairo Masp. 67126, 52 f, (promise to repay, 541) υποθέμενος... πράγ ματα, κινητά τε και ακίνητα εν παντί είδι και γένοι ; 67127, 16 f. (same, 544) υποκείμενος ... πάντων μου των υπάρχοντων και υπάρξο[ ]των, κ[ι]νητών και ακινήτων, λόγω] ενεχύρο και υποθήκης δικαιω. The use of one or the other alone, e. g. P. Cairo Masp. 67156. 23 (570), 67312, 56 (567), P. Oxy. I 126, 17 (572), do mit indicate what classification is thought of. Res mobiles , immobiles and moventes 447 were incapable of selfmotion, res immobiles meant land and houses and the things, formerly movables, that were now definitely atta ched to them , res se moventes included slaves and animals (101). It is outside the scope of this article to trace the later deve lopment of the threefold classification . It may, however, be men tioned that it did not disappear at the end of the Justinianean era. In the east it is found often in the Basilica and may be traced as late as the Hexabiblos (102). What is more striking, in view of the strong Germanic influence of movables and immovables on mediaeval property law , is the persistence of the threefold classi fication in the west (103). (101) I see no reason why PREISIGKE translates aütokiinta as « Vich » , s. y . ajtukivnros . Without doubt, slaves were includend in such cases as C . 6 . 61. 6 . 2b, P . Cairo Masp . 67151, 88, etc. ; note also servos in the interpolated portion of D . 3. 3. 63. On the attribution of immovable character to movables see gene rally KÜBLER , Studi Bonfante, II, 345 ff. (102) See supra note 81. Cf. Hexabiblos 2. I, 4, 6 ; 3 . 3 . An interesting survival in Egypt is illustrated in the Coptic papyri of the eighth century . Crum , Kopt. Rechtsurk., 65, 60 (will): ANNETKIle ennetkile as linnenklee zapizapoq = in that which moves, that which does not move and that which moves of itself ] ; 75 , 44 (will) : NETKILE UNNETENCEKile an unseTKIU Epoor ruin enoor ; 106 , 143 (donatio mortis causa ) : NETKIL UNETKI an unneteyarkie epoq ; cf. P . Lond. IV 1573, 13 : . . . . UNNETKIL an zaprzapog : ( 103) Among legal sources, e. g . Liber iuris Florentinus 3. 1. 3 (CONRAT, Florentiner Rechtsbuch, p . 9): Item rerum alie mobiles ut vestis, alie se moventes ut equus, alie immobiles ut fundus et que fundo coherent; IRNERIUS, Formularium tabellionum (PALMIERI, Scripta Anec. Gloss., I), 219 col. 2 : In omnibus aliis bonis mobilitus et immobilitus et semoventibus... heredes instituo ; also 221, col. 2 , a deed of gift. Among the documents MARINI, Papiri diplom . No. 90 , p. 139 (6 -7 Cent.) : totius substantiae meae mobile et immobile seseque moventibus, Fi CKER, Urk. Z. Reichs. u . Rechtsgesch . Ital., No. 29, p . 40 (976 ) : mobile vel immo bile , et de omnibus sese moventibus ; D ' AMIA , Schiavitù rom . et servitù med ., No. 7, p . 224 (1149 ): mobilibus et immobilibus et semoventibus. The Greek docu ments of the west, also SPATA , Pergamene greche, No. 8, p. 217 (1109): unvitá , aůtokivnta vai årivnta ; TRINCHERA, Syll. graec. membran ., No. 97, p . 127 (1125 ): ngàymaol neintots droivýtous vai aŭtoxelvýtois ; also TRINCHERA, pp. 246 , 253, 324 . 448 Arthur Schiller - Res mobiles, immobiles and moventes IV . Conclusion . The historical development of the threefold classification of pro perty and its position in the Justinianean era is , in the last ana lysis, only the picture of a very small fragment of Roman law . The possibility of Neo - Platonic influence on post-classical law is , on the other hand , a matter of major importance. It is of little significance whether the author has demonstrated the Neo -Platonic origin of a novel classification of property or not. A new factor appears, along with Beirut, court practice and the other elements that have been advanced to demonstrate eastern influence or in ternal development in the Roman law of post- classical times( 104). And it is the author' s belief that Neo - Platonic philosophy will eventually play no small part in the history of post- classical law . ( 104) For the various views see the author's summary and reff., Georgetown Law Jour., XXI, 147 ff. FRANZ HAYMANN ORD. PROFESSOR DER RECHTE AN DER UNIVERSITÄT KÖLN DIE HAFTUNG DES NEGOTIORUM GESTOR WEGEN VERSCHULDENS IM KLASSISCHEN UND IUSTINIANISCHEN RECHT SUMMARIUM Iurisconsulti Romani eum qui negotia aliena sua sponte administrasset non aliter quam tutorem vel eum qui mandatum suscepisset propter dolum solum non propter culpam teneri putaverunt. Sed Byzantini, suspicantes eum qui negotiis alienis se obtulisset, sui commodi gratia se immiscere , gestorem summam dili gentiam in negotiis alienis administrandis praestare voluerunt. Qua ratione Digesta et Codicem interpolaverunt, sed ex nonnullis locis qui manum Triboniani effuge runt, sententia prudentium Romanorum recuperari potest. Seit den epochemachenden Untersuchungen von Ludwig Mit teis über das Zivilunrecht in seinem « römischen Privatrecht » § 17 ist es nicht bloss herrschende Ansicht geworden , dass der Mandatar im klassischen Recht nur für dolus gehaftet hat, sondern auch die Zahl derer wächst immer mehr, die mit Mitteis annehmen, dass die Verantwortlichkeit für dolus mindestens der Ausgangspunkt der Haftung des tutor kraft der actio tutelae im klassischen Recht gewesen ist . Hingegen ist bis heutzutage die herrschende Ansicht (1) übrigens im Einklang mit Mitteis ( 2 ) dabei stehen geblieben, dass schon im frühen Recht der negotiorum gestor für diligentia habe einstehen müssen . Zwar sind eine Reihe der die Diligenzhaftung des negotiorum gestor aussprechenden Quellenstellen schon seit län gerer Zeit als interpoliert erkannt und in neuerer Zeit hat insbe sondere Kunkel (3) in Verfolgung seiner allgemeinen gegen die Klassizität der Haftung wegen diligentia gerichteten Untersuchungen wertvolle Kritik geleistet ; aber erst Arangio Ruiz hat in seinem bedeutenden Werk Responsabilità contrattuale in diritto romano ' (1. Aufl. 1927, 2 . Aufl. 1933) den Versuch unternommen zu zeigen , dass auch der Ausgangspunkt der klassischen Haftung des Geschäfts (1) Vgl. etwa BONFANTE , Istituzioni (7) $ 170 S. 497 ; GIRARD, Manuel (7) S . 659 ; SoHM -MITTEIS , Institutionen (17) $ 72 S. 444 ; JORS, Röm . Recht § 137 und noch KUNKEL ebenda 1935 & 154. KÜBLER , Sav.- St. 32 (1911) 197. (2) Röm . Privatrecht S . 331 Anm . 46 . (3 ) Sav.-St. 45, 266 fg . besonders 291 fg . 452 Franz Haymann führers ohne Auftrag in der Verantwortung für dolus gelegen habe. Die folgenden Ausführungen sind dazu bestimmt, diesen Versuch des grossen italienischen Forschers durch eine Reihe weiterer Ar gumente zu stützen und zu ergänzen . Auf die Unechtheit mehrerer in der justinianischen Kompilation die Diligenzhaftung des Ge schäftsführers ohne Auftrag klar aussprechenden Stellen komme ich nach den insoweit übereinstimmenden Untersuchungen von Kunkel und Arangio Ruiz nicht mehr zurück, so auf Iust. Inst. 3 , 27, 1 , i. f.; D . 50 , 17, 23 ; D , 3 , 5 , 5 , 14 ; auch nicht auf Pauli sententiae 1 , 4 , 1. Hingegen hat noch Mitteis die l. 10 D . 3 , 5 von Pompo nius libro 21 ad Quintum Mucium für einen sicheren Beleg dafür angesehen , dass schon Quintus Mucius die Diligenzhaftung des ne gotiorum gestor gekannt habe (4 ). Erst Arangio Ruiz hat hier mit sehr beachtlichen Gründen wahrscheinlich gemacht, dass ursprüng lich die Untersuchung der Juristen sich garnicht auf die Verant wortlichkeit desGestor wegen Verschuldens, sondern auf die Ersatz haftung des dominus wegen der Auslagen des gestor bezogen habe und dass der erste die Haftung des gestor wegen culpa und dolus aussprechende Satz der Stelle erst in der nachklassischen Bear beitung hinzugefügt worden ist. Der weitere Verlauf unserer Unter suchung wird die innere Wahrscheinlichkeit dieser Hypothese im allgemeinen unterstützen können, wenn erst die grundsätzliche Hal tung der Klassiker und der Byzantiner wahrscheinlich gemacht ist. Dass auch sonst die Klassiker bei Erwägung der Ersatzans prüche des gestor die Frage untersuchen, inwieweit dessen Auslagen durch ordnungsmässige Wahrnehmung der Interessen des Geschäfts herren entstanden sind, zeigen z. B . die in l. 9 von Ulpian und von Paulus in l. 12 D . 3, 5 erörterten Fälle, und vielleicht bezog sich auch der ursprüngliche Gehalt der c . 22 C . 2 , 18 von Dio kletian, deren spätere Ueberarbeitung sich schon aus dem für eine auftraglose Geschäftführung schwer erklärlichen non interveniente speciali pacto (5 ) ergibt, auch auf die actio contraria deş gestor. Auch die 1. 20 $ 3 D . 3 , 5 von Paulus (6), die den gestor tu dafür (4 ) Ebenso noch KÜBLER , Z . Sav.- St. 39 (1918 ) 191. (5 ) Vgl. KÜBLER, Z . Sav. St. 39 (1918) 1923. (6 ) Mandatu tuo negotia mea Lucius Titius gessit : quod is non recte gessit, tu mihi actione negotiorum gestorum teneris, (non ) in hoc tantum , ut actiones duas praestes [sed etiam quod imprudenter eum elegeris ut quidquid detrimenti negle gentia eius fecit, tu mihi praestes). Die Haftung des negotiorum gestor wegen Verschuldens etc. 453 haften lässt, dass er einen anderen zur Wahrnehmung der Interessen des dominus imprudenter bestellt habe, ist bereits von Fritz Schulz 1911 (Grünhuts Zeitschrift 38 , S . 52-53, teilweise zustimmend Partsch , Studien zur negotiorum gestio 16 Anm . 1) als interpoliert erkannt worden . Es ist das typische Zeichen nachklassischer Bear beitung, wenn wie hier aus dem verkehrten Verhalten eines Beauf tragten ohne Weiteres dessen unsorgfältige Auswahl durch den Auftraggeber abgeleitet wird (7). Stilistisch erwartet man statt elegeris elegisti, auch das Abstraktum neglegentia als Subjekt des ut-Satzes ist anstössig . Die Interpolationsannahme von Schulz und Partsch gewinnt an Gewicht, wenn man berücksichtigt, dass beide Gelehrte noch an der Neglegenzhaftung des gestor im klassischen Recht keinen Zweifel haben (8 ). Besonders eindringlich wird die strenge Haftung des nego tiorum gestor qui citra mandatum negotium alienum sponte gerit, in der c. 20 $ I C . 2, 18 von Diocletian betont, aber grade hier hat bereits Lenel (Sav.- Zschr. 38, 268 ff.) nachgewiesen, dass der Satz cum non tantum dolum et latam culpam sed et levem praestare ne cesse habeat den gedanklichen Zusammenhang der Stelle unterbricht und eingeschoben ist. Denn wie schon der Anfang der Stelle ebenso wie der Schluss der c. 20 klar zeigt, steht nur in Frage in wel chem Umfang der gestor ohne Auftrag sich der Geschäfte des tu anzunehmen hatte, nicht aber der Grad des Verschuldens, wegen dessen er dem tu aus solcher Geschäftsführung verhaftet sei. Der Kaiser hatte nur entschieden , dass der tu innerhald des freiwillig ( 7) Vgl. über solche fictive culpa in eligendo Partsch unter Berufung auf die bereits von Schulz hervorgehobenen Interpolationen . Dazu meine Haftung des Verkäufers (1912) 56 fg . ROTONDI Scr. giur. II, 490 mit Anm . 3 . (8) Partsch verweist zum Beweis für die Klassizität der hier ausgesprochenen Haftung des Gestor , dass in D . 3 , 5 , 36 , 1 erst die Byzantiner den Gestor für die Gefahr zufälliger Verschlechterung der erworbenen Forderungen entlasteten (vgl. anders Paulus I, 4 , 3 ). Aber auch die viel angerufene Stelle giebt schwerlich das klassische Recht unverändert wieder so wenig wie die 1. 36 § 1 cit. Der Schluss ist sicher so nicht von Paulus geschrieben . Zu collocavit fehlt das Object (pecu niam , anders II, 14 , 5a und 6), zu solvendo non sint das Subject, periculum agnoscere cogitur. Die Berufung auf die bona fides zum Schluss legt den Gedanken nahe, dass Paulus die Haftung für neglegentia dolosa hier behandelt hat, ähnlich wie II, 14 , 5 a (D . 26 , 7, 15). Vgl. für die Zinshaftung den echten Schluss von D . 3 , 5 , 5 , 14 . Franz Haymann 454 übernommenen Geschäftsbereichs das Erlangte nebst Zinsen heraus zugeben habe. Erst die Kompilatoren sind es, die in dem Einschub besonders geflissentlich hervorheben wollen, dass der gestor nicht bloss fürdolus und lata culpa,sondern auch für levis culpa einzustehen habe. In derselben Tendenz haben sie in c. 24 C . 4 , 32 von Dio cletian einen entsprechenden Einschub gemacht. Si mater tua maior annis constituta negotia quae ad te pertinent gesserit, [cum omnem diligentiam praestare debeat), usuras pecuniae tuae quam administrasse fuerit conprobata , praestare compelli potest. Hier hat bereits Kunkel im Zusammenhang seiner gegen die Diligenzhaftung gerichteten Untersuchung den Einschub vermutet (Sav.- Zschr. 45, 293). In der Tat bedürfte es zur Feststellung der Verpflichtung der Herausgabe der usurae pecuniae tuae also doch wohl der usurae perceptae und nicht percipiendae (9 ) nicht der Be rufung auf das Praestieren von omnis diligentia . Besonders lehrreich ist ein entsprechender Einschub in c. 7 C . 5, 51. von Diocletian. Quidquid (tutoris] dolo [vel lata culpa vel levi culpa sive] cura toris minores amiserint vel, cum possent, non aquisierint, hoc etiam in [tutelae sive] negotiorum gestorum [utile] iudicium venire non est incerti iuris . Dass hier das schwerfällige vel lata culpa vel levi culpa einge schoben sei, hat schon Paul Krüger aus dem Vergleich mit der entsprechenden Stelle in den Basiliken 38 , 3, 32 (Heimbach III S . 725 ) vermutet ; denn hier heisst es einfach in der lateinischen Uebersetzung ): Si quid dolo tutorum vel curatorum minores vel ami serint vel non aquisierint, ab illis exigere possunt. Also es ist nur von der Dolushaftung die Rede und dem entspricht noch das Scho lion des Theodorus : Actione tutelae pupilli petunt quae dolo vel furto tutorum suorum amiserunt vel non aquisierunt. Aber das minores legt nahe, dass erst die nachklassischen Bearbeiter den tutor und die actio tutelae (10) eingefügt haben und ursprünglich nur von dem negotiorum gestorum iudicium die Rede war, aus dem der curator minoris haftete. Jedenfalls zeigt dieser Einschub in der consti (9 ) Vergl. Paulus I, 4 , 3 ; 1. 18 , § 4, 136 § 1, l. 29, § 3 D . 3, 5 ; 1. 13 $ 1, I. 32 & 3 D . 22, 1 ; 1. 10 $ 22, 1 ; 1. 10 § 3 u . 8 D . 17, 1. (10) Anders z . B . ALIBRANDI, Opere 584, LENEL, Sav.- St. 35 ( 1914 ) 207, PARTSCH , Neg . gestio 714. Die Haftung des negotiorum gestor wegen Verschuldens etc. 455 tutio 7 citata die deutliche Tendenz der Kompilatoren die Haftung desjenigen, der fremde Angelegenheiten wahrnimmt, kraft actio tutelae und negotiorum gestorum wegen dolus in eine solche wegen lata und levis culpa zu verschärfen . Sehe ich recht, so liegt diesen Verschärfungen der Haftung eine ganz bestimmte Grundanschauung der byzantinischen Schul dogmatik zu Grunde, über die uns einige zerstreute Basilikenscho lien Aufschluss geben . So zunächst ein Scholion , das die bereits von Seckel (11), Mitteis ( 12) und Perozzi (13) verdächtigte und längst als interpoliert erkannte (14 ) 1. 25 § 16 D . 10, 2 betrifft. Paulus libro 23 ad edictum . Non tantum dolum sed et culpam in re hereditaria praestare debet coheres, quoniam cum coherede non contrahimus sed incidimus in eum : non tamen diligentiam praestare debet, qualem diligens pater familias, quoniam hic propter suam partem causam habuit gerendi et ideo negotiorum gestorum ei actio non com petit : talem igitur diligentiam praestare debet, qualem in suis rebus. Der Grund, weshalb hier der nachklassische Bearbeiter der Stelle den coheres, der sich der ihm mit den andern Miterben ge meinsamen Sache annimmt, nur für diligentia quam in suis einstehen lässt, liegt wie die Stelle selbst sagt, darin , quoniam hic propter suam partem causam habuit gerendi. Noch deutlicher sagen die Ba siliken 42, 3, 22, 16 (Heimbach IV S . 267): 'Et åváyung yàg toŨ ιδίου μέρους χειρίξει. Und noch deutlichen erläutert das das Scholion 13 : ' Επειδή γαρ ουχ εκόντες ένοχοι γίνονται αλλήλοις οι συγκληρονόμοι, αλλ' ανάγκη της κληρονομίας, διά τούτο ουκ απαιτούνται την άκραν επιμέλειαν, και ήν σπουδαίος οικοδεσπότης απαιτεί παρέχειν. Διά τούτο γάρ ουδε συγκρί νομεν αυτούς το νεγροτιoγέστορι, επειδή έκαστος αυτών ανάγκη διαφέροντος αυτό μέρους εμπίπτει τη διοικήσει την κληρονομαίων. Und noch knapper sagt das folgende Scholion des Kyrillos : 'Απαιτείται δόλον και κούλπαν την μετρίαν, επαιδή ουχ έκών διοικεί. (11) bei HEUMAMN sub verbo diligentia . (12) Röm . Priv. R . 33264 (13) Istituz. (2) II 1644. ( 14 ) Ueber die Stelle vgl. den Interpolationenindex besonders 244 ; BERGER, Teilungsklagen 1912, 131 fg., DE FRANCISCI, Synallagma II, 407, BONFANTE, Scr . giur. 3, 139, jüngstens ARANGIO -Ruiz , a. a . 0 . 244 fg . der schwerlich zu Recht quoniam — eum für echt hält. 456 Franz Haymann Hält man diesen Grundgedanken der Byzantiner fest, dass derjenige, der ohne Not sich fremder Angelegenheiten annimmt, strenger haften muss, so fällt auch Licht auf die schwierige 1.54, § 3 D . 47, 2 und damit auf die Gedankenwelt, die dieser byzanti nischen Abstufung der Verschuldenshaftung des Verwalters fremder Geschäfte zugrund liegt. Paulus libro 39 ad edictum : Qui alienis negotiis gerendis se obtulit, actionem furti non habet, licet culpa eius res perierit : sed actione negotiorum gestorum ita damnandus est, si dominus actione ei cedat. Eadem sunt in eo, qui pro tutore negotia gerit, vel in eo tutore qui diligentiam praestare debeat, veluti qui ex pluribus tutoribus testamento datis oblata satis datione solus administrationem suscepit. Die Stelle handelt bekanntlich von der Aktivlegitimation des sen, der fremde Geschäfte führt zur actio furti. Schon Kunkel (Sav. Ztschr. 45, 291) hat richtig gesehen , dass das all diesen Geschäfts führern Gemeinsame in der Stelle in dem Moment des negotiis se offerre gelegen ist. Aber dieses offerre muss im Sinne der Stelle als ein völlig freiwilliges verstanden werden . Wer , wenn auch ohne eine Gegenleistung zue fordern , ganz aus eigenem r inste olog S E Angelegenheiten Antrieb sich fremder annimmt, verdient nach der pessimistischen Einstellung dieser Byzantiner äusserstes Miss ch iinn dem Sinn , er könnte die fremde Angelegenheit , trauen -natürlich in die er ohne genügenden Anlass sich einmischt, zu seinem Vor teil ausnützen . Dem freien Sinn der Römer, ihrer Handhabung der bona fides und des Utilitätsprinzips ist solches Misstrauen gerade gegen den ohne Entgeld fremde Geschäfte Führenden gauz fremd ( 15 ). Aber nicht bloss dieses einigende Band ist schwerlich klas sisch , sondern auch der Inhalt der Stelle im einzelnen ist unheilbar überarbeitet. Dass die Klassiker weder dem negotiorum gestor noch dem tutor , die sich eine Sache des Geschäftsherrn haben stehlen lassen , die actio furti gewährt haben, dürfte freilich zutreffen ; denn sie waren ja selbst in diesem Fall dem Geschäftsherrn nur für dolus nicht auch für culpa , wie der licet Satz uns will glauben machen , (15 ) Ganz anders KÜBLER, Sav.-St. 39 (1918 ) 197, der aber ausser der von ihm selbst Festschrift fir Gierke II ( 1910 ) 253, 254' als interpoliert und höchst-ver worren bezeichneten Stelle für diese Regel des römischen Rechts » nur noch die l. 1 $ 35 D . 16 , 3 anführt, deren Unechtheit noch später erörtert werden soll. Die Haftung des negotiorum gestor wegen Verschuldens etc. 457 verantwortlich . Hier ist schon rein stilistisch das plötzlich ohne nähere Erläuterung hineinplatzende res anstössig, denn von einer Sache war vorher anders wie in den echten vorangehenden SS 1 u . 2 noch garnicht die Rede. Auch der anschliessende sed -Satz dürfte völlig unecht sein (16 ). Zunächst hätte man erwartet, dass im Gegensatz zu der mangelnden Legitimation des gestor positiv die Legitimation des dominus negotii, der doch wohl zugleich , die Stelle sagt freilich auch dies nicht deutlich – der dominus der gestohlenen res gewesen sein sein wird, betont worden wäre, wie etwa bei Gaius 3, 207 am Ende : sed ea actio domino competit. In unserer Stelle hingegen kann man diese positive Einstellung nur daraus erschliessen, dass die Verurteilung des gestor von der Cession der actio furti von Seiten des dominus abhängig gemacht wird. Übrigens wird durch den sed - Satz der Gedankengang der Stelle hinsichtlich der Activlegitimation zur actio furti durch die prinzipielle Erörterung der Haftung des gestor unterbrochen . Sti listisch ist das actione damnandus anstatt ex actione wie in Gaius 4 , 60 oder iudicio (vergl. Vocab. s. v . damno I E , F , 4 ) nur an dieser Stelle vorkommend und anstössig , ebenso wie das cedat statt cesserit (17). Also liefert auch der Anfang unserer Stelle keinen Be weis für die culpa Haftung des negotiorum gestor bei Paulus, so wenig übrigens, wie der Schluss der Stelle für die Diligenzhaftung des tutor; denn hier ist, wie bereits Kunkel (a . a . 0 . S . 291) erkannt hat, qui diligentiam praestare debeat schwerlich echt. Die Byzan tiner wollen durch den Relativsatz es so erscheinen lassen , als ob der tutor, der oblata satisdatione die ausschliessliche Geschäfts führung an sich bringt, wegen dieses negotiis se offerre für dili gentia haftet, während doch im klassischen Recht für die übrigen Vormünder nicht etwa eine geruilderte, sondern da sie von der Geschäftsführung ausgeschlossen sind , gar keine Haftung in Frage kommt (18 ). (16 ) Sav.- St.40 (1919) 300 hielt ich die Stelle zu Unrechtnoch für unverdächtig . Hingegen hat bereits BESELER, Beitr. 3 , 189 die Interpolation des sed-Satzes da raus gefolgert, dass der Klassiker nicht zu Regresszwecken die Abtretung einer Strafklage befohlen haben könne. Zustimmend KUNKEL, Sav.-St. 45 (1924) 291, Anm . 2 ; anders noch SCHULZ, Sav.- St. 32 (1911) 32. (17) Vergl. etwa Pomponius in l. 61 pr. D . 26 , 7. ( 18 ) Vergl. dazu LEVY, Sav.-St. 37 ( 1916 ) 16 mit Anm . 1 und 73 ff. mit Belegen . Roma · II 458 Franz Haymann Aus dem byzantinischen Grundgedanken , dass der, der aus freien Stücken und nicht mit dem Willen des dominus fremde Sachen verwaltet, strenger hafte , fällt auch Licht auf die 1. 86 D . 47, 2, deren heillose Verdorbenheit ich schon früher (Ztschr. 40 , 289 ff.) betont habe, freilich noch ohne diesen rechtspolitischen Gedanken der Byzantiner zu erkennen . Paulus libro secundo manualium . Is, cuius interest non subripi, furti actionem habet, si et rem tenuit domini voluntate, id est veluti is cui res locata est. Is autem qui sua voluntate vel etiam pro tutore negotia gerit, item tutor vel curator ob rem sua culpa subreptam non habet furti actionem ..... · Warum hier dem , der rem tenuit domini voluntate, wie z . B . dem Mieter die actio furti gewährt wird , nicht aber dem , der sua voluntate negotia gerit ist freilich aus der Stelle selbst, die ganz apodiktisch wie ein Gesetzgeber redet , nicht zu entnehmen , aber auch hier geben die Basilikenscholien den ersehnten Aufschluss . In dem Scholion 6 (Heimbach V , 533) heisst es von denen , die die Sachen haben nicht γνώμη του δεσπότου, sondern οικεία γνώμη : . 'Επί γαρ των τοιούτων προσώπων ως μεγάλη σκοπείται και τιμωρείται, ως αυτός ο δόλος: τα γάρ τοιαύτα πρόσωπα αει μεγάλην επιμέλειαν υπέρ των ανήβων απαιτούνται, και ο εκ τούτων μη μεγάλως επιμελή σάμενος μεγάλης αμέλειαν καί οίον δόλον νομίζεται αμαρτείν και διά τούτο, ωοπερ και κατά δόλον απολέσας πράγμα, ούκ έχει επ αυτή την φούρτι και οι κατά ραθυμίαν, έχει αυτήν, ει τέως και από ραθυμίας ενεχεται μικράς, αλλά μη εoικυίας δόλω μηδε κατά τον δόλον κολαζομένης, ούτως και τα παροντα πρόσωπα, επει επ ' αυτοίς ή μικρά ραθυμία ου σκοπείται, ως επί των άλλων, αλλ ώσπερ ο δόλος σκοπείται και κολαξεται επί των άλλων, ούτως επ' αυτών και μικρά ράθυμία ως μεγάλη και ως δόλος εξετάζεται, διά τούτο, κάν ραθυμιά αντών εκλάπη πράγμα, ουκ έχoυσε την φούρτι, ώσπερ ουκ είχον ονδε εάν δόλω αυτών έκλαπη. Vielleicht liegt diesen krausen Erwägungen der klassische Ge danke zu Grunde, dass auch eine bewusste Nachlässigkeit des Ge schäftsführers als ein Verstoss gegen die bona fides erscheint und ihn dem Mündel oder sonstigen dominus negotii verhaftet. Daraus haben dann aber die Bearbeiter in den byzantinischen Rechtsschulen laut unserem Scholion etwas ganz anderes gemacht : nämlich dass diejenigen, die nicht γνώμη του δεσπότου Sondern oίκαιά γνώμη fremde Geschäfte führen und fremde Sachen in Händen haben , so streng haften dass bei ihnen schon die geringste Nachlässigkeit wie mięyáin Die Haftung der negotiorum gestor wegen Verschuldens etc. 459 Qué sia und wie súdov åuagteiv gewertet wird. Einem solchen gleich sam als dolos fingierten Geschäftsführer sprechen darum die By zantiner wie dem wirklich unredlichen die actio furti ab . Er wird aber so streng behandelt, weil er aus eigenem Antrieb nicht mit dem Willen des Eigentümers die Sachen verwaltet. Damit fällt auch weiteres Licht auf die von mir bereits in meiner Arbeit über custodia (Sav. Zeitschr. 40, 178 note 1) behaup tete Interpolation der 1. 1 § 35 D . 16 , 3. Ulpianus libro 30 ad edictum . Saepe evenit ut res deposita vel nummi periculo sint eius apud quem deponuntur : ut puta si hoc nominatim convenit. Sed etsi se quis deposito obtulit, idem Iulianus scribit periculo se depositi illigasse , ita tamen ut non solum dolum , sed etiam culpam et custodiam praestet, non tamen casus fortuitos. Teile der Stelle sind, wie der Interpolationenindex ergibt, schon häufig als unecht beanstandet worden , aber der Schlussgedanke der Stelle, dass derjenige, der sich von sich aus zum depositum erbietet, darum allein anstatt für dolus für custodia einzustehen habe, ist bisher nur von mir als unmöglich dem Iulian zugehörig abgelehnt worden . Hinsichtlich der zahlreichen formellen Anstände verweise ich auf meine frühere Arbeit, sachlich sei aber noch einmal betont, dass sich weder in den justinianischen Rechtsbüchern noch ausser halb ihrer die geringste Spur dafür findet, dass die Klassiker den Depositar, der sich freiwillig anbot, anders und gar so ausseror dentlich hart haben haften lassen. So ist der apodiktische Aus spruch des Gaius (Inst. 3 , 207) sed is, apud quem res deposita est, custodiam non praestat, tantumque in eo obnoxius est, si quid ipse dolo malo fecerit von dieser Unterscheidung der l. 1, § 35 cit. aus unverständlich (19) ebenso der Mangel jeder Unterscheidung in Col latio X , 2 , 1 und 4. Aber auch in unserer Ulpianstelle selbst sollte man den beanstandeten § 35 als eine Fortsetzung des weit voran (19) Nicht minder die l. 1 $ 5 D . 44, 7 : Gaius libro 2 aureorum . Is quoque, apud quem rem aliquam deponimus, re nobis tenetur, qui et ipse de ea re, quam acceperit restituenda tenetur. Sed is etiamsi neglegenter rem custoditam amiserit, securus est : quia enim non sua gratia accipit, sed eius a quo accipit, in eo solo tenetur, si quid dolo perierit : neglegentiae vero nomine ideo non tenetur quia qui neglegenti amico rem custodiendam committit de se queri debet ..... Franz Haymann 460 gehenden § 6 derselben Stelle erwarten ; denn in dem Paragra phen 6 wie in den nachfolgenden wird die Frage der Verschärfung der Haftung des Depositars durch besondere Parteiabrede ausführ lich behandelt, sodass schon aus dem Grundgedanken des § 6 der unbehülflich formulierte Gedanke des ersten Teils des § 35 bis convenit überflüssig erscheint. Ebenso weiss der Ulpian des § 8 unserer Stelle garnichts von einer Abstufung der Haftung des bal neator, je nachdem er sich zur Verwahrung der ihm übergebenen Kleider erboten hat oder nicht, sondern derselbe Ulpian stellt die Frage der Dolushaftung nur darauf ab , ob der Bäderwirt für die Aufbewahrung keine merces empfangen hat. Wohl aber findet sich die Unterscheidung des § 35 in der bereits längst als interpoliert erkannten l. 17 § 1 D . 19, 5 . Ulpianus libro 28 ad edictum Si margarita tibi aestimata dedero, ut aut eadem mihi ad ferres aut pretium eorum , deinde haec perierint ante venditionem , cuius pe riculum sit ? Et ait Labeo, quod et Pomponius scripsit, si quidem ego te venditor rogavi, meum esse periculum , si tų me, tuum : si neuter nostrum , sed dumtaxat consensimus, teneri te hactenus ut dolum et culpam mihi praestes . Actio autem ex hac causa utique erit prae scriptis verbis. Die zahlreichen bisherigen Beanstandungen der Echtheit er geben sich aus dem Interpolationenindex. Hervorheben möchte ich von ihnen De Francisci Synallagma 1, 100 ff. Dieser Autor hat zu Recht das si neuter nostrum , sed dumtaxat consensimus, als unlo gisch beanstandet, aber auch die vorangegangene schon dem Labeo und dem Pomponius in den Mund gelegte Unterscheidung si quidem ego te venditor rogavi (in der indirekten Rede !) und si tu me ist unlogisch. Inwiefern konnten diese Klassiker beim Trödelvertrag von dem Hingeber ego als einem venditor reden oder gar in dem saloppen si tu me den Anschein erwecken, als ob auch der tu als venditor auftreten könne ? Ein solcher Bericht des Ulpian steht mit dem , was er uns in der l. 1 pr. D . 19, 3 über die kontroverse Natur des Trödelvertrags berichtet, im Widerspruch . Vor allem aber straft die im $ 1 dieser 1. 1 cit. von Ulpian selbst hinsicht lich der Haftung des Empfängers der Sache gegebene Entscheidung die scholastischen von ihm ohne jeden Widerspruch berichteten Distinktionen des angeblichen Labeo und Pomponius Lügen : Die Haftung des negotiorum gestor wegen Verschuldens etc. 461 Aestimatio autem periculum facit eius, qui suscepit : aut igitur ipsam rem debebit incorruptam reddere aut aestimationem de qua convenit (20 ). Was nun die in l. 1 $ 35 D . 16, 3 behauptete Haftung des is qui se deposito obtulit, angeht, so hat man sie – z . B . Seckel in seinem Custodiaartikel im Quellenlexicon von Heumann unter... (21) - damit erklären wollen, dass der sich anbietende Depositar aus Eigennutz handele. Aber das blosse Anbieten zu einem nur dem Anbietenden Opfer auferlegenden Geschäft, wie es das depo situm ist, beweist weder heute noch zu Zeiten der Römer bereits ein eigennütziges Motiv und die Stelle selbst bietet weder dafür noch für den allein erheblichen Umstand , dass der Anbietende eine Gegenleistung verlangt und damit die Natur des Depositum über schritten hätte, den mindesten Anhalt. Auch bei dem unentgeltli chen Mandat machen die Klassiker nirgends die Dolushaftung des Mandatars davon abhängig , dass er nicht se mandato obtulit. Der Gedanke, aus der Initiative desjenigen der sich zu einem Freund schaftsdienst in depositum oder mandatum erbietet, den Willen zu folgern die Gefahr des Untergangs der ihm anvertrauten Sache zu übernehmen , ist ganz abwegig. Ex lege aber denjenigen , der sich hochherzig zu einem Freundschaftsdienst selbst erbietet, strenger haften zu lassen als den andern , der sich erst dazu bitten lässt , liegt gewiss kein Anlass vor, auch nicht für die Klassiker, sei es dass sie beim Depositum die formula in factum oder in jus hand habten . (20 ) Uebrigens ist auch Paulus 4 , 1, 4 schwerlich von Paulus : Si rem aesti matam tibi dedero ut ea distracta pretium ad me deferres, si quidem ego te ro gavi, meo periculo perit ; si tu de vendenda promisisti, tuo periculo perit; denn nicht bloss das zweimalige periculo perit ist unschön , sondern auch sachlich ist die Distinktion ego te rogavi und tu de vendenda promisisti weder einander aus schliessend doch überhaupt den Tatbestand si rem aestimatam tibi dedero er schöpfend. (21) Ebenso ROTONDI, Scritti giur. II, 118 nach note 4. Darum findet R . auch eine analoge Entscheidung in l. 17 § 2 D . 19 , 5 , die doch garnicht auf die Frage abstellt, welche Partei den Vertrag angeregt und vorgeschlagen (wie l. 17 1) sondern von ihm Vorteil hat. Dass aber die Klassiker Initiative und Eigenvorteil der Partei auseinanderhielten , zeigt doch noch der heutige Zustand von D . 3, 5 , 3, 9. 462 Franz Haymann Wenn somit Arangio -Ruiz in seiner responsabilità contrat tuale (2 Aufl. S . 117) meine Beanstandung der Custodiahaftung des is qui deposito se obtulit als in base ad un preconcetto sull' op portunità solcher Haftung geschehen tadelt und ihr entgegenhält, das bedeute ein voler mettere il carro innanzi ai buoi und die Tendenz, die Haftung dessen , der sich freiwillig zu einer Aufgabe erbietet, zu verschärfen, finde sich zu allen Zeiten und Orten , so ist darauf zu erwidern, dass freilich noch der Code civil art. 1928 ebenso wie der Codice civile art. 1844 Nr. 1 kraft der Autorität des Corpus juris zwar diese hier beanstandete Verschärfung der Haftung des sich anbietenden Depositars wiederholt, dass aber unser deutsches bürgerliches Gesetzbuch diese Unterscheidung zu Recht aufgegeben hat und nur noch fragt, ob der Depositar ent geltlich oder unentgeltlich verwahrt ($ 690 BGB) (22 ). Ebenso wenig findet sich die Unterscheidung im Schweizer Obligationenrecht, vergl. Art. 99 , 472-474. Vor allem aber darf gegenüber Arangio Ruiz scharfem Tadel darauf hingewiesen werden , dass die in der 1. 1 $ 35 cit und nur in ihr sich findende seltsame Verschärfung der Haftung zwar nicht durch den Gehalt der klassischen Prozess formel, wohl aber durch den von uns bereits an anderen Beispielen erwiesenen Grundgedanken der Byzantiner erklärt wird , wonach derjenige, der ohne Not völlig aus freien Stücken eine fremde Angelegenheit wahrnimmt besonders streng haften soll. Es ist klar, dass hier das Misstrauen gegen den sich freiwillig Erbietenden, er möchte das Geschäft zu seinem Vorteil ausnutzen, die Entschei dung dikiert hat. Lehreich ist auch das praktische Beispiel, das die Scholien 42 und 45 der Basiliken 13, 2 , 1, 35 (Heimbach 2 , 35) geben : si cum aliquem ex amicis meis quaererem , cui lancem meam deponerem , tu te obtulisti, depositum suscipere volens. Glaubt man wirklich, es sei eines Klassikers würdig , die Haftung non doli tan tum verum etiam culpae et custodiae nomine darauf abzustellen , ob zuerst der ego den tu oder der tu den ego gefragt hat ? Lehrreich ist auch , dass das Scholion 43 mit dieser Unterscheidung die nachklassische Haftung des is qui liti se obtulit mit rei vindicatio und hereditatis petitio , aber auch des negotiorum gestor zusammen stellt : hic enim dolum et exactam diligentiam praestat, hoc est cul (22) Aehnlich-freilich mit anderen Rechtsfolgen -die echte l. 1 § 8 D . 16 , 3. Die Haftung des negotiorum gestor wegen Verschuldens etc. 463 pam levissimam . Auch diese Zusammenstellung des Basilikenscho liasten zeigt, dass der strengen Haftung des negotiorum gestor und des is qui se deposito obtulit, die gleiche misstrauische Einstellung der Byzantiner zu Grunde lag. Den Klassiskern lag diese völlig fern. Auch die von mir in meiner Arbeit über custodia (Sav. Ztschr. 40 , 295 , Note 1 und 309 Note 1) nachgewiesene Unechtheit der 1. 49 D . 10, 2 mit ihrem angeblich klassischen Prinzip : hi enim demum ad duplae cautionem compelluntur, qui sponte sua distrahunt, beruht auf der gleichen unfreundlichen Einstellung der Byzantiner gegen diejenigen , die völlig freiwillig zum Verkauf schreiten . Wer es, um um einem obrrigkeitlichem Gebot zu entsprechen oder etwa sein Pfandrecht durchzuführen, tut, soll nicht verpflichtet sein die sti pulatio duplae mit seinem Käufer abzuschliessen . Zu Recht hat Levy (Sav. Ztschr. 42, 483 Note 2 ) als weiteren Beweis der Unecht heit dieser Gedankengänge auf die echten D . 10, 2, 25 , 21 ; D . 10 , 3 , 10, 2 und D . 24, 1 , 36 pr. hingewiesen . Damit ist aber auch die Grundlage gelegt um die Unechtheit der I. 3 § 9 D . 3, 5 zu erkennen . Ulpianus libro decimo ad edictum : Interdum in negotiorum gestorum actione Labeo scribit dolum so lummodo versari: nam si affectione coactus, ne bona mea distrahantur, negotiis te meis obtuleris, aequissimum esse dolum dumtaxat te prae stare: quae sententia habet aequitatem . Wäre dieser Bericht des Ulpian über die Haltung des Labeo zutreffend, so hätten wir damit freilich die bündigste Widerlegung unserer Annahme, dass der gestor im frühklassischen Recht grund sätzlich nur für dolus dem Geschäftsherrn gehaftet habe, denn das interdum dolum solummodo versari stellt diesen Fall als eine Aus nahme für Labeo hin . Aber schon der einer radikalen Haltung in Interpolationenfragen gewiss nicht verdächtige Kübler bemerkt, dass die Stelle stark überarbeitet sein möge (Sav. Ztschr. 39, 195 ) (23) . Nimmt man mit Lenel (Edictum , 3. Aufl. S . 102) und Kübler an , dass die Stelle sich auf die formula in factum concepta bezog und mit Kübler, dass auf Grund ihrer der Geschäftsführer ursprünglich für dolus einzustehen hatte (a. a . 0 . 196 ) so kann das abschwächende (23) Auf einen Vermerk dieser von KÜBLER nicht weiter begründeten Ver mutung berschränkt sich ARANG10 -Ruiz, Responsabilità (2 ) 2143. Franz Haymann 464 interdum zu Beginn der Stelle nicht von Labeo herrühren. Und in der Tat folgt die Unechtheit dieser Einschränkung mit einiger Sicherheit aus einer Erwägung der Voraussetzungen, unter denen angeblich Labeo die Dolushaftung des Gestor ausgesprochen haben soll. Es sind nach der Stelle zwei: der gestor muss affectione coactus und in der Absicht gehandelt haben, die Veräusserung der Güter des Geschäftsherrn zu verhindern. Aber einerlei, ob man annimmt ; dass Labeo hier eine actio in factum oder bereits die actio in jus concepta im Auge gehabt habe, es bleibt gleich unfasslich , dass er die entscheidende Frage der Abstufung der Haftung von einem so unsicheren und unkontrollierbaren seelischen Faktor, wie dem Ue berwältigtwerden durch affectio d . h . Zuneigung zum Geschäfts herrn abhängig gemacht habe. Aber erst recht unmöglich scheint mir das ne bona mea distrahantur als die zweite Voraussetzung einer ausnahmsweisen Dolushaftung, auf die die entsprechende Norm der Basiliken allein abstellt (24). Denn seit den Untersuchungen von Wlassak ( 25 ) und Partsch (26 ), denen auch Lenel (Edict S . 103 ) zustimmt, wissen wir, dass das Edict über die negotiorum gestio auf die defensio absentis berechnet gewesen ist. Darüber lässt ja schon der Bericht desselben Ulpian aus demselben zehnten Buch seines Edictkommentars in der lex 1 D . 3 , 5 keinen Zweifel : Hoc edictum necessarium est, quoniam magna utilitas absentium versatur, ne indefensi rerum possessionem aut venditionem patiantur vel pignoris distractionem vel poenae committendae actionem vel iniuria rem suam ammittant. Ist aber die Abwehr der dem absens indefensus drohenden Ge fahr der venditio bonorum der Ausgangspunkt des Edicts, so kann . nicht der das Edict kommentierende Labeo entschieden haben, dass grade in diesem Falle der für den absens eintretende negotiorum gestor ausnahmsweise weil aequissimum nur für dolus haften solle ; denn das hierauf angeblich abgestellte interdum war in Wahrheit (24 ) Vgl. suppl. I, 132: cav Suà có ng ngaº vat cà coảyuarả too vétaies heavtov, door uòvov XQEDOTETS. Nach dem Stephanos-Scholion (p . 131) hat der gestor die missio oder venditio wirklich abgewendet und hier die Dolus Haftung damit gerechtfertigt : Oüte yàs Ēdel TÒV to oaota ε Egyetńoavta και από ραθυμίας κατέχεσθαι. (25 ) Zur Geschichte der negotiorum gestio 39. ( 26 ) Studien zur negotiorum gestio I, 10 fg. . Die Haftung des negotiorum gestor wegen Verschuldens etc . 465 der Regel- und -Musterfall des praetorischen Edicts . Darf man aber mit Lenel aus der Entscheidung des Labeo schliessen , dass die Einschränkung der Haftung des gestor auf dolus nicht bereits in dem Wortlaut der Formel der actio directa enthalten war, sondern erst in Gemässheit des Utilitätsprinzips der Auslegung der Iuristen entstammte, so ist die Annahme Küblers (a. a. O . 196 ) wenig glaub haft, dass man später aus dem ex fide bona der formula in ius concepta die Ausdehnung der Haftung auf culpa abgeleitet habe, insoweit damit das Bereich der neglegentia dolosa überschritten sein sollte. Berücksichtigt man hingegen unsere früheren Feststellungen darüber, dass es erst die byzantinische Schuldogmatik war, welche denjenigen Geschäftsführer, der ganz freiwillig , érov und olxeią yróun sich fremder Angelegenheiten annahm , besonders streng haften lassen wollte im Gegensatz auch zum Miterben, der åváyky ñs kângovoulag handelt (27) so wird es nichtmehr wunder nehmen , dass dieselbe nachklassische Lehre für denjenigen eine Ausnahme zuge stehen wollte , der gleichfalls nicht ganz freiwillig , sondern unter dem Druck einer psychologischen Notwendigkeit, affectione coactus d . h . durch seine Zuneigung zu dem durch drohende venditio bo norum gefährdeten absens bezwungen in dessen Angelegenheiten ein griff. Dass die genialen römischen Praktiker hingegen von einer solchen unkontrollierbaren Einstellung und Motivierung die Ver schuldenshaftung des Geschäftsführers hätten abhängen lassen , ist wirklich kaum glaublich. Sie werden auch bei Handhabung der formula in jus concepta die Haftung des gestor von einem Verstoss gegen die bona fides abhängig gelassen haben , unter den ja, wie wir längst wissen (28), auch eine wissentliche Neglegenz fiel. Dies entsprach auch den klaren Linien des Utilitätsprinzips, wie sie es beim mandatum , depositum , tutela einerseits und beim commodatum andererseits handhabten . Damit soll natürlich die im justinianischen Gesetzbuch ausge sprochene verschärfte Haftung des Geschäftsführers, wie sie auch in die modernen Kodifikationen übergegangen ist, nicht vom legislativen Standpunkt aus getadelt werden, auch nicht die Einschänkung dieser strengen Haftung für den Fall der beabsichtigten Abwendung einer dem Geschäftsherrn drohenden dringenden Gefahr nach 680 des ( 27 ) Vgl. oben. ( 28 ) Vgl. schon MITTEIS, Röm . Pr. R . 325 fg . Franz Haymann 466 deutschen BGB und dem entsprechenden Art. 420, Abs. 2 des Schweizer Obligationenrechts. Denn die negotiorum gestio betraf be reits im entwickelten klassichen Recht nicht mehr bloss den Schutz der absentes indefensi und die Abwehr einer ihnen drohenden venditio bonorum , sondern jede Wahrnehmung fremder Angelegenheit ohne besondere Ermächtigung durch den Geschäftsherrn oder das .Gesetz . Da wird es begreiflich, wenn die Byzantiner, die die Haftung des uneigennützig für andre einspringenden gestor auf omnis culpa ausdehnten und ebenso die ihnen hierin folgenden modernen Ge setzgebungen entsprechend unserer 1 3 8 9 cit. für den Fall eine Abmilderung der Haftung bestimmten , dass die Geschäftsführung die Abwendung eines unmittelbar drohenden Schadens von dem Geschäftsherrn beabsichtigte. Aber für die Echtheit unserer Stelle folgt daraus nicht das mindeste . Hingegen träfe folgende Restitution vielleicht den klas sichen Sinn : In negotiorum gestorum actione Labeo scribit dolum solummodo versari. Nam si ne bona mea distrahantur, negotiis te meis obtuleris, aequissimum esse dolum dumtaxat te praestare. Quae sententia habet aequitatem . Spuren der Dolushaftung enthält auch noch der unserer Stelle unmittelbar vorangehende $ 8 : Si executor a praetore in negotio meo datus dolum mihi fecerit, dabitur mihi adv

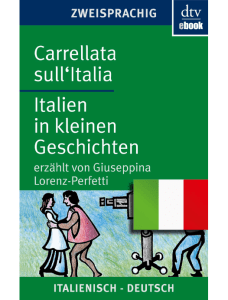
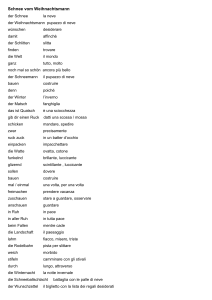
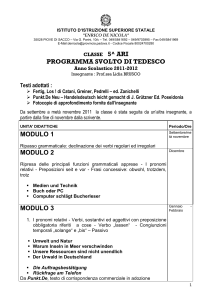
![Ricerca nr. 1 [MS WORD 395 KB]](http://s1.studylibit.com/store/data/000076742_1-2ede245e00e21c823e517529e1c3be46-300x300.png)